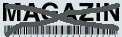Direkte Demokratie?
Das Problem an der Demokratie ist nicht nur, dass Entscheidungen an Vertreter delegiert werden – auch direktdemokratische Verfahren können Hindernisse für die Freiheit sein.
Von Leuten, die mit dem parlamentarischen Regierungssystem unzufrieden sind, werden häufig „direkte Demokratie“ oder „Basisdemokratie“ als Alternativen vorgeschlagen. Es wird hier im Wesentlichen an zwei Möglichkeiten der Entscheidungsfindung gedacht, welche das Parlament ersetzen sollen: Zum einen Volksabstimmungen; zum anderen Volksversammlungen auf öffentlichen Plätzen.
Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Vorschlag der Volksabstimmungen: Diese Möglichkeit gibt es ja bereits in der jetzigen deutschen Verfassung für bestimmte Fragen und in der Schweiz spielt sie bekanntlich eine noch größere Rolle. Wenn nun aber nicht bloß einige wenige, sondern sämtliche politische Entscheidungen von den Bürgern selbst getroffen würden – wie einige Befürworter der direkten Demokratie fordern – würde dann nicht endlich das umgesetzt, was wirklich unseren Interessen und Wünschen entspricht?
Das Problem an dieser Idee ist, dass hier lediglich eine Veränderung des politischen Systems gefordert wird, während einer Umwälzung der ökonomischen Basis der Gesellschaft nicht vorgesehen ist. Auch wenn es weder ein Parlament noch Berufspolitiker mehr gäbe, weil wir über alle relevanten Fragen direkt abstimmen könnten, wäre dadurch weder das Privateigentum, noch die Konkurrenz oder das Prinzip der Profitmaximierung außer Kraft gesetzt. Die Menschen würden dadurch weiterhin in den ihnen von den ökonomischen Verhältnissen vorgegebenen Rollen als Unternehmer, Lohnabhängige, Studierende, Staatsbeamten usw. verbleiben. Und sofern sie ihre jeweilige Rolle innerhalb des Systems nicht bewusst in Frage stellen, wird ihr Abstimmungsverhalten von den damit verbundenen Konkurrenzverhältnissen, Interessengegensätzen und Vorurteilen bestimmt werden. Dass die Ergebnisse oft hässlich wären, lässt ein Blick in die Schweiz erahnen: So sprach sich dort z.B. in einer Volksabstimmung 2014 die Mehrheit der Wähler für eine Initiative „gegen Masseneinwanderung“ aus. Bereits fünf Jahre zuvor hatten die Schweizer per Volksentscheid den Neubau von Minaretten in ihrem Land verboten. Es liegt auf der Hand, dass ihre Motive dabei nicht religionskritisch, sondern schlicht rassistisch waren – schließlich hatten sie gegen den Bau von Kirchtürmen nichts einzuwenden.
Dass eine Ausweitung von Volksabstimmungen die Zwänge und Ungleichheiten der bestehenden Ordnung nicht überwinden wird, dürfte klar geworden sein. Wie steht es aber mit den öffentlichen Volksversammlungen? Diese klassische Variante der direkten Demokratie, deren Ursprünge bis ins antike Griechenland zurückreichen, ist in den letzten Jahren durch Bewegungen wie ¡democracia real ya! („Echte Demokratie jetzt!“) in Spanien, Nuit debout („Aufrechte Nacht“) in Frankreich oder Occupy auf der ganzen Welt erneut populär geworden. Die an diesen Bewegungen Beteiligten trafen sich – oft zu Tausenden – an zentralen Orten der Innenstädte von Athen über Madrid bis New York, um ihren Unmut über die bestehenden Verhältnisse kundzutun, ihre Ideen für eine bessere Welt zu debattieren und per Handzeichen über Vorschläge abzustimmen. Viele sahen diese Zusammenkünfte als Keimform einer neuen und besseren Form der gesellschaftlichen Organisation. Wenn in den Vollversammlungen jeder und jede sprechen darf – unabhängig von Alter, Geschlecht, Beruf oder Nationalität – wäre das nicht die Abschaffung der Hierarchien und Ausschlüsse, die unsere Gesellschaft durchziehen?
Auch hier stellt sich zunächst wieder das Problem der mangelnden Kritik der ökonomischen Verhältnisse. Anders als bei den meisten Befürworter von Volksabstimmungen war in Bewegungen wie Occupy zwar ein diffuses antikapitalistisches Gefühl weit verbreitet. Jedoch wollte die Mehrheit der Beteiligten lediglich gegen einige besonders unbeliebte Symptome der Marktwirtschaft vorgehen – etwa die Macht der Großbanken beschränken oder den Handel an der Börse stärker kontrollieren – während die grundlegenden Bestandteile der kapitalistischen Ordnung wie Eigentum, Geld und der Zwang zur Lohnarbeit nicht in Frage gestellt wurden. Eine radikale Minderheit sah dies zwar anders, aber mit Ausnahme der Stadt Oakland in Kalifornien und vielleicht ein paar anderen Orten konnte diese sich kaum Gehör verschaffen. Wie dem auch sei, entscheidend ist, dass es der Bewegung insgesamt nicht einmal im Ansatz gelang, die Organisation des Lebens außerhalb der von ihnen besetzten Plätze umzukrempeln. Solange sonst alles läuft wie gewohnt, ist es für Staat und Kapital nicht sonderlich bedrohlich, wenn ein Haufen Leute in der Innenstadt campt. Und so konnten die Behörden letztlich einfach warten, bis sich die Sache von selbst auflöste, weil die meisten Aktivisten früher oder später wieder arbeiten gehen oder Prü-fungen an der Uni machen mussten.
Wenn wir jedoch einmal von den Schwächen der real existierenden Protestbewegungen absehen und uns vorstellen, es würde uns tatsächlich gelingen, die Produktionsmittel zu vergesellschaften und den Staatsapparat zum Verschwinden zu bringen – wären dann basisdemokratische Versammlungen nach dem Vorbild von Occupy nicht das ideale Mittel zur Organisation der neuen, freien Gesellschaft? – Auch hier sind wir skeptisch.
Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es bei Occupy und artverwandten Bewegungen zwei gegensätzliche Vorstellungen von der Rolle der Massenversammlungen gab: Nach dem Willen der einen sollten diese die Beschlussfassungsorgane der Bewegung sein, während die anderen in ihnen wesentlich Orte der Begegnung sahen.
Die erste Fraktion, die in den meisten Städten dominierte, sahen in den Debatten und Abstimmungen auf den Vollversammlungen den entscheidenden Mechanismus der gemeinsamen Willensbildung. Jede Handlung, die im Namen der Bewegung durchgeführt werden sollte, musste nach ihrer Vorstellung dort per Mehrheitsentscheid abgesegnet werden. Aus ihrer Sicht war es undemokratisch, wenn Einzelne oder Gruppen Aktionen machen wollten, für die es keinen offiziellen Beschluss gab. Dies führte in der Praxis zu einer Lähmung der Eigeninitiative der Beteiligten; insbesondere radikalere Initiativen wurden oft mit dem Hinweis abzuwürgen versucht, dass sie nicht durch eine Resolution der Vollversammlung legitimiert seien. Wenn die Abstimmungen zur Hauptaufgabe der Versammlungen erklärt wurden, waren dadurch allein aufgrund der schieren Masse der Beteiligten die meisten zur Passivität verdammt: Sie mussten stundenlang herumsitzen und Rednern lauschen, deren Redezeit jeweils streng auf wenige Minuten beschränkt war und die schon deshalb oft wenig Vernünftiges sagen konnten. Angesicht der Menge der Teilnehmer war die Möglichkeit, selbst zu sprechen, naturgemäß äußerst begrenzt. Die Aktivität der meisten erschöpft sich daher darin, zuzuhören, durch verabredete Handzeichen Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren und zuweilen über bestimmte Vorschläge abzustimmen. Sie blieben im wesentlichen Zuschauer. Im Grunde war ihre Rolle den Wähler in der parlamentarischen Demokratie gar nicht so unähnlich – nur dass sie den politischen Prozess nicht zuhause vor dem Fernseher, sondern live und unter freiem Himmel verfolgten.
Anarchisten und andere Radikale innerhalb von Occupy haben daher eine andere Zweckbestimmung der öffentlichen Versammlungen vorgeschlagen: Diese sollten wesentlich Orte des Palavers sein. Die Beteiligten einer Platzbesetzung sollten sich lediglich auf einige sehr allgemein gehaltene Grundsätze einigen; darüber hinaus sollte jede Teilgruppe und jedes Individuum der Bewegung völlige Freiheit in der Wahl der Mittel und Initiativen haben. Die Besetzung sollte ein Ort der Begegnung und des Austausches sein, um voneinander zu lernen, zu debattieren, Mitstreiter für eigene Projekte zu finden oder sich von den Vorhaben anderer begeistern zu lassen. Es ist kein Zufall, dass Occupy Oakland, eine der wenigen Besetzungen, bei denen diese Sichtweise vorherrschend war, sich zu einem der hot spots der Bewegung entwickelte, wo eine Vielzahl unterschiedlicher Initiativen und Aktionsformen entstanden, die weit über die Grenzen dieser kalifornischen Kleinstadt hinaus auf Resonanz stießen.
Es ist aus dem Gesagten sicherlich deutlich geworden, dass wir die zweite Auffassung vom Sinn und Zweck von Vollversammlungen für vernünftiger halten. Letztlich entspringt das Bedürfnis nach demokratischer Legitimation des eigenen Handelns durch eine zentrale, anerkannte Entscheidungsstruktur wahrscheinlich einer gewissen Ängstlichkeit, die zeigt, dass die Bewegung noch nicht bereit war, wirklich mit den Verkehrsformen der alten Welt zu brechen und die Beteiligten sich und anderen nicht zutrauten, völlig selbstbestimmt zu handeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir die Möglichkeit von Beschlüssen durch große Versammlungen in einer freien Gesellschaft nicht ablehnen; solche Prozesse sollten aber nicht überbewertet werden und dürfen vor allem nicht die Freiheit zur selbstständigen Initiative der an diesen Versammlungen beteiligten Gruppen und Individuen ersticken.