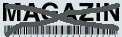Notiz zur Scherbentheorie
Aus Anlaß einer Diskussionveranstaltung zur Scherbentheorie eine weitere Notiz zu dieser Broschüre, um einigen Mißverständnissen aus dem Weg zu gehen.:
Der Genauigkeit wegen sei festgehalten, dass sich um zwei Texte handelt. Einmal die Scherbentheorie, ein Beitrag über den Stand revolutionärer Organisierung und dann die Reflexionen über den Club für sich, ein subjektiverer Text über den Fehlschlag der „Club für sich“ genannten Veranstaltung. Das nur, um auf den zweiten Text hinzuweisen, der eventuell ein wenig unterging.
Weiter heißt es in der Ankündigung, es handle sich bei der Scherbentheorie um einen „Appell, Identitäten und Isolationen zu überwinden, um gesellschaftliche Relevanz zu erlangen.“ Tatsächlich gab es nach Erscheinen des Textes immer wieder Kritik, dass er auf die Illusion einer großen, doch noch gelingenden Einheit des linken Scherbenhaufens setzt. (1) Etwa durch folgende Passage: „Das Zerfallen der Bewegung in Scherben muss kein Unglück sein, wenn die jeweiligen Scherben die abgespaltenen Anteile ihrer selbst erkennen und aufnehmen. Ziel müsste es sein, eine subversive Kraft zu schaffen, die die vorhandenen Splitter in sich aufhebt und dabei vollständig verwandelt.“ Zwar wird in sofort angemerkt, dass dieser Vereinigungsprozess auch ein Verwandlungsprozess sein müsse und außerdem „das Gegenteil von allseitiger Akzeptanz und Toleranz“, nämlich „Streit“. Mindestens jedenfalls „kein all-linker Pluralismus, dem es nur darum geht, dass alle etwas mehr miteinander reden, sondern im Gegenteil das Eingeständnis, dass alle Splitter gleich wenig taugen und dass, wenn sie sich nur gut verstehen würden, dies auch nichts an ihrer Unzulänglichkeit ändern würde.“ Aber es geht im weiteren Sinne um eine Reform des linken Scherbenhaufens selbst.
Die Vorstellung, die gegenwärtige Szene könnte sich zu einer Art Avantgarde aufklärerischer Umbrüche verwandeln, ist naiv; wer einmal einer Scherbenideologie aufsitzt, kommt da normalerweise kaum wieder raus. Bei Einzelnen mag das manchmal klappen, vor allen, wenn sie aus pragmatischen und nicht aus ideologischen Gründen bei irgendeinem Fragment der Linken mitmachen. Aber die Gruppen selbst lösen sich höchstens auf oder spalten sich auf irgendeine überflüssige Weise in zwei Dummheiten auf. Später schreiben die Autorinnen dann auch defensiver: „Trotz ihres beklagenswerten Istzustandes halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass sich aus gegenwärtigen radikalen Splittergruppen Leute finden werden, die ihre fragmentierte Starrheit überwinden und sich zur Totalität eines wirklichen revolutionären Projekts zusammenfügen.“ Also schon keine Transformation der Splittergruppen selbst, sondern eben nur einige Individuen aus denselben, die sich in neuem Zusammenhang mit neuen Leuten zusammentun.
Wichtiger sind im Fortgang des Textes dann aber äußerliche Momente, die zum Zerfall der Szene führen: „In seltenen Fällen wird diese Aufhebung von Protagonisten der einzelnen Scherben selbst bewerkstelligt werden, wahrscheinlicher ist vielleicht, dass dritte Protagonisten auftauchen, die die Scheinwidersprüche der letzten politischen Generation von vornherein nicht akzeptieren.“ Das können nachwachsende Akteure sein, die einen klareren Blick auf die objektiven Widersprüche gewinnen und bemerken, dass dieselben im subjektiven Streit in der Regel völlig überbewertet werden, da man sich die Widersprüche der Gesellschaft nicht unmittelbar gegenseitig moralisch vorwerfen kann – es sei denn man will ein „Moraltrompeter“ sein. Oder aber – so die Scherbentheorie – „Menschen, die sich bisher in keine Gruppe hineinzwängen wollten.“
Und weil auch das nicht besonders wahrscheinlich klingt, so erwägen sie noch größere äußerliche Ereignisse – eine Krise, einen Krieg, eine Katastrophe, eine spontane aus dem Nichts erscheinende revolutionäre Bewegung – die vielleicht irgendwen zu solchen Purzelbäumen zwingen könnten: „Wahrscheinlicher ist jedoch, dass, ähnlich wie auch bei der Revolution selbst, nicht der bloße voluntaristische Akt die Scherben durcheinanderwirbeln und sich erneut aufeinander beziehen lassen wird, sondern dass dazu ein eruptiver Impuls von außen nötig ist. Sei es das Auftauchen einer neuen revolutionären Kraft oder ein historisches Ereignis, dem man sich nicht entziehen kann und will“. Und sieben Engel bliesen mit ihren Posaunen zur Apokalypse. Jesus hilf!
Nach all dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung, wird abschließend auch die Möglichkeit eingeräumt, dass selbst die Apokalypse vom linken Szenehaufen ignoriert wird: „Es kann aber auch gut sein, dass die heutigen Gruppen eine solche Situation vollkommen verschlafen, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, ihren eigenen Status quo zu erhalten.“ Am Ende ziehen die Autorinnen sich dann auch lieber auf die Position verschwindender, sich aufklärender Minderheiten zurück und verdammen die Diktatur der bloßen Anzahl: „Letztendlich kommt es unmittelbar auch nicht auf die Anzahl alleine an, sondern viel mehr darauf, dass etwas Neues, etwas Kraftvolles entsteht, das in der Lage ist, einige Löcher in die alte Ordnung zu reißen, sodass sich überhaupt freie Alternativen abzeichnen können.“
Wie man auch immer zu den angerissenen Fragen steht, klar geworden sollte sein, dass, wenn die Scherbentheorie schon ein Appell sein soll, irgendwelche Identitäten zu überwinden und gesellschaftliche Relevanz zu bekommen, sie doch in keinerlei Weise erbaulich zu nehmen ist und schon gar nicht erbaulich für die Szene, die von diesem Text kritisiert wird und von der es in der editorischen Vorbemerkung heißt, sie sei „die Sphinx, an der alle Bemühungen, etwas Besseres zu beginnen, vorbei müssen, die fatale Erblast der späten 60er Jahre, der große Scherbenhaufen, der eine emanzipative Kollektivität von vornherein verhindert.“
(1) Meist mündlich thematisiert, aber hier auch mal in der weiten Welt der eremitischen Individualbloggerei: http://onlyaabutxxx.tumblr.com/tagged/scherbentheorie