Leon Ackermann
Ultraschall 2018: 100 Jahre Bernd Alois Zimmermann und die unabgeoltenen Forderungen der Tradition am Ende der Postmoderne
Jährlich gibt es in Berlin mit dem Ultrasschall-Festival den Versuch, die musikalische Tradition nicht abreißen zu lassen, indem man einige zeitgenössische Komponisten erklingen läßt, die sonst kaum erklingen dürfen. Dass ist gut, den schließlich steht seit Arnold Schönbergs ersten Experimenten die Entwicklung einer freien Musik an und es kann nur nützen, wenn man der freien Musik eine Bühne schafft. Leon Ackermann hat eine Rezension der diesjährigen Veranstaltung geschrieben, in der er sich der schwierigen Aufgabe stellt, über Musik zu schreiben und zwar plastisch und konkret über einige dort aufgeführte Stücke. Der Text ist zuerst auf Faust Kultur erschienen.
Wer sich vor einem Jahr, als das Ultraschall-Festival 2017 inhaltlich um das Migrationsgeschehen auf der sog. „Balkan-Route“ kreiste, gemeinsam mit dem Autor zu fürchten begann, es folge nun auch das zweite große Berliner Festival für neue Musik der MaerzMusik auf ihrem Weg ins bauchlinke Formel- und Schwafelwesen, der konnte dieses Jahr glücklich seinen Irrtum einsehen.
minusMaerzMusik
Das Schönste an der diesjährigen Ausgabe von Ultraschall war es, in Ruhe gelassen zu werden. Der 20. Jahrgang zeichnete sich am auffälligsten durch das aus, was dort fehlte: es gab kein aufgeklatschtes Motto, keine aufdringlichen Botschaften, keine geschwätzigen Podien, es fehlte die obligatorische Foyerinstallation, die begleitende Ausstellung, usw. usf. – überhaupt wurde auf die Musik flankierende und vermittelnde Maßnahmen, denen immer auch die Unterstellung innewohnt, diese sei auf das Begleitspektakel angewiesen, beinah gänzlich verzichtet. Nicht einmal der naheliegenden Versuchung, den 20. Jahrgang zum Anlass für selbstbespiegelnden Jubiläumszirkus zu nehmen, gab das Festival nach. So ging es – wir leben wohl in Zeiten, in denen das der Rede wert ist – bei diesem Musikfestival tatsächlich um: Musik. Zu danken sein dürfte das dem zurückhaltend-konservativen Selbstverständnis der Leiter Rainer Pöllmann (DLF Kultur) und Andreas Göbel (Kulturadio des RBB), die sich explizit gegen’s allgemeine Kreativitätsgebot verwahrten, und sich ‚bloß‘ als Organisatoren verstanden wissen wollten. Es sei ihnen darum zu tun gewesen, jede statuarische „Mottohaftigkeit“ zu vermeiden, und stattdessen dem Anliegen des Festivals treu zu bleiben, ausgehend von niemand anderem als den Künstler/innen selbst, wesentliche Tendenzen der zeitgenössischen Kunstmusik abzubilden.
Das hatte aber nun weder Gestaltlosigkeit, noch ästhetizistische Weltflucht zur Folge.
Verschiedene rote Fäden ließen sich durch das Programm verfolgen, darunter ein ausgesprochen politischer: Jacques Wildbergers Orchesterstück Canto (1982) zum Beispiel, das den Versuch darstellt, in politischer Vokalmusik entwickelte Verhaltensweisen in die Instrumentalmusik zu überführen, oder Heinz Holligers Violinkonzert (1993-95/2002), das von Bildern des Schweizer Malers Louis Soutter ausgeht, etwa dem düsteren Avant le Massacre, entstanden am katastrophischen Datum des 1. Septembers 1933, ebenso Frederic Rzewskis Coming Together (1971) über einen amerikanischen Gefängnisaufstand und Samir Odeh-Tamims Ja Nári (2003), das in seiner Besetzung für drei Bläser und einen Schlagzeuger so etwas wie einen ästhetisierten Protestmarsch ausprägt. Aber auch auf dieser Linie bildete Ultraschall eine Ausnahme vom tendenziell dauermobilisierenden Kulturbetrieb. Statt sich mit angeblichen „künstlerischen Interventionen in die Gesellschaft“ zu schmücken, statt also auf unvermittelte Wirkung zu zielen, die bei Kunst prinzipiell ausbleiben muss, weil sie erst durch ihren Gegensatz zur unmittelbaren Praxis zu Kunst wird, ließ das Festival sich auch hier von den Forderungen des passivischen Moments aller Kunstrezeption – und besonders der von Musik, die mit dem Ohr auf das der bewussten Verfügung am weitesten Entzogene unserer Sinnesorgane geht – bestimmen: „Es geht nicht um Diskursgebäude, sondern ästhetische Verarbeitung von politischer Erfahrung.“ (Pöllmann) Dass es das konzentrierte Sich-Aussetzen, Sich-Überlassen eher als die alerte Aufmerksamkeit ist, die jene Erschütterung durch ein Kunstwerk erst ermöglicht, die auf ihrem Weg durch die bestimmende Reflexion vom Eindruck zur Erfahrung werden und Eingang in das individuelle Denken und Handeln finden kann, war bereits am ersten Stück des Festivals, auf dem Eröffnungskonzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester unter Heinz Holliger, eindrücklich zu erfahren.
Bernd Alois Zimmermann: Zitieren als Eingedenken
Bernd Alois Zimmermann, dem Ultraschall zum 100. Geburtstag einen Schwerpunkt widmete, komponierte sein Stück Photoptosis für großes Orchester im Jahr 1968, der letzten – bei aller Lächerlichkeit, die Adorno dem Bau von Barrikaden „gegen die, welche die Bombe verwalten“ (Adorno: Marginalien zu Theorie und Praxis, GS 10, S. 772), schon damals attestierte – im Ernst politischen Situation in Westeuropa, in der es zumindest randständiger Praxis um mehr als die komfortablere Integration in die „klassenlose Gesellschaft der Autofahrer, Kinobesucher und Volksgenossen“ (Ders.: Reflexionen zur Klassentheorie, GS 8, S. 377) und deren kulturelles Update ging. Es war neben Wildbergers Canto und Holligers Violinkonzert das einzige Werk des Abends, dem keine politische Intention eingelegt ist, und zugleich das einzige, das eine in sich politische, nämlich geschichtsphilosophische Konstellation ausprägte.
Photoptosis ist eine Klangflächenkomposition, angeregt von den blauen Monochromen Yves Kleins. „Lichteinfall“ bedeutet der griechische Titel, und die visuelle Metapher trifft die klangliche Oberfläche: Eine in fahlem Dunkel schwirrende, hölzerne Fläche wird wie vor einer ‚Leinwand‘ aus leisen, nahezu durchgängig in der Höhe flirrenden Geigen aufgeblendet, und kontinuierlich wechselnden ‚Belichtungen‘ ausgesetzt, so dass der Geigen-Hintergrund je nach Lichteinfall mal mehr, mal weniger unter dem Farbauftrag hindurchschimmert. In kurzen, diffusen Aufwallungen – Assoziation: umrühren – kippt so in der ersten Hälfte ein Klang in den Nächsthelleren, wobei unregelmäßig Blech-Akzente oder, um im Bild zu bleiben, Lichtreflexe über das Tableau blitzen; umso häufiger, je heller Zimmermann die verborgene Lichtquelle dreht.
Auf die im Titel explizite metaphorische Perspektive verengt, ließe sich Photoptosis als „Klangfarbenstudie“ (Programmheft) oder Bravourstück der zweifellosen Meisterschaft Zimmermanns in der Farbdimension hören. Aber so wenig das Sprechen über Musik der visuellen Metaphorik entraten kann, so wenig darf die Übertragung für das genommen werden, worauf übertragen wird. Auch Photoptosis hat nicht auf der Fläche, sondern in der Zeit statt, und so ist nicht der bloße Klang schon die Musik, sondern was im Verlauf mit ihm geschieht. Ist mit Recht von einer Klangfläche die Rede, sei sie in sich noch so bewegt, hat das den bestimmten musikalischen Sinn, ein tendenziell Statisches in der Zeit, einen Zustand zu bezeichnen, im Gegensatz zu der eine Figur umreißende Linie, dem plastischen kompositorischen Ereignis. Letzteres war dem (post)seriellen Komponieren selbst zum Problem geworden. „Zur Krise der Figur“ heißt ein Aufsatz Heinz-Klaus Metzgers von 1965. An dieser Krise, die in gewissem Sinne schon aufzog, als Reaktionäre Anfang des 20. Jahrhunderts begannen, um das „Schwinden der melodiebildenden Kräfte“ zu fürchten, laboriert auch Photoptosis. Nicht fügt es selbstzufrieden Farbwerte aneinander, sondern es ringt dabei mit dem Problem jenes fasslichen, melodischen Oberflächenzusammenhangs, den traditionell motivisch-thematische Arbeit, dann deren Erbin „entwickelnde Variation“ hergestellt hatte.
Die aus dem Farbschleier herausstechenden Impulse vereinzelter Blechbläser sind mehr als bloße Reflexionen, ihnen eignet etwas Ausbrechendes, sie drängen gegen den Schein von Zeitlosigkeit der Flächen auf Verlauf. Die nackte Einzelnheit ihres Tons, setzt sich scharf ab von der tendenziell das gesamte Orchester erfassenden Verschmelzung des Farbflächenprinzips, welches das musikalische Detail nur als fungibles Element im Klangresultat duldet. Wie dumpfe Vertreter von Einzelstimme, Melodie, einem Subjektiven, recken sie den Kopf und drohen vom dynamischen Aufbäumen des Flächenklangs sogleich wieder geschluckt zu werden. Die akkordischen Flächen und ihre wimmelnden Übergänge verschmelzen in dieser Steigerung zu einem Ligeti’schen, in sich bewegten Texturklang, über dem die punktuellen Subjektstümpfe sich zu einer Art Rumpfpolyphonie zusammendrängen – bis die ganze Musik urplötzlich von der „Schreckensfanfare“ aus Beethovens 9. Sinfonie wie verscheucht wird, um einer wahrhaften Traumsequenz Platz zu machen: Fragmente aus Wagners Parsifal-Vorspiel, Beethovens Neunter und Skrjabins Le Poème de l’Extase, schließlich verwischt von einer Schichtung äußerster zeitlicher Dehnungen des Pfingsthymnus Veni creator spiritus, der dabei nur einmal in einer grell verzerrenden Lage der Holzbläser identifizierbare Gestalt annimmt. Diese Zitate-Collage bildet das gleichwohl exterritoriale Kraftzentrum des ganzen Stücks, und ist, im Gegensatz zum postmodernen Herumwerkeln mit den Meistern, als dessen Wegbereiter Zimmermanns Pluralismus gern gehandelt wird, von größter Verbindlichkeit. Durch den historischen Korridor, den sie aufreißt, fällt der Blick auf die unabgegoltenen Ansprüche des in der Dialektik des Fortschritts Zerriebenen: Zitat als Eingedenken. Momente, in denen anhebt, was das Bruchstück einer weit ausschwingenden Wagner’schen Geigenmelodie sein könnte oder der Kopf von Beethovens drängerischem Scherzo-Thema erscheint, lassen augenblicklich die Schwere des Verlustes zu Bewusstsein kommen: der zerstörerische Preis des Fortschritts, ist durch kein ‚einerseits/andererseits‘ der Welt aufzuwiegen. Nur die Verwirklichung jenes wahrhaft menschlichen Zustands, den diese große Musik im Innersten meint, und dem man in Wagners Tagen ganz richtig den Namen Kommunismus gegeben hat, könnte die permanente Katastrophe abbrechen, die der unablässig Trümmer auf Trümmer häufende Fortschritt ist, solange er in Herrschaft verstrickt bleibt.
Verlassen wird diese Traumwirklichkeit nicht so plötzlich, wie sie einbrach. Aus der Schichtkonstruktion des Hymnus zittern nacheinander einzelne Instrumentalgruppen heraus – erst Geigen, bald Flöten, schließlich das Klavier – bevor sie sich nach und nach wieder zur bewegten Fläche zusammenschließen. In Fortsetzung der Steigerungsbewegung der ersten Hälfte schlägt die Farbe dabei endgültig vom Eindruck des genügsamen Lichtspiels in den Ausdruck des Bedrohlichen um. Allmählich versucht das Stück sich aus der Erinnerung ins Eigene zu heben, Kraft aus ihr zu schöpfen für das noch immer im Blech konzentrierte Ringen um feste Fügungen, die sich dem Farbschleier zu entwinden, als Detail mit eigenen Ansprüchen aufzutreten in der Lage wären. Mit bloßen Kraftgesten rennen sie dagegen an, angstverzerrt kreischende Akkorde versuchen den Schleier zu zerreißen, der mittlerweile zu einem alle Register durchziehenden, undurchdringlich dastehenden Tosen aus unzählbaren Einzelbewegungen angewachsen ist. Doch Photoptosis endet verzweifelt. Wo der Bläserchor sich zwischenzeitlich tatsächlich mühsam eine in sich kreisende Figuration erkämpft, verliert gerade diese sich als bloß eine weitere der prinzipiell austauschbaren Bewegungen im diffusen Total des orchestralen Monochroms. Dieses erfüllt die Schlusspassage hindurch wie eine exakte technische Analogie der spätkapitalistischen Gesellschaft triumphierend den Saal: rasanter Stillstand.
Wie einer, der aus Aussichtslosigkeit panisch beginnt, um sich zu schlagen, endet das Stück in stumpfer, manischer Repetition – ohne dass der Druck ihr im Geringsten nachgäbe. Das jedoch nicht resigniert, sondern im Gegenteil: aufwiegelnd. Erfüllt es doch Marx’ Forderung an Kritik, „den wirklichen Druck noch drückender [zu] machen, indem man ihm das Bewußtsein des Drucks hinzufügt, die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert“ (Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1, S. 381).
Barblina Meierhans und Isabel Mundry: Eingedenken heute
Heinz Holliger, der Dirigent des Abends, merkte im Interview nach Photoptosis an, die Zitattechnik, die bei Zimmermann immer den präzisen Sinn habe, „die Zeit anzuhalten oder zu verstören“, sei von folgenden Generationen auf ein Komponieren aus dem „Gemischtwarenladen“ heruntergebracht worden. Was auch immer daran einmal treffend gewesen sein mag, ist dieses floskelhafte Abwatschen musikalischer Postmoderne derweil doch so geläufig geworden, dass der Hinweis gestattet sei, dass diesem ohnehin äußerst unbestimmten Postmoderne-Begriff, der an Komponisten wie dem späten Krysztof „Penderadetzky“ (Lachenmann) gebildet sein mag, heute kaum mehr etwas entspricht. An einer ausgehend von Zimmermann mehr unterirdisch durch das Programm von Ultraschall verfolgbaren Linie lässt sich aufzeigen, wie die innermusikalische Auseinandersetzung mit traditioneller Musik keineswegs in geschichtsvergessene Werkelei oder gleich offene Restauration münden muss.
Das Konzert des Hamburger Trio Catch, einer klassischen Klarinettentrioformation, im Neuköllner Heimathafen am 19.01. war um die Konfrontation von (Bass-)Klarinette und Bassetthorn gruppiert. Der Tenor-Vertreter der Klarinettenfamilie war im späten 18. Jahrhundert beliebt – prominent etwa bei Sarastros erhabenem Auftritt in Mozarts Zauberflöte – und ist seitdem weitgehend in Vergessenheit geraten. Isabel Mundry, deren Sounds-Archeologies bei dem Konzert zur Uraufführung kam, begründete das neuerliche Interesse an dem Instrument plausibel mit einer „Wiederentdeckung der Mittellage“, nachdem die Avantgarde sich, auch was das Register betrifft, der Erkundung der Extreme verschrieben hatte. In den historischen Umkreis, den das Bassetthorn aufruft, fällt auch der Vorwurf von Barblina Meierhans’ 10-minütigem In Serie 11 (2015/17): Das Stück ging aus der Beschäftigung mit Beethovens Klarinettentrio op. 11 von 1797 hervor, wobei die Komponistin darauf besteht, die Wahl der Besetzung sei keineswegs „mozartinisch-nostalgisch“ zu verstehen. Und tatsächlich erinnert nichts in ihrem Stück an die klassizistisch quäkende Sprödheit, die die ‚mischträge‘ Klarinette ins Klaviertrio bringt. Trotz des anschmiegsameren Bassetthorns wird die Komposition aber nicht zum ‚Ohrenschmaus‘. Sie entfaltet eine kammermusikalische ‚Abstraktheit‘ im besten Sinne. Mit einer „gewissen Ignoranz bezüglich der harmonischen Struktur des vielgespielten Werkes“, wie die Komponistin zugibt, reißt sie die drei chromatisch aufsteigenden Unisono-Töne an sich, mit denen das Beethoven-Trio beginnt, und schafft daraus eine Reihung mehr nebeneinander gestellter als auseinander hervorgehender Klangstrukturen, wie es die Serie im Titel anzeigen mag. Es ist dieses Desinteresse für die Werkstruktur, die Fetischisierung eines willkürlichen Details, die In Serie 11 von historistischer Bastelei absetzt. Außerhalb seines harmonischen Kontexts ist Beethovens chromatischer Aufstieg so entqualifiziert, dass kaum etwas in dem ohnehin mehr auf geräuschhafte Gesten und Klangfelder als einzelne Tonverläufe setzenden Stück seine Herkunft verrät. In das fremdartig-düstere Brodeln, das es als Gesamteindruck hinterlässt, mag der geschichtliche Rückgriff auf mannigfaltige Weise technisch eingegangen sein, im Resultat entsteht ganz und gar Eigenständiges – und das nicht nur dem Rechtstitel ‚selbst gemacht‘ nach, den auch jede collagierte Einfallslosigkeit trägt, sondern als ernsthafter Versuch, in einer historischen Lage unüberblickbarer Kontingenz an verbindlicher ästhetischer Gestaltung festzuhalten, also mehr zu wollen als bloß noch ein ‚Anything‘ zu produzieren, das keine anderen Ansprüche erfüllt als eben zu ‚gehen‘. Glaubt man der Komponistin, wenn sie schreibt In Serie 11 sei „ein Versuch den Filter meines subjektiven Hörens der historischen Klangmonumente in allen Kleinstpartikeln hörbar zu machen“, (Programmheft) ist es ihr sehr glücklich gelungen, die persönliche Idiosynkrasie zu objektivieren. Wo es ohnehin keine außerhalb des einzelnen Werks liegenden Sicherheiten mehr gibt, auf die Komposition sich stützen könnte, liegt einige Wahrheit in solchem Verfahren: dass nämlich die Frage nach musikalischem Ge- oder Misslingen heute selbst einen weithin idiosynkratischen Charakter angenommen hat, insofern sich auf keine höhere Instanz als die ästhetischen Nerven mehr berufen werden kann, seit alle Versuche, in Tradition Schönbergs auf die Problemstellung radikaler Individuation eine dennoch überindividuelle Antwort zu geben, historisch geworden sind.
Auf einer ähnlichen Linie bewegte sich das im selben Konzert uraufgeführte Sounds-Archeologies von Isabel Mundry. Es arbeitet nicht mit konkreten historischen Materialien, ist aber, wie der Titel deutlich macht, ebenfalls rückblickend ausgerichtet, das nur mit höherem Abstraktionsgrad. Der ‚archäologische‘ Zugang betrifft einmal die archaische Mittellage des Bassetthorns, der das ganze Stück in einer grundsätzlichen Zartheit des Tons, auch in den schrofferen Klängen, folgt. Weiters sei es mit „ganz basalen Phänomenen der Musik“ befasst, wie Mundry sagt. Das aber nicht im Sinne der Chimäre einer Ontologie ursprünglicher Elemente ‚der Musik‘, sondern mit dem Bewusstsein, dass es sich dabei um in der Gegenwart vorgenommene Abstraktionen von historisch konkreten Idiomen handelt.
Auf möglichst allgemeine Formulierungen gebrachte Klangphänomene und Konstellationen, wie Ton-Repetition, Responsorium, gezupfte/gestrichene Saite, oder Momente „früher Musikpraxis wie Hoquetus und Polyphonie, Aspekte der Tonalität, Melodik, Virtuosität“ (Mundry) werden in dem Stück auf ihre Beredtheit untersucht: „Ist es fern? Oder steht es doch in einer Kontinuität des kulturellen Gedächtnisses? Oder ist es einfach nah, weil es eine eigene Qualität hat, die zu mir spricht?“ Und diese „eigene Qualität“ der Klänge durch die historischen Ablagerungen hindurch leuchten zu lassen gelingt Mundry außerordentlich. Strategisch ganz anders vorgehend und geschichtsphilosophisch eher melancholisch denn avantgardistisch gerichtet, resoniert in diesem Anliegen, die Klänge – und damit die Ohren – ihrer zweiten Natur zu entkleiden, aus der Ferne etwas von Lachenmanns musique concrète instrumentale. Etwa wenn sie nicht in die leere Zeit gesetzt sind, sondern diese von ihrer „natürlichen“ Beschaffenheit bestimmt wird; wenn der Ton so lang ist wie der Arm den Bogen streichen kann, oder der eigene Ausklang des einen Impulses entscheidet, wann der nächste ansetzt; wenn der Staccato-Akzent im Bassetthorn die offene Klaviersaite schwingen lässt oder Gesten des anschwellenden Durchbruchs die instrumentenspezifisch zu überwindenden physischen Widerstände hörbar machen – in solchen Momente fördert die Archäologie magische Artefakte zu Tage, in denen die Töne mehr sind als bloß sie selbst; ein rätselhafter Überschuss, in dem wie heute nur selten das utopische Wesen der Kunst aufschimmert. Und damit berührt Mundry dann doch das Eine, das wohl am ehesten als Urphänomen der Musik angesprochen werden könnte, wenn ein solches denn gäbe: „Musik ist das Angerührtwerden, die Erfahrung dessen was anders ist unmittelbar, der Schauer als ein zugleich innerweltliches Phänomen, Mana als Empirisches. Darin steckt ihre ganze Dialektik“ (Adorno: Graeculus, Frankfurter Adorno-Blätter VII, S. 35).
Brigitta Muntendorf: Kunst und Kulturindustrie, oder: was heißt musikalische Postmoderne?
Ganz anders, greller und hoffnungsloser, traten in diese Konstellation Brigitta Muntendorfs Werke für Pianoduo, Key of Presence (2014/15) und Key of Absence (2017) ein. Die beiden viertelstündigen Stücke, die das herausragende GrauSchumacher Pianoduo am 18.01. in einem Programm mit Zimmermanns frühen, seriellen Perspektiven (1955/56) und der späteren pluralistischen Komposition Monologe (1960-64) aufführte, bilden die zwei bisher fertiggestellten Teile einer Trilogie, die sich mit „dem Aspekt der Zeitlichkeit und Vergänglichkeit in der medialen Welt von heute“ (Programmheft) beschäftigen soll. Eine Theoretikerin ist Muntendorf nicht. Versatzstücke von Pennäler-Philosophie legt Key of Absence den Pianisten in den Mund: „Ich wünschte, dass es klang, wie es schon nicht mehr klingt“, „Ich werde meinen Tod nicht erleben“, „Ich kann mich an meine Geburt nicht erinnern“, derlei. Aber es sind selten die Philosophen, die in der Praxis etwas zu Wege bringen, und selten nur stimmt das Bewusstsein der Praktiker mit ihrer Praxis überein.
„Abscheulicher! Wo eilst du hin?“ beginnt Key of Absence mit einem Fidelio-Zitat vom Band. Im Verlauf begegnen wir Klängen aus Schuberts Unvollendeter, Hugo Wolfs Mignon, ebenso Sofia Coppolas Film Lost in Translation. Der erste Teil, Key of Presence, arbeitet nicht mit der Tradition, aber eingesprochenen Gedichtzeilen, zugespielten Soundscapes, und gelegentlichen Pop-Schnipseln.
Die Zitate und Anleihen von der strengen Sphäre neuer Musik Äußerlichem sind nicht mehr wie bei Zimmermann vergegenwärtigende, lebendige Erinnerung, sondern verdinglichte Samples. Film, Unterhaltungsmusik und Kunsttradition gehen durcheinander, sind gleichermaßen verfügbar und werden analog behandelt.
Es mag das der „Gemischtwarenladen“ sein, den Holliger meinte, aber der sagt mehr über die schwindende Objektivität des Kanons als die individuelle Leistung der Komponisten.
Der Schwund ist seinerseits objektiv, und entscheidend ist, ob Musik sich der Situation stellt, oder sich vor ihr auf bloß behauptete Allgemeinheiten zurückzieht, die heute restlos außer Geltung gesetzt sind. Und präziser als die geläufige Bestimmung von Postmoderne als irgendwie vaguement = „Eklektizismus + historische Materialien“ bezeichnet dieses letztere Moment das Wesen der schon recht alten postmodernen Situation, die man in metaphysischer Sprache eine nominalistische nennen könnte. Nach dem seriellen Kollaps der Idee der integralen, alle Parameter stimmig organisierenden Komposition, die im Rückblick als Fluchtpunkt des gesamten historischen Prozesses musikalischer Rationalisierung gelten kann, hatte sich der ästhetische Nominalismus endgültig verabsolutiert. „Anything goes“, also die Abwesenheit eines objektiven Stands des Materials, wurde paradox zum objektiven Stand des Materials und ist es bis heute. (Treffsicher hat sich in der Musikwissenschaft für diese Implosion des Materials während der 60er das Etikett „Materialexplosion“ eingebürgert.) In dieser Allgemeinheit begriffen, zeigt sich das Schalten und Walten mit historischer Musik nur als die andere Seite der quantitativen Erschließung aller möglichen neuen Klangphänomene, als ein Sonderfall davon, dass schlichtweg alles potentiell zum musikalischen Gegenstand werden kann, sei’s eine Säge im Flügelkorpus, sei’s ein inhaltliches Konzept. In dieselbe geschichtliche Bewegung fällt die vielbesungene Auflösung der Grenze zwischen U und E, die bloß der theoretische Nachvollzug der Nivellierung von Kunst- und Massenmusik zur unbestimmten Kulturware war, die die Kulturindustrie längst praktisch ins Werk gesetzt hatte, ganz gleich, ob man darin nun den kommenden Untergang oder die kommende Befreiung zu sehen geneigt war. Die negativistische Konsequenz, die Helmut Lachenmann damals daraus zog, dass nur der nicht gemeinsame Sache mit dem „ästhetischen Apparat“ mache, der materialiter gegen ihn komponiert, scheint dem Autor noch immer die einleuchtendste theoretische Position zu sein, während ihm in der künstlerischen Praxis inkonsequenterweise immer wieder Werke begegnen, die von all dem nichts wissen, und trotzdem gelingen.
In diese Inkonsequenz grätschen die Klavierduos Muntendorfs. Beide, besonders das sehr gelungene Key of Presence, halten sich in der Schwebe zwischen identifikatorischem Nachmachen und Brecht’schem Vorführen kulturindustrieller Verhaltensweisen. Brechts Typus des ‚rauchenden Zuschauers‘, der das Bühnengeschehen distanziert beurteilend statt zustimmend verfolgt, könnte daran jedenfalls des Apokalyptischen einer historischen Situation innewerden, in der Fidelio und die Unvollendete neben dem Kulturschrott selbst zu solchem geworden sind.
Im zweiten Teil von Muntendorfs Trilogie, Key of Absence, ist es in dieser Perspektive gerade das pseudophilosophische Geschwafel und die absurden Unterhaltungsstückchen, die die Pianisten sich zuwerfen – „Andreas, schneller!“, „Götz, schneller!“, „Gut, Götz. Gut, dass wir schon mal hier waren“ – während sie atemberaubende pianistische Leistungen meistern, die das Ganze in eine fast Beckett’sche Schwärze tauchen – wie wenn der angeleinte Sklave Lucky in Warten auf Godot auf’s Kommando „Think!“ einen sinnlosen Monolog aus philosophischem Phrasenkleingeld zur höheren Unterhaltung seines Herrn zusammenstammelt und darin die ganze Katastrophe eines an den verselbständigten Weltlauf nicht mehr heranreichenden Geistes aufscheint.
Simon Steen-Andersen: Das Ende der Postmoderne
Vollends auf die Seite dieses Weltlaufs geschlagen hat sich Simon Steen-Andersens Piano Concerto, am 21.01. vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Enno Poppe im Pierre-Boulez-Saal aufgeführt. Die Grundkonstellation: Ein Orchester, darüber eine Leinwand, davor ein Solopianist. Die Leinwand zeigt eine Fabrikhalle, in der in Zeitlupe ein Flügel von der Decke stürzt und am Boden zerbirst, was das Orchester mit einem hauchigen Luftklang von bedrohlicher Leere begleitet. Traurig demoliert steht der Flügel am Ende dieser Exposition auf der Leinwand.
Spätestens seit der spektakulären Interpretation von Philip Corners Piano Activities auf den als Geburtsstunde des Fluxus gehandelten „Fluxus Internationalen Festspielen Neuester Musik“ in Wiesbaden 1962 ist die Flügelzerstörung eine Ikone der neuen Musik. Der große Konzertflügel als das bürgerliche Instrument par excellence, assoziiert wie kein anderes – außer vielleicht der Violine – die Gesamtheit der Ansprüche der abendländischen Musiktradition. Dieser Tradition eins vor den Bug knallen zu wollen, weil sie sich die längste Zeit über zu Zwecken der Herrschaft und ihrer ideologischen Legitimation hergegeben hat, ist ein Motiv, das sich noch in jeder Avantgarde-Bewegung fand, und sicher nicht das Schlechteste.
Ein halbes Jahrhundert später wäre es vielleicht etwas einfallslos und überdies zwecklos, so auf eine ohnehin am Boden liegende Tradition einzutreten, aber wer kann schon kategorisch sagen, ob es da nicht noch den einen oder anderen unwahrscheinlichen Funken zu schlagen gäbe? Doch Steen-Andersen ist zu abgeklärt, um auf so etwas altfränkisch Negatives wie Provokation aus zu sein. Er ist, wie man das heute zu sein hat, konstruktiv. Der Flügelsturz sei kein Flügelsturz, sondern bloß eine „Studie über energetische Prozesse“; die Zerstörung keine „symbolische Dekonstruktion abendländisch-bürgerlicher Musiktradition“ wie das vor-den-Bug-Knallen in heutiger Programmheftsprache heißt, sondern eine „von der Schwerkraft entschiedene Präparation des Klaviers“ (Programmheft).
Der Solist (Nicolas Hodges, mit dem Steen-Andersen auch die Videoaufnahmen für sein Piano Concerto produziert hat) beginnt mit im 7/4-Puls fallenden Arpeggien über einen weiten Akkord, die immer schneller werden, sich schließlich invertiert den Streichern mitteilen und von dort variiert im ganzen Orchester ausbreiten, den Viertelrhythmus verschiedentlich überlagert festhaltend, so dass ein dissoziiert pulsierendes Staccato-Feld in ungedeckten, blendenden Farben entsteht. An den Solo-Flügel ist eine Stellwand mit den Umrissen des zerstörten Exemplars gelehnt, auf die das Bild desselben passgenau projiziert wird. Per zusätzlichem Keyboard steuert der Solist Klangsamples des ‚präparierten‘ Flügels, verknüpft mit der jeweils entsprechenden Videoaufnahme seiner selbst. Durch die Abgehacktheit der Videoschnipsel, die Hodges mit jeder Taste ansteuert, teilt sich so auch dem Video-Leib des Pianisten etwas von der Zerstörung seines Instruments mit. Wer diesem Geschehen nicht völlig desinteressiert beiwohnt, also Steen-Andersen den kühl-distanzierten Studien-Gestus nicht unkritisch abkauft, sondern der „eigenen Qualität“ dieser Bilder und Klänge nachspürt, der hat eine Szene der Selbstverstümmelung vor sich. Der Klang des Instruments, übersät mit verstummten und zersplitterten Tasten, ist ein jämmerlich verstimmtes Krächzen, Laute eines misshandelten, in letzter Konsequenz: kastrierten Flügels. Dass die tiefste Motivation des Stücks – die wohlgemerkt nie identisch mit der des Komponisten ist – eine infantil-sadistische ist, offenbart sich im Fortgang deutlich. Das bis hier exponierte Material wird nach Art einer konzertmäßigen zweiten Exposition vom zerbrochenen Flügel wiederholt, wieder vom Orchester aufgenommen, das „quasi eine Instrumentation dieser zerbrochenen Klänge“ (Steen-Andersen) spielt und ihnen dadurch tatsächlich einigen klanglichen Reiz entlockt, sie durch Interpretation verzärtelt. In einer Durchführung treten die beiden Flügel und das Orchester spielerisch in verschiedene Konstellationen, die beiden Solo-Instrumente erscheinen zunehmend als Avatare eines einzigen „Superinstruments“ (ders.), die Arpeggien verdichten sich zu reißenden Orchester-Glissandi die auf Publikum und Solist herniederfahren und schließlich in eine veritable Solo-Kadenz münden. Der aufdringlichste Widerspruch des Piano Concerto ist der von einem verstümmelten, zerstörtem Material bei gleichzeitiger absoluter Perfektion der Behandlung, lückenlose Glätte der Oberfläche, die Festivalleiter Rainer Pöllmann als Kraft künstlerischer Formung anpreist: „Nichts ist aufgesetzt, nichts bloß additiv, immer fügen sich Klang und Szene zu einem integrierten musikalischen Ereignis zusammen.“ (Programmheft) Und es stimmt: alles im Piano Concerto stimmt. Ästhetische Form gelingt aber nur, wenn auch etwas nicht stimmt. „Immanent ist noch der Stimmigkeit, daß sie nicht ihr Ein und Alles sei; das scheidet ihren emphatischen Begriff vom akademischen. Was nur und durchaus stimmt, stimmt nicht.“ (Adorno: Ästhetische Theorie GS 7, S. 281) Die absolute Identität der Oberfläche gehört vielmehr ins Repertoire jener „hohnlachende[n] Erfüllung des Wagnerschen Traums vom Gesamtkunstwerk“, die die Kulturindustrie besorgt: „Die Übereinstimmung von Wort, Bild und Musik gelingt um so viel perfekter als im Tristan, weil die sinnlichen Elemente, die einspruchslos allesamt die Oberfläche der gesellschaftlichen Realität protokollieren, dem Prinzip nach im gleichen technischen Arbeitsgang produziert werden und dessen Einheit als ihren eigentlichen Gehalt ausdrücken.“ (Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, GS 3, S. 145)
Die Einheit des Arbeitsgangs ist hier die der Zerstörungsarbeit am Flügel, der das gesamte Material des Stücks entspringt, deren destruktiver Charakter, die sich notwendig in den mimetischen Qualitäten des Materials niederschlägt, aber in der Perfektion der Verarbeitung untergeht, was die stoffliche Misshandlung ästhetisch wiederholt Nur ein einziger, kurzer Moment im Piano Concerto stemmt sich gegen die souveräne Verfügungsgewalt des Musikregisseurs: Die Solo-Kadenz beginnt mit einer Videosequenz des Pianisten, diesmal nicht zerhackt auf der ihm angewiesenen Stellplatte, sondern kontinuierlich auf der großen Leinwand. Er spielt Beethovens A-Dur-Sonate op. 101 (für diesen Hinweis danke ich Jonas Reichert), deren erster Satz in seiner verschwommenen formalen Anlage und dominantisch in der Schwebe gehaltenen Harmonik eine unvergleichliche Friedlichkeit verströmt. Auf dem misshandelten Instrument wird daraus ein Schmerzenswimmern. Nur an der Figuration erkennbar, tauchen melodische Fetzen in völliger Verzerrung auf und verstummen wieder zu leisem Tastenklopfen, sporadisch schwingt ein tonaler Akkord von zufällig einigermaßen in Stimmung gebliebenen Saiten. Nicht wie ein sauberes Skelett, sondern wie ein zerfetzter Leib steht der Satz im Raum und schaut mit hoffnungslosen Blick um sich. Es ist das der einzig expressive Moment des Stücks, der einzige, in dem das Opfer des hämischen Rituals selbst eine Stimme bekommt – der Fortgang der Kadenz ersäuft ihn sogleich in einem – so steht es tatsächlich im Programmheft – „heitere[n] Melodienraten […] von Beethoven bis Tschaikowsky“. Das Zitat übernimmt hier die Rolle der „Räuber am Weg, die bewaffnet hervorbrechen und dem Müßiggänger die Überzeugung nehmen“, als die Walter Benjamin es für seine Arbeit bestimmt; nur dass der Räuber, der Waffen bar, nichts hat als seine ausgestellte Jämmerlichkeit, um dem Müßiggänger seine Überzeugung im Hals stecken bleiben zu lassen. Dem Müßiggänger aber, für den das humorige Stück tatsächlich geschrieben ist, kann das nichts anhaben: das vom ersten Teil auf die eben humorige, also mitleidslose Haltung konditionierte Publikum beginnt zu Kichern. Mit der durchaus raffinierten Zitatcollage in seiner Mitte hat das Piano Concerto jede eventuelle Sensibilität für die Ansprüche der musikalischen Tradition – die hier ins Spiel kommen, ob man das will oder nicht – betäubt und wähnt sich befreit von ihrer Autorität. Ab dann kippt es ungebremst in bösartigen Slapstick, dessen Wesen schon im Stummfilm-Original die Verhöhnung der Ausführenden ist. Die Sturzsequenz auf der Leinwand wird nun zur Hauptsache. Die Superzeitlupe ermöglicht absolute Manipulierbarkeit des Filmmaterials: Wieder und wieder, schneller und schneller wird der Flügel auf den Boden geschleudert und erneut hochgezogen, wobei die Musik endgültig aufs Micky-Mousing regrediert. Wenn der Flügel beginnt, auf der Stelle zu hüpfen wie ein qualvoll auf’s Plié dressiertes Nilpferd, dem bei jeder Kniebeuge die Knochen splittern, kommt Steen-Andersens Piano Concerto als brutales Ballett zu sich selbst. Es ist das halbstündige Ausagieren einer infantilen Allmachtsphantasie: mit dem Konzertflügel die ganze ehemalige Autorität der traditionellen Musik und ihre schier unerfüllbaren Forderungen zwischen den Fingern zu halten und sie für sich zappeln zu lassen, wie ein Kleinkind die Fliege, der es mit sadistischem Spaß die Flügelchen ausreißt.
Es stellt damit gewissermaßen die Antithese zu Zimmermanns Photoptosis dar. Die Erfahrung gesellschaftlicher Ohnmacht und der Verstelltheit richtiger Praxis im Spätkapitalismus kam darin in Kontrast zu Gelingendem aus der Tradition, als Trauer um den Verlust des einmal möglich Gewesenen zur Sprache. In den Zitaten der Altvorderen kam auch das eigene gegenwärtige Unvermögen zum Vorschein. Die Rückwendung war motiviert durch die Hoffnung, etwas vom utopischen Überschuss des Vergangenen in der Jetztzeit aufschließen zu können. Steen-Andersens Piano Concerto dagegen feiert ein Ritual der Abhärtung gegen dieses Bewusstsein der Ohnmacht, das die notwendige Voraussetzung jeder zukünftigen Praxis wäre. Die unermessliche narzißtische Kränkung, die ihr Eingeständnis bedeutet, muss mit allen Mitteln abgewehrt werden; und Ideologiebildung besteht in der Postmoderne zum großen Teil in dieser Anstrengung, den Schein vom Vorrang des Subjekts aufrechtzuerhalten: sich wider alle Evidenz zum souveränen Herrn der Welt umzulügen. Ob durch diskursphilosophische Spielarten der magischen Vorstellung, die Welt sei durch Sprache produziert, ob durch queertheoretische Versuche, die natürlichen Grenzen menschlicher Naturbeherrschung zu performativen Akten zu verharmlosen: Nichts, was der selbstherrlichen Subjektivität fremd entgegensteht, nicht die Autorität einer Sache, nicht das Eingedenken der Natur im Subjekt, zuallerletzt die zwingende Allgemeinheit der Vernunft, darf dem bornierten Sozialatom die Illusion zerstören, die Lizenz zur Selbstverwaltung seiner Anpassungsleistungen an die unerbittliche Objektivität der kapitalistischen Gesellschaft sei schon die Freiheit.
Die Tradition bürgerlicher Kunst, die ein so unerreichbar gewordenes Kriterium wie ästhetische Wahrheit mit dem ungeschmälerten Anspruch des philosophischen Begriffs zum Maßstab erhebt, wird in dieser Situation zum Objekt der Aggression. Was an ihr über die traumlose Gegenwart hinausweist, was in der Tat besser ist, als wir es sind, verführt zum Draufschlagen, weil es die Verächtlichkeit der eigenen Lage ins Bewußtsein drängt. Steen-Andersens Stück tanzt das Ende der Postmoderne vor und steht dabei schon mit einem Bein in der heraufziehenden kulturellen Konstellation für die der marxistische Kulturwissenschaftler Mark Fisher die glückliche Formulierung ‚kapitalistischer Realismus‘ geprägt hat: „it’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism“ (Mark Fisher: Capitalist realism: is there no alternative?, S. 1).
Leon Ackermann
Quellen:
– Karl Marx: Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Marx-Engels-Werke Bd. 1, Berlin 1956.
– Mark Fisher: Capitalist realism: is there no alternative?, Winchester 2009.
– Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Gesammelte Schriften Bd. 7, Frankfurt a. M. 1970.
– Ders.: Reflexionen zur Klassentheorie, GS 8, Frankfurt a. M. 1972.
– Ders.: Marginalien zu Theorie und Praxis, GS 10, Frankfurt a. M. 1977.
– Ders.: Graeculus (I). Musikalische Notizen, in: Frankfurter Adorno-Blätter Bd. 7, Frankfurt a. M. 2001.
– Theodor W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, GS 3, Frankfurt a. M. 1969.
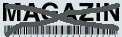
 Text als PDF
Text als PDF