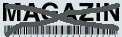Lilly Lent und Franza Ranner
Das zweifelhafte Glück von Liebe und Familie
1. Das Paar
Selbstverständlich hätte auch ich gerne eine Hausfrau. Ich bin zwar selbst weiblich sozialisiert und daher bewandert in sämtlichen haushälterischen Tätigkeiten, kann Socken stopfen und staubsaugen. Ich bin der Lage, mir Probleme anderer Leute anzuhören und gelegentlich auch, über meine eigenen Gefühle zu reflektieren – trotzdem. Seitdem ich arbeite, viel arbeite und angestrengt arbeite, wünsche ich mir, dass warmes, leckeres Essen auf dem Tisch steht, wenn ich abends nach Hause komme. Der Kühlschrank gefüllt, das Klopapier gekauft, die Küche gefegt. Ich möchte mich nicht darum kümmern; ich bin müde und habe anderes im Kopf. Ich hätte gerne, dass sich jemand meine langwierigen und sehr speziellen Arbeitsgeschichten anhört und bringe es kaum fertig, anderen Leuten länger als drei Minuten zuzuhören, ich bin ja selbst schon fertig.
Die Metamorphose von einem jahrelang zur Weiblichkeit zugerichtetem Wesen in einen Typen, der in seinen Wünschen zunehmend einem altmodischen Ehegatten ähnelt, ist unangenehm. Wie kommt man nur zu solchen plumpen Bedürfnissen und warum sind sie so hartnäckig?
Vielleicht deshalb:
Dem Privatleben wird aufgehalst, was der Arbeitstag zurücklässt. Ist man müde, möchte man nicht noch einkaufen. Hat man keine Zeit, macht Kochen keinen Spaß. Hat man am Tag viel gesprochen, möchte man danach die Klappe halten; war man hauptsächlich mit seinem Computer beschäftigt, möchte man abends vielleicht mal einen Witz erzählen. Wann man ins Bett geht, bestimmt der Wecker. Je anstrengender der Arbeitstag, umso vorhersehbarer das Privatleben. Es ist dabei offensichtlich, dass alle diese jeweiligen Ess-, Schlaf- und Sprechwünsche nicht nur der Befriedigung rein „natürlicher“ Bedürfnisse dienen. Gegenstand aller Bemühungen, die Arbeitskraft für den nächsten Tag wieder herzustellen, ist nicht lediglich ein natürlicher Körper mit all seinen Versorgungsansprüchen, sondern immer das, was der Arbeitstag an körperlichen Bedürfnissen zurücklässt und prägt. „Natürlich“ scheinen mir meine Feierabendwünsche zu sein, da sie je dringlich sind und deren stete Missachtung krank und unglücklich macht. Und dabei geht es um viel mehr, als ums Essen und Schlafen:
Die Beharrlichkeit, mit der man daran festhält, auf der Arbeitsstelle unersetzlich zu sein, speist sich durch das halbbewusste Wissen, selbstverständlich jederzeit austauschbar zu sein und die Angst, damit seine Existenzgrundlage weitgehend zu verlieren. Die Versicherung, ganz tolle Kolleginnen zu haben, tröstet nur schlecht über die Erfahrung hinweg, dass Zweckbündnisse eingegangen werden, die nicht mit individueller Achtung oder gar Zuneigung zu verwechseln sind und die bei der ersten Krise in offene Konkurrenz umschlagen können. Seinen Job spannend zu finden übertüncht nur grob den Eindruck, sehr einseitig ausgelaugt zu sein. Findet man, entgegen aller Arbeitsideologie, seinen Job, Beruf, seine Arbeit ohnehin langweilig, seine Kolleginnen unerträglich und ist sich der vollständigen Ersetzbarkeit jederzeit bewusst, macht das in der Regel auch nicht zu einem glücklicheren Menschen.
Was kann einer über den Alltag helfen? Hasi!
Was von Hasi erwartet wird, ist größtenteils eine Kompensation der Zumutungen des Arbeitslebens: keine Austauschbarkeit, sondern Stabilität und Anerkennung der eigenen Einzigartigkeit. Keine zweckrationalen Handlungen, kein Verfolgen eigener Interessen, sondern Gemeinsamkeit und Liebe. Die Entfaltung meiner eigenen Persönlichkeit mit all ihren Interessen, Fähigkeiten und Wünschen. Nun ja: Schwierigkeiten sind vorhersehbar. Der Partner oder die Partnerin muss wahrscheinlich auch arbeiten, ist erschöpft wie man selbst und hat vermutlich ähnliche, widersprüchliche Wünsche, nach Fürsorge und Aufregung, wie man selbst.
In dieser permanenten Notlage ist es möglich auf Tradition zu setzen: Die Konflikte werden stillgestellt durch die Zuweisung traditioneller Zuständigkeiten. Sie kocht und hört zu, er arbeitet und erzählt davon. Man kann die Rollen tauschen, nicht-hetero Paare können sich das Modell zu eigen machen – das alles macht es nicht vielseitiger. Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf permanente Verhandlung der Bedürfnissen zu setzen. Das hat den Nachteil, dass die wegen ihrer Liebe und Unmittelbarkeit geschätzte Intimbeziehung zunehmend dem Arbeitsalltag ähnelt. Hie und dort, in der Liebe und im Büro, haben die meisten den Eindruck, selbst immer irgendwie zu kurz zu kommen – was vermutlich, genauso irgendwie, immer stimmt. Wirft man sich also bei der Arbeit vor, nicht genug die eigenen Interessen durchzusetzen, steht man im Privaten beim Verhandlungsmodell vor der Aufgabe, seine Bedürfnisse stets aufs Neue eindeutig zu artikulieren, um ihnen Geltung verschaffen zu können. Da Bedürfnisse wie Gefühle häufig nicht so eindeutig sind, ist deren Verhandlung eine zähe Angelegenheit.
Ein bisschen komplizierter wird es noch, wenn Kinder da sind. Auch nachdem die Unterbrechung der Arbeit durch die Schwangerschaft und Elternzeit vorbei ist, funktionieren Kinder häufig nicht nach dem vorgegebenen Arbeitstakt. Bei der Tagesmutter sind sie vielleicht unglücklich, in der Kita werden sie häufig krank. Eine Kinderfrau kann sich kaum wer leisten. Wer bleibt zu Hause, arbeitet Teilzeit oder riskiert, in der Erkältungsperiode in seinem Büro nur auf Abruf zu sitzen? Sie mit ihrem Doktor in Kunstgeschichte oder er mit seinem gut bezahlten Informatikjob? Alles kann jedoch ausgehandelt werden und muss nicht traditionell, gemäß der üblichen Deutung der Geschlechtlichkeit, entschieden werden. Leider hat man auch dann nicht das große Los gezogen, wenn man der Teil des Paares ist, der oder die viel arbeitet. Die Kinder kennen einen kaum und man selbst entwickelt Macken der Männlichkeit, die man vorher nicht mal seinem Großvater zugetraut hätte. Alleine in der Küche zu werkeln und die Wäscheberge zu waschen macht nach einem Jahr auch kaum eine mehr zufrieden. Was man jeweils – egal in welcher Rolle: zuhause, immer arbeitend oder beides alternierend – ständig gehetzt an seinem Leben vermissen mag, bekommen dann die Kinder zu spüren.
Wo kommen sie überhaupt her, diese ganzen reizenden kleinen Kinder, die meinen Bekanntenkreis vergrößern, deren Eltern ich aber in Freundeskreisen, beim Tanzengehen und in der politischen Diskussion vermisse? So viel ist immerhin klar: Einfach „da“ sind sie nun doch nicht:
2. Kinderwunsch
Irgendwann Anfang der 90er in unserer feministischen Gruppe eines autonomen Zentrums irgendwo in Westdeutschland kam es – wir waren alle so zwischen Anfang und Ende Zwanzig – zu der Frage, welche von uns denn später Kinder haben würde. Keine konnte sich das damals vorstellen. Wir wollten etwas anderes: Aktuell organisierten wir Frauen-Lesben-Partys und gingen gegen Sexismus und sexuelle Gewalt auf die Straße, aber das waren ja auch nur erste Schritte hin zu etwas vollkommen anderem. Dringend wollten wir nicht nur das Patriarchat abschaffen, sondern auch das Eigentum. Die kapitalistische Produktionsweise sollte durch die Selbstverwaltung der Betriebe und durch die Bildung von Kommunen ersetzt werden – wir waren schließlich Anarchafeministinnen. Kinderkriegen passte da nicht rein. Höchstens wenn die Kindererziehung in Form des Kollektiv organisiert war und nicht in der Kleinfamilie. Ansonsten war das Kinderkriegen viel zu eng verbunden mit der Reihenhauspießigkeit Westdeutschlands in den 70er und 80er Jahren, wo die meisten Mütter Hausfrauen und die Väter zumindest für uns Kinder nur am Wochenende anwesend waren, denn sonst machten sie irgendwas Dubioses an Orten, zu denen wir nur im Sonderfall Zutritt hatten.
Wie ist es denn gekommen? Mittlerweile haben eigentlich alle außer mir Kinder. Bis auf eine haben alle den klassischen Kleinfamilienweg gewählt. Die eine hat das Kind mehr oder weniger kollektiv großgezogen. Sie wohnte gemeinsam mit einer Freundin, die auch ein Kind hatte. Die jeweiligen Väter, die sich die Hälfte der Zeit um ihr jeweiliges Kind kümmerten, wohnten woanders. Irgendwann sind alle zusammen in ein Haus gezogen. Alle anderen Frauen haben das Kleinfamilienmodell gewählt – mal mit viel Verhandlung, also viel Streit um Gleichberechtigung, mal hat die Frau ohne viel zu murren, aber mit Dauerfrustration, Haushalt und Kindererziehung auf sich genommen. Und ja, es stimmt: hier waren die Männer wirklich als Informatiker oder Ärzte die Hauptverdiener, während die Frauen als Studentin der Grundschulpädagogik oder Logopädin, wenn überhaupt, nur einen Nebenverdienst einbrachten. Eine hat trotz Mann sowohl die Ernährerinnenrolle – sie war Consulting Managerin einer großen Werbefirma – als auch die Mutterrolle übernommen – mit acht Monaten hatte der Vater die Kleine noch kein einziges Mal ins Bett gebracht. Mit den Utopien von damals und der politischen Arbeit hat außer der Erstgenannten keine mehr was zu tun.
Es ist immer das Gleiche: Mit spätestens 30, also dann, wenn man als Studentin ins Arbeitsleben einsteigt, wird der Wunsch nach einer befreiten Gesellschaft, wenn man ihn denn je hatte, als naiv ansehen, und in den Fokus rückt die Lohnarbeit und das Sich-Behaupten in dieser. Denn jetzt wird es ernst. Bei Strafe des Untergangs – also Alg II oder prekärer Tätigkeit – müssen die Ansprüche der Lohnarbeit als legitim begriffen werden und es muss sich in diese voll reingekniet werden. Für die meisten ist es sonst schwer, die Schizophrenie zwischen Anspruch und Realität auszuhalten. Warum, so fragen sich dann viele, soll ich für ein vages Versprechen von gesellschaftlicher Befreiung, dessen Einlösung in ferner Zukunft zu liegen scheint, auf das bürgerliche Versprechen von Aufstieg und Einkommen verzichten, zumal ich als Akademikerin gut ausgebildet bin und nichts anderes gelernt habe. Einen ähnlichen Prozess machen jedoch auch viele durch, die vielleicht nicht an eine befreite Gesellschaft, aber immerhin an den individuellen Ausbruch aus dieser Gesellschaft geglaubt haben und Künstlerin, Schriftstellerin oder Musikerin werden wollten, die Drogen nahmen, Tage und Nächte in Clubs verbrachten, lange Reisen unternahmen und mehr oder weniger in den Tag hineinlebten; irgendwann um die 30 – mittlerweile bereits mit 25 – akzeptieren auch diese das Realitätsprinzip und übernehmen, wie man so schön sagt, Verantwortung.
Hatten diese Studentinnen in ihrer Biographie also eine Phase, in der sie reale Freiheiten erfuhren (Auszug aus dem Elternhaus ohne Arbeitszwang und trotzdem genug Geld) und sich deshalb noch mehr erträumten, fehlt dieser Abschnitt in den Lebensläufen von Realschülerinnen und noch mehr von Hauptschülerinnen. Bei ihnen gehen die Zwänge der Jugend bruchloser in die der Erwachsenen über. Ihnen fehlt zumeist die berufliche Perspektive, um ihr Leben einerseits vernünftig ökonomisch reproduzieren zu können und ihm andererseits einen gesellschaftlich akzeptierten Sinn zu geben, so dass sie sich viel früher nach Mann und Kindern sehnen.
Doch auch der Realismus der Akademikerinnen hat seinen Preis: Viele Frauen ergreifen Berufe wie Sozialarbeiterin oder Lehrerin und auch wenn es ihnen dabei um den Menschen gehen mag, heißt dies doch de facto, die Kinder und Jugendlichen als Arbeitskräfte zuzurichten und sie wenigstens soweit zu befrieden, dass sie nicht allzu aufmüpfig werden. Der Handlungsspielraum ist begrenzt: Mit dem Jugendamt müssen Handlungsziele abgesprochen werden, in der Schule gibt der Lehrplan vor, was im Unterricht behandelt wird. Der Idealismus, hier wirklich helfen zu können, den viele zu Beginn ihres Berufsleben haben, erweist sich als naiv; Burn-out oder Zynismus sind die Konsequenz. Die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen sind notwendigerweise professioneller Art und ohnehin temporär und können und sollen ja auch gar nicht dauerhaft sein und als befriedigend empfunden werden. So fehlt dann doch irgendwann das Eigene und ein Sinn im Leben. Wenn es dann kein ernsthaftes, außerhalb der Arbeit liegendes Interesse gibt, wie zum Beispiel die politische oder künstlerische Arbeit, dann ist der gesellschaftlich erlaubte Ausweg aus der Situation: ein eigenes Kind zu bekommen und hier den Sinn zu finden. Denn auf das Projekt Kind erhofft man sich wesentlichen Einfluss zu haben, und tatsächlich gibt es hier keinen Chef, der einem Vorschriften macht, sondern die Eltern haben die volle Verfügungsgewalt über das Kind, so lange sie es nicht ernsthaft vernachlässigen oder es misshandeln. Doch spätestens wenn die Schulpflicht eintritt, merkt auch der und die Letzte, dass der gesellschaftliche Einfluss doch nicht zu unterschätzen ist.
Um diese spezifischen Zwecke erfüllen zu können, möchten die meisten ein biologisch eigenes Kind haben. Alles andere zählt nur halb. Und natürlich macht dies innerhalb dieser Gesellschaft auch Sinn. Sich an der Erziehung von Kindern von Freunden oder Verwandten zu beteiligen, lässt sich oft nur schwer koordinieren. Man war ja auch schon beim Entscheidungsprozess für das Kind nicht anwesend und wenn einer der Elternteile einen Job in einer anderen Stadt findet, wird man auch nicht gefragt. Auch klassischere Modelle wie Adoption und Pflegschaft haben ihre Nachteile: die Kinder haben, bevor sie zu einem kommen, oft schon Schreckliches erlebt und sind so traumatisiert, dass sie dauerhaft davon geschädigt sein können. Nur beim eigenen Kind kann der vollständige Prozess des Aufwachsen eines Kindes mitbekommen werden: von Schwangerschaft über die Geburt, vom ersten Wort bis zu den ersten Gehversuchen, vom ersten Kuss bis zum Auszug und der Geburt von Enkelkindern. Darüber hinaus wird in die Biologie die wahre, echte Verbindung hineinprojiziert, sowohl von Kindern als auch von Eltern, die hier gesellschaftlich geprägt sind. Nur hier glaubt man, die wahre Verbindung gefunden zu haben. Kinder reagieren im Streit mit nicht- biologischen Eltern gerne einmal mit dem Argument, dass diese ihnen nichts zu sagen haben, weil diese nicht die richtigen Eltern seien. Eltern erleben nur die biologischen eigenen Kinder als Verlängerung ihres Selbst, als etwas Bleibendes, was sie geschaffen haben und das auch über ihren Tod hinaus Bestand hat und sie auch mit ihren Vorfahren verbindet und so auch dem Tod den Schrecken nimmt. Aber wenn bei diesen Vorstellung die biologischen Substanzen von Blut und Genen mit Bedeutungen überfrachtet werden, die diesen so nicht zukommen, so ist Blut in dieser Gesellschaft meistens tatsächlich dicker als Wasser, denn das Kind wird oft zur einzigen Konstante, wenn alle anderen Beziehungen brüchig erscheinen oder zumindest das Bedürfnis nach Nähe nicht ausreichend erfüllen können. Auch wenn diese enge Beziehung spätestens nach der Pubertät häufig vorbei ist und sich dann nur durch finanzielle Zuwendung, Hoffnung auf das Erbe, wenn es denn was zu holen gibt, oder über Schuldgefühle aufrecht halten lässt.
Das Bedürfnis nach Familie wird irgendwann zum Selbstläufer: Wenn immer mehr Leute in einer Partnerschaft verschwinden, dann wird das Bedürfnis nach dieser und einem Kind natürlich immer größer, weil man dann, wenn alle mit ihrer Familie beschäftigt sind, selber einsam wird. Selbst wenn die Leute den Kontakt halten, fühlt man sich in der Beziehung zu ihnen oft, als ob man das fünfte Rad am Wagen wäre. Alles dreht sich um die Kinder, die Single-Freundin kann froh sein, wenn sie mal 10 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt.
Für eigene Kinder wird ein großes Ausmaß an Arbeit und Einschränkung in Kauf genommen, weil diese Gesellschaft eine besonders ineffektive Art des Kindergroßziehens gewählt hat, nämlich jeweils zwei Menschen dafür bereitzustellen, ein 1 bis 2 Kinder aufzuziehen. Diese beiden sollen das in ihrer Freizeit nach dem Arbeitstag leisten, und sie sollen dafür überwiegend mit ihren privaten Geldmitteln aufkommen.
3. Die Alleinerziehende
Nun hat natürlich nicht jede einen Mann, der Arzt oder gut verdienender Informatiker ist. Im Gegenteil: Viele Mütter erfüllen alle Aufgaben, die sie auch als Alleinerziehende leisten müssten. Sie verdienen nicht selten den Großteil des Geldes der Familie, sie machen den Haushalt und kümmern sich um die Kinder. Man könnte also ein bisschen übertreiben und feststellen: Alle Mütter sind tendenziell alleinerziehend.
Diese These muss selbstverständlich eingeschränkt werden. Es macht einen großen Unterschied für die Mutter, ob noch ein zweiter Erwachsener da ist, der oder die sich, im Idealfall, um Geld, Haushalt und Kinder kümmert. Es entlastet die Mutter und vielleicht hat sie dann ein bisschen mehr Zeit, um sich selbst vergnügen zu können. Dennoch: Auf die klassische Aufgabenteilung – sie kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, er um das Geld – kann sich heute keine mehr verlassen. Seit der Änderung des Unterhaltsrechts von 2008 ist, nach einer Scheidung, der Ehemann nur noch bis zum dritten Lebensjahr des gemeinsamen Kindes verpflichtet, der Mutter Unterhalt zu zahlen; in Ausnahmefällen verlängert sich der Zeitraum um ein paar Jahre. Keine Mutter und Gattin kann also darauf bauen, ihre reproduktive Arbeit, die dem Ehemann und den Kindern zugute kommt, durch eine langfristige finanzielle Absicherung gewürdigt zu sehen. Sich nicht um ihre berufliche Situation und Qualifikation zu kümmern, kann sich, auch wenn eine traditionelle Aufgabenteilung „für ein paar Jahre“ sinnvoll scheint, letztlich keine leisten. Wie die meisten Menschen betrachtet offenbar auch der Staat die Ehe als nicht mehr sonderlich bindende Institution. Da die meisten Frauen arbeiten – oder arbeiten könnten – ist die lebenslang gedachte Versorgungsfunktion der Ehe obsolet geworden.
Die neue Auffassung von Ehe als einer hoffentlich lang währenden, aber häufig vorübergehenden Beziehungsform, hat auch Folgen für das Kinderkriegen und das Kinderaufziehen. Ich kenne nur wenige Mütter, die sich bei der Entscheidung für oder gegen ein Kind nicht überlegen, ob sie es notfalls auch alleine versorgen könnten. Der Wunsch der Väter spielt meinem Eindruck nach eine zunehmend geringere Rolle. Letzten Endes, so schätzen es die Mütter ein, sind sie selbst für ihr Kind verantwortlich. Gibt es Unterstützung durch die Väter, ist das häufig wünschenswert. Gibt es keine, dann halt nicht. Möglicherweise prägt die nahezu alleinige Entscheidung der Frauen für ein Kind auch die folgenden Jahre der Versorgung und Erziehung des Kindes. Da die Mütter alles – Lohnarbeit, Haushalt, Erziehung – können müssen, können sie auch alles und bedürfen eigentlich keiner guten Ratschläge. Wozu dann die Väter? Sie können helfen, verdienen vielleicht auch ein bisschen Geld und sind, sehr allgemein, für ein Kind wichtig – haben allerdings nicht viel zu sagen, wenn es um Entscheidungen geht, die das Kind betreffen.
Der These, dass alle Mütter – sei es tendenziell, potentiell oder faktisch – alleinerziehend sind, muss nun allerdings hinzugefügt werden: Auch dieses Modell funktioniert nicht wirklich. Die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, beinhaltet ja mehr als eine „Entscheidung“ für das Kind. Die Übernahme von Verantwortung bedeutet, dass man dafür sorgt, dass ausreichend Geld herangeschafft wird und noch Zeit bleibt, das Kind unmittelbar zu versorgen und sich mit ihm auseinander zu setzen. Beruf und Familie lassen sich jedoch, zumindest in Deutschland, für Alleinerziehende nach wie vor nur sehr mühevoll vereinbaren. Die umfassenden Bedürfnisse von kleinen Kindern lassen es kaum zu, dass die Mütter – selten vielleicht auch alleinerziehende Väter – ebenso viel Zeit und Kraft in ihre Berufstätigkeit stecken können, wie solche Lohnarbeiter, es tun können, die nicht oder nur ansatzweise in die Kinderversorgung eingebunden sind. Alleinerziehenden bleiben, wie Müttern generell, dadurch eher schlechte bezahlte Stellen, oft auch Teilzeitstellen, die sie mit HARTZ IV ergänzen müssen, oder sie sind in ihrer spezifischen Situation erst gar nicht vermittelbar und sind komplett auf HARTZ IV angewiesen.
Was für die Alleinerziehenden individuell eine zeitliche und finanzielle Überlastung darstellt, ist dem Staat im Fall von gut ausgebildeten Frauen eine Verschwendung der finanziellen Mittel, die in ihre Ausbildung gesteckt wurden. Eine Erhöhung des Anteils von Frauen in der Ausbildung zu Berufen, die auf dem Arbeitsmarkt gerade gefragt sind, lohnt sich nur dann, wenn die Frauen später auch wirklich in diesen Bereichen tätig sind. In den letzten Jahren wurde deshalb viel über die Arbeitsbedingungen diskutiert, die es auch Müttern ermöglichen können, voll in ihrem Beruf zu arbeiten: Diskutiert wurde über eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten, die Verringerung betrieblich geforderter Präsenszeit und über einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung. Was von diesen Vorhaben direkt vom Staat umgesetzt werden könnte, nämlich der Ausbau der Kinderbetreuung, ist kaum weit gediehen, auch wenn der Staat hier gerade ambitionierte Pläne verfolgt. Den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz auch für die unter Dreijährigen ab August 2013 wird der Staat nicht einlösen können. Weder haben die Kommunen ausreichend Geld für den Ausbau der Kitaplätze, noch sind sie bereit, Erzieherinnen und Erzieher so gut zu bezahlen, dass genug Personal vorhanden wäre. Bei den diversen, ohnehin nur halbherzig verfolgten, Plänen zur Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt, verhält sich der Staat überdies recht klassenbewusst. Während die ausgebildeten Ingenieurinnen und Informatikerinnen auch als Mütter wieder früh und viel arbeiten sollen, werden eher gering verdienende Mütter durch das „Betreuungsgeld“ dazu ermuntert, sich jahrelang ganz der Kindererziehung zu widmen.
Ein Kind alleine aufzuziehend und gleichzeitig Lohnarbeit leisten zu müssen, klappt in den meisten Fällen nur dann, wenn Großmütter, Schwestern, Brüder oder Freunde und Freundinnen helfen; sei es, um den Alltag gerade so meistern zu können, sei es, weil die Mutter auch mal in die Kneipe möchte. In der Regel sind es dann doch Verwandte, die sich verbindlich und über einen langen Zeitraum hinweg um das Kind kümmern. Die Freundinnen ziehen weg, haben eine neue Stelle und keine Zeit mehr oder bekommen selbst Kinder. Die Familie ist tot, es lebe die Familie.
Die Beschreibung der Schwierigkeiten, alleinerziehend zu sein, ist jedoch, selbstverständlich, kein Plädoyer für die Ehe; schon gar nicht eine Verklärung von Zeiten, in denen man „wegen der Kinder“ zusammen blieb. Die Möglichkeit, einen ungeliebten Partner verlassen zu können, auch wenn ein Kind da ist, ist großartig. Der Versuch, ein Kind alleine aufzuziehen, stellt jedoch in den meisten Fällen eine Notlösung dar. Es gibt kein fertiges soziales Modell, welches an die Stelle der bröckelig gewordenen Versorgungsehe getreten ist, welches allen Beteiligten einen zuverlässigen und verbindlichen materiellen und sozialen Rahmen bieten würde. Es bleibt also nichts anderes übrig, als etwas Neues auszuprobieren.
4. Erweiterungen
Das althergebrachte Modell des Paars ist in der Krise, da Formen der seriellen Monogamie und eine Scheidungsrate von 50% die lebenslange Ehe ersetzt haben. Sowohl das Paar und noch viel mehr die Alleinerziehenden sind spätestens dann komplett überfordert, wenn sie Kinder haben, da sie ihre meist kräftezehrenden Jobs mit dem ebenfalls anstrengenden Aufziehen der Kinder unter einen Hut bringen müssen. Der Staat bekommt diese ganze Misere auch nicht so recht in den Griff und doktert mit halbherzigen und zum Teil widersprüchlichen Plänen zum Ausbau von Kindertagesstätten, Elterngeld und Betreuungsgeld nur notdürftig an diesen Problem herum; eine 40- bis 50-Stunden-Woche ist damit nicht mit Kindern, von einem oder auch von vier Jahren, vereinbar und Halbtagsstellen sind oft prekär, also ohne Sicherheiten und mit finanziellen Einbußen. Oft, zum Beispiel im Gaststättengewerbe oder im Einzelhandel, sind Arbeitszeiten die Regel, die ein Kindergarten auch nicht wirklich abdeckt.
So ist es nicht weiter erstaunlich, dass Konzepte von alternativen Varianten von Ehe, Liebesbeziehungen und Familien seit einiger Zeit wieder vermehrt Konjunktur haben. Die Unsicherheit verlassen zu werden, heute allgegenwärtig, soll zum Beispiel durch das Akzeptieren von Affairen oder die gleichzeitige Liebe zu mehreren Menschen (Polyamory) gebannt werden, ohne auf das Glück und die Aufregungen des frisch Verliebtseins verzichten zu müssen. Die bürgerlichen Ehe sollte die sexuellen Bedürfnisse kanalisieren und bot im Austausch dafür Sicherheit. Der Preis dafür war das sexuelle Unbefriedigtsein vor allem der Frau, denn der Mann durfte die diesem Modell widersprechenden Bedürfnisse nach sexueller Aufregung mit einer Geliebten ausleben. Dieses Konzept hat sich heute weitgehend diskreditiert, da es dem Gleichberechtigungsanspruch von Männern und Frauen kaum angemessen ist. Was natürlich nicht heißt, dass es gar nicht mehr vorkommt. Alternative Varianten für das alte Problem werden gesucht. In auflagenstarken Büchern, wie denen von Christiane Rösinger, wird die Langeweile in Beziehungen thematisiert und stattdessen das Alleineleben propagiert. Eine immer größere Anzahl von Menschen, vor allem in den Großstädten, entscheiden sich mehr oder weniger freiwillig fürs Single-Dasein und/ oder gegen Kinder, auch wenn dies nur um den Preis der zeitweiligen Einsamkeit geht. Gerade wer keine Kinder hat, erspart sich einen Haufen Arbeit und Zeit.
Nick Hornby hat in seinem sehr erfolgreichen, mit Hugh Grant verfilmten Buch „About a boy“, eine Hommage an das außerfamiliäre Netzwerk geschrieben, in der sich ein kleiner Junge nach dem Selbstmordversuch seiner alleinerziehenden Mutter einen größeren Kreis an Bezugspersonen sucht, der ihm mehr Sicherheit verspricht, als sich nur auf die psychisch labile Mutter zu verlassen. In den USA gibt es sogar schon eine Bewegung polyamoröser Menschen – also solchen, die glauben, mehrere Menschen lieben und mit ihnen Beziehungen eingehen zu können – die für ihre Form der Liebe eine rechtliche Gleichstellung erkämpfen wollen. Solche Experimente jenseits monogamer Beziehungen und traditioneller Familien, für viele ohnehin Alltag, sind einfacher zu führen und mit weniger Stigmatisierung verbunden, wenn diese Erweiterungen im eigenen Umfeld akzeptiert sind und hier z.B. Freundschaften einen ähnlichen Stellenwert haben können wie Liebesbeziehungen. Jenseits von festgefrorenen Entitäten kann es ja möglich sein, ein Kontinuum der zwischenmenschlichen Beziehungen zu praktizieren. Auch das Vorhandensein von WGs und Treffpunkten macht die Sache deutlich einfacher. Das Bedürfnis nach Halt und Angenommensein müsste sich dann vielleicht auch nicht mehr in sexueller Treue ausdrücken, sondern in der Bereitschaft, sich in verschiedenen Beziehungen zu engagieren, auch in Beziehungen zu Kindern, die nicht die eigenen sind. Es ist ohnehin eine viel zu große Überforderung, dass ein einziger Mensch alle Bedürfnisse nach Zusammenleben, Kinderaufziehen, Verreisen, sexueller Erfüllung befriedigen, und intimster Freund und Alltagsunterstützer sein soll.
Wenn es alleine oder selbst zu zweit so anstrengend ist, ist es naheliegend, mehrere Menschen bei der Kindererziehung ins Boot zu holen. Wenn Großeltern in der Nähe wohnen, unterstützen diese ja ohnehin oft ihre Kinder, aber das muss ja nicht die einzige Alternative sein. Dabei muss es sich ja nicht immer um den großen Entwurf handeln, der leicht wieder überfordern kann, sondern es kann sich erst mal um kleine Verschiebungen drehen. Eins ist dabei gewiss: Solange man nicht anfängt, darüber nachzudenken, wie man es anders machen kann, wird sich die alte Form durchsetzen oder es führt zu Isolation. Wenn man damit anfängt, muss man sich allerdings auf eine eher experimentelle Situation einlassen, da es so wenig lebbare Vorbilder gibt, an denen man sich orientieren kann. Traditionellerweise ging der Mann arbeiten und die Frau blieb zu Haus und betreute die Kinder. Das war einfacher als heute, führte aber auch zu einer finanziellen Abhängigkeit der Frauen und dazu, dass die Männer nur wenig von ihren Kindern mitbekamen. Aktuell hat sich das nur insofern geändert, als dass die Frau zusätzlich zur Kinderbetreuung einem kompatiblen Halbtagsjob nachgeht. Mit der angeblich stattgefundenen Emanzipation der Frau hat das alles wenig zu tun und wird sich in einer solchen Konstellation kaum ändern.
Wenn man also annähernd eine Gleichberechtigung der Geschlechter erreichen will, geht das kaum, wenn einer einen Vollzeitjob hat, außer beide arbeiten voll und nehmen sich Dienstboten: Dann hat man die häusliche Arbeit verschoben, und beide bekommen nicht viel von ihren Kindern mit. Ohne Dienstboten kann ein Alltag mit Kindern überhaupt nur funktionieren, wenn beide weniger arbeiten, was jedoch auch nicht immer geht und natürlich mit finanziellen Einbußen verbunden ist. Gleichberechtigung stellt sich nicht quasi automatisch her, sondern nur dann, wenn bewusst von Frauen und Männern dagegen gearbeitet wird. Frauen, die die narzisstische Bestätigung, für das Kind die wichtigste Bezugsperson zu sein, nicht aufgeben wollen und alles alleine besser können, Männer, die nicht bereit oder in der Lage sind, die volle erzieherische und pflegerische Verantwortung zu übernehmen und sich deshalb auf Kosten der Frauen eine größere Freiheit bewahren, sind heute die Regel. Nur wenn der Mann von Anfang an konsequent mindestens die Hälfte der Erziehung übernimmt, hat er Aussicht auf Erfolg, wird für das Kind eine ernstzunehmende Bezugsperson, anstatt im Kind nur eine Projektionsfläche für die eigenen unerfüllten Sehnsüchte zu sehen. Erweitern kann man das Ganze noch, indem die Kinder weitere Bezugspersonen bekommen, die verbindlich Aufgaben übernehmen. Dass geht ganz gut, wenn man zusammen lebt, zum Beispiel als WG, ist aber auch unabhängig davon möglich. Auch mehrere Familien können sich unterstützen.
Das diese vielen tollen Möglichkeiten oftmals nicht funktionieren und wieder aufgegeben werden, selbst von Leuten, die es unbedingt anders machen wollten, liegt nicht am Unvermögen der Menschen.
Menschen, die Kinder bekommen, unterschätzen oftmals das Ausmaß an Ausgelaugtsein, welches vor allem im ersten Jahr mit dem Kinderaufziehen einhergeht. Gerade heutzutage sind die Eltern voll von Ängsten und müssen erstmal mit der Situation klarkommen. Das Kind wirkt vollkommen zerbrechlich, ist komplett von einem abhängig, außerhalb jedes großfamiliären Kontextes ist erstmal alles neu. Abgeben fällt da sehr schwer. Kinderlose wissen dagegen oft sehr schnell, was Leute mit Kindern tun könnten, um sich ihr Leben zu erleichtern. In der konkreten Situation von Eltern wirken diese Lösungsvorschläge aber oftmals nicht den Bedürfnissen der Beteiligten angemessen. Kinderlosen fällt es schwer, sich den konkreten Alltag mit Kindern vorzustellen. Meistens gelingt es ihnen, selbst wenn sie den Wunsch danach haben, kaum, eine angemessene Unterstützung der Menschen mit Kindern zu organisieren, selbst wenn es sich nur um Hilfe beim Einkaufen oder ums regelmäßige Babysitten handelt. Und es ist nicht immer ausgemacht, ob die angebotene Unterstützung unpassend oder die Eltern nicht bereit sind, Verantwortung abzugeben. Alternative Modelle, wie zum Beispiel das gemeinsame Wohnen in einer WG, scheinen kaum realisierbar zu sein, da die Lebensrealitäten von Menschen mit Kindern und solchen ohne doch oftmals sehr weit auseinanderliegen. Dazu kommt noch, dass die Ansprüche von Lohnarbeit und denen der Kindererziehung schon beim Paar kaum zu vermitteln sind, wenn beide arbeiten wollen oder vielmehr müssen, und dies der ständigen Absprache bedarf. Beim Einbeziehen anderer Menschen potenzieren sich diese Absprachen noch und können als sehr anstrengend empfunden werden.
Auch Menschen ohne Kindern fällt es schon schwer, sich etwas anderes für sich vorzustellen als die Paarbeziehung oder das partielle Single-Dasein, denn andere Formen gehen zumindest subjektiv mit einer größeren Unsicherheit einher, die existenzielle Ängste heraufbeschwören und deshalb kaum als attraktiv gelten. Denn, wenn der Partner oder die Partnerin den sichere Hafen in einer ansonsten unsicher gewordenen Welt verkörpern soll, ist es für viele einfacher, mit einer Trennung zu leben, als die Konkurrenz auch in die Liebesbeziehung hineinzuholen.
Kinder scheinen außerdem den quasi natürlichen Drang zur traditionellen Form noch zu beschleunigen; dafür sorgt, neben den oben beschriebenen Auswirkungen der Arbeitsverhältnisse, auch der Staat, denn nur Eltern können das Sorgerecht für das Kind beantragen und haben somit als einzige überhaupt die Möglichkeit, weitgehende Entscheidung für das Kind, sei es im Krankheitsfall oder bei der Wahl der Schule, zu treffen. Zudem haben sie das Recht, über den Aufenthalt ihres Kindes zu bestimmen, so dass kollektive Formen des Kinderaufziehens immer vom „goodwill“ der Eltern abhängen und auf die „Paten“ nie wirklich Verlass ist, weil ihnen nie eine grundsätzliche Form der Verantwortung zugesprochen wird. Selbst neue Lebenspartner oder -partnerinnen bei getrennt lebenden Eltern sind bei einer Trennung sofort wieder außen vor, egal wie viel Verantwortung sie im Alltag vorher übernommen haben.
5. Schluss
Weder die klassische Form von Partnerschaft und Familie, noch deren Modernisierung zum Single, zur Alleinerziehenden, zu einer Regenbogen- oder Patchworkfamilie oder auch Polyamorykonzepte können also der Über- oder Unterforderung, der Langeweile oder dem Stress, die das Kindererziehen und die Liebe – wenn sie denn allen Unbill in der Welt kompensieren soll – mit sich bringen, entgehen.
Auch die Gleichberechtigung von Frauen konnte in der Weise, wie Familien unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen organisiert sein müssen, für den Großteil der Frauen nicht durchgesetzt werden. Emanzipation ist heute Zwangsemanzipation und heißt, dass Frauen neben der Hausarbeit und der Hauptverantwortung für die Kinder meist noch einen Halbtagsjob haben. Dies nicht nur, weil die Frauen so gerne arbeiten gehen, sondern weil die Ehe nicht mehr sicher ist und ein Lohn für eine Familie nur selten reicht.
Selbst in Ländern wie Schweden oder Frankreich, in denen Kindergärten und Ganztagsschulen eine wichtigere Rolle als in Deutschland spielen – also die Bedingungen für eine Vollzeitstelle auch für Frauen eher gegeben sind – kann von einer wirklichen Gleichberechtigung nicht die Rede sein, denn zum einen übernehmen die Frauen immer noch den größten Teil der übrig bleibenden Hausarbeit und zum anderen sind genügend Vollzeitstellen gar nicht vorhanden. Auch wenn es verwunderlich erscheint: Die Frauenerwerbsquote in Frankreich ist niedriger als in Deutschland.
Die Tatsachen, dass in dieser Gesellschaft i.d.R. nur die außerhäusliche Erwerbsarbeit entlohnt wird, und diese einen oft vollständig absorbiert, während die Arbeit in der Familie Privatsache ist und vom Staat nur gering bezuschusst wird – jedoch viel Zeit und Kraft beansprucht, vor allem, wenn die Kinder noch sehr klein sind – führen dazu, dass immer mehr Leute sich gegen Kinder entscheiden, auch wenn sie eigentlich gerne welche hätten, weil sie sich kaum vorstellen können, wie sie dies neben der Lohnarbeit bewältigen sollen. Wenn sie sich für Kinder entscheiden, bedeutet dies, mit einem dauernden Mangel an Zeit und / oder Geld klarkommen müssen, was nur allzu oft mit den Schuldgefühlen einhergeht, nicht genug zu leisten und zwar in beiden Bereichen.
Hört sich das Leben zu Zeiten, als ein Lohn für das Auskommen einer Familien in vielen Fällen reichte, in den Erzählungen unserer Eltern zwar einfacher und weniger gehetzt an, so führte es doch zu Vereinseitigungen von Männern und Frauen, die für beide Seite frustrierend waren. Der Vater bekam kaum etwas vom Leben seiner Kinder mit und hatte dementsprechend eine oft oberflächliche Beziehung zu ihnen und die Frau deformierte, weil sie sich für andere aufopferte und dabei ökonomisch abhängig blieb. Auch nichts, dem man hinterher trauern möchte, selbst wenn dies heute noch ökonomisch und politisch durchsetzbar wäre. Die Idee eines Lohns für Hausarbeit, wie sie einmal in der Frauenbewegung diskutiert wurde und in sehr abgespeckter Variante von der CSU, in Form des Betreuungsgeldes, durchgesetzt wird, ist in ausreichender Variante nicht zu bezahlen und würde dann auch nur die alten unschönen Strukturen wieder heraufbeschwören.
Alles Herumdoktern hat immer nur einen begrenzten Nutzen, jede Alternative führt wieder zu neuen Problemen. Erst eine Gesellschaft, in der niemand mehr über Lohnarbeit seine Existenz sichern muss, es aber auch keine persönliche Abhängigkeit mehr gibt, könnte zu einer Lösung kommen. Denn dann könnte gemeinsam und individuell entschieden werden, wie viel Zeit für die Herstellung von Gütern und für das Aufziehen von Kindern sowie für die Betreuung von Alten und Kranken aufgewendet werden kann und wie viel Zeit jeder und jede dafür aufwenden will.
Ob das konkret für die Kindererziehung heißt, dass Familien in welcher Form auch immer, mehr Zeit für ihre Kinder haben werden, ohne damit in materielle Notlage zu geraten, ob sich Familienverbände erweitern, zum Beispiel in Wahlfamilienverbände, in der die Verantwortung für Kinder auf mehr Schultern verteilt wird, oder ob es dann unterschiedliche Konzepte und eine wirklich Wahlfreiheit erst möglich sein werden, das wird sich zeigen, wenn eine solche Gesellschaft aufgebaut wird.
Lilly Lent und Franza Ranner