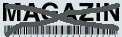Das borderline-Syndrom
Beitrag zu einer erfolgreich verhinderten Diskussion
Ein Mann weckt seine Freundin; er ist erregt; er will Sex mit ihr. Sie lehnt ab; daraufhin passiert: nichts. Beide schlafen, so ist anzunehmen, wieder ein.
Diese Begebenheit bot, vor einigen Jahren, in der ‚Interim‘ Anlaß für eine der vielen „Vergewaltigungsdiskussionen“. Wir wissen nicht, was zwischen der Frau und ihrem Typen ansonsten vorgefallen war und warum es ihr geboten schien, diese Szene an die Öffentlichkeit zu bringen. Darum geht es uns nicht. Denn die ‚Interim‘-LeserInnen wußten ebensowenig über etwaige spezifische Hintergründe bescheid; und trafen doch einhellig ihr Urteil: Sexuelle Avancen einer Frau gegenüber, die, gerade aufgewacht, noch nicht alle ihre sieben Sinne beisammen haben mag, erfüllen in jedem Falle den Tatbestand der sexistischen Grenzverletzung. Nur über die Klassifikation – Übergriff oder Vergewaltigung – wurde im folgenden noch gestritten; und natürlich gemeinsam Abscheu bekundet. Keine Stimme jedoch, die fragt, wie es wohl einem Opfer erzwungenen Verkehrs ergehen mag, das verfolgen muß, wie eine Szene konsensual das erlittene eigene Erleben begrifflich mit einer mißglückten sexuellen Kommunikation in einer Paarbeziehung gleichsetzt. Keine Stimme auch, die auf die fatale Parallele des Frauenbildes, dem hier das Wort geredet wurde, mit dem patriarchalen Weiblichkeitsideal verweist: dem Ideal der Frau, die stets erst nach reiflicher Überlegung sich dem Manne, der Geduld zu beweisen vermag, sich hingebe; die nicht wie die Schlampe spontan, gar selbstbewußt ihren Impulsen folge. (Um nicht mißverstanden zu werden: Der hier verwandte viktorianische Jargon überzeichnet. Aber merkwürdig ist es schon, wenn an diesem Fall demonstriert werden soll, warum erotische Anträge an eine Person, die sich im Zustande teilweiser Unzurechnungsfähigkeit befindet, dieser keine Entscheidungsfreiheit lasse und daher in Wirklichkeit Zwang sind – wenn die Frau doch offensichtlich zum „Nein“ in der Lage war. Dieser Logik zufolge wäre ein solches „Nein“ kein echtes, weil bloß instinktiv gewählt. Und das ist wahrlich nicht weit weg von der sittlich unwürdigen Entscheidung.)
Wo diese Stimmen fehlten, überraschte das Ausbleiben einer weiteren erst recht nicht mehr – einer, die hätte einwenden können, ob die mit klarem Kopfe und nach dem Modell bürgerlicher Vertragsfähigkeit gegebene Zustimmung zum Sex wirklich die einzig erstrebenswerte Form sein müsse; die daran erinnert, daß es Frauen wie Männer gibt, die es genießen, am Morgen, noch halb im Traum, als erstes den warmen Körper nebenan im Bett zu ertasten oder solcherart ertastet zu werden, um zusammen zu schlafen und dabei erst gemeinsam aufzuwachen; und die es zumindest für möglich hält, daß der in Rede stehende Mann nicht unbedingt wissen konnte, daß seine Partnerin diese Vorliebe allem Anschein nach nicht nur nicht teilt, sondern als Überwältigung empfinden würde – ihm daher also die bloße Frage nach schlaftrunkenem Liebesspiel anzukreiden eine Sexualnorm aufzustellen heißt, in der wirklich nur noch die in jedem einzelnen Falle quasi vertraglich geregelte und absolut risikofreie „wechselseitige Nutzung der Geschlechtseigenschaften“ (Kant) ihren Platz findet.
Ob der geschilderte Fall ein für die Definitionsrechtsdebatte typischer ist oder nicht, sei dahingestellt. Ausführlich zitiert haben wir ihn, weil er bezeichnend ist: dafür, was in dieser Debatte möglich ist – und dafür, welche Argumentationen selbst dann, wenn sie förmlich auf der Hand zu liegen scheinen, aus ihr ausgeschlossen bleiben. Es mutet fast unheimlich an, wieviel undiskutierte Einigkeit in der Sache vorherrscht, zumal in einer so uneindeutigen Sache wie der Sexualethik, zumal in einer so streitlustigen und ansonsten noch die bizarrsten politischen Positionen mitumfassenden autonomen Szene; und ebenso unheimlich, wie instinktsicher und einheitlich die Ausschlußmechanismen griffen, als mit dem ‚Bahamas‘-Artikel „Infantile Inquisition“ eine Dissonanz aufzukommen drohte. Weil uns aber solche Dissonanz in diesem gespenstischen Gleichklang dringend notwendig erscheint, wollen wir im folgenden den (unseres Wissens nach ausschließlich) verurteilenden öffentlichen Stellungnahmen eine verteidigende hinzufügen – in der Hoffnung, nicht bloß die Ruhe zu stören und Vorurteile zu bestätigen. Vielleicht teilt nach dem Lesen die eine oder der andere mehr unsere Ansicht, daß zwecks Emanzipation der Frauen wie Männer zu Menschen und ihrem Begehren zu einem menschlichen die bisherigen Praktiken autonomer Geschlechtermoral zumindest der Diskussion wert sind.
Nicht, daß wir jedes Wort der „Infantilen Inquisition“ genauso geschrieben hätten; nicht, daß wir nicht lieber an manchen Stellen weiterdiskutiert, an manchen Passagen gerne Kritik geübt hätten. Nur bestehen dafür, nach dem bisherigen Debattenverlauf, noch gar nicht die Voraussetzungen – zum Beispiel, den Artikel inhaltlich erst einmal allgemein zur Kenntnis zu nehmen. Daß die Opponenten das nicht wollen, wird in einigen Artikeln durchaus offen eingestanden (‚völlig bedeutungslos für alle, die ernsthaft Politik machen wollen‘; ‚zu provokant verfaßt, um als ernstgemeint zu gelten‘: Interim 513, S. 7 bzw. 10). Dementsprechend fallen auch die Reaktionen derer aus, die auf Ernsthaftigkeit soviel Wert legen. Beliebt sind da die Appelle, Nein heiße Nein. Wahrlich. Aber wer hätte anderes behauptet? Oder heißt das, aus einem einmal gegebenen Nein könne nie mehr ein Ja werden – wie es die ‚Bahamas‘ ja, im anlaßgebenden Falle des AAB-Vergewaltigungsvorwurfes, gefolgert hatte? (Zur Erinnerung: Außer der ‚Gigi‘ hat niemand öffentlich in Abrede gestellt, daß die Aussage der Betroffenen, ihr sei ‚Lust gemacht worden‘, genau in diesem, von der ‚Bahamas‘ interpretierten Sinne zu verstehen sei – man schloß sich vielmehr kommentarlos ihrer Wertung an, dies sei „nicht o.k.“ Dem bei der Interpretation zu Hilfe genommenen Gerücht wurde gar von keinem, wie es doch die einfachste Übung gewesen wäre, auch nur mit einem „so war es nicht“ widersprochen.)
Daß man und häufiger noch frau ein Nein nicht bloß aus überraschend angefachtem, verheißungsvollem Verlangen in ein Ja verwandeln mag, sondern auch um der lieben Ruhe willen, wird damit ja genausowenig in Abrede gestellt, wie daß die Frau aus guten Gründen sich später wünschen mag, daß sie bloß beim Nein geblieben wäre. Solchen Auswirkungen des bürgerlichen Geschlechterverhältnisses, so wäre hinzuzufügen, läßt sich gerade nicht mit dem Beharren auf Eindeutigkeiten wie „Nein“ ist gleich „Nein“ beikommen. Kritisieren lassen sie sich dennoch, auch ohne gleich „Vergewaltigung“ zu rufen und einen Täter vorzeigen zu können. Und nichts läßt sich in der „Infantilen Inquisition“ finden, was dem entgegenspräche.
So ist es auch bloß frech zu behaupten, die ‚Bahamas‘ verkläre Vergewaltigungen zu Verführungen. Was das eine vom anderen unterscheide, läßt sich ganz im Gegenteil recht präzise nachlesen; statt aber das nachzuvollziehen und gegebenenfalls zu kritisieren, wird so lange am Text gedreht, bis, nur zum Beispiel, die nun wirklich alltäglich zu bestätigende (und darüberhinaus auch noch für beide Geschlechter getroffene) Feststellung, Menschen hätten ab und an Spaß daran, in Phantasie oder Liebesspiel zu überwältigen oder überwältigt zu werden, zur Aufforderung mutiert, Frauen nach Belieben zu vergewaltigen (1) (Interim 515, S. 18). Die Reihen werden fest geschlossen: Wer nicht unsere Auffassungen darüber teilt, was eine Vergewaltigung sei, könne gegen Zwang und Gewalt im Geschlechterverhältnis nichts einzuwenden haben; wer in Frage zu stellen wagt, daß eine Frau, die Leid erlitten hat, immer und in jeder Situation dessen Ursache und Verursacher klipp und klar zu benennen vermag, unterstelle naturnotwendig weibliche Hysterie und Lust an der Lüge – so lautet das Dogma. Und gegen solche, die es nicht unterschreiben wollen, hilft nur noch die Diskussionsverweigerung seitens jener, die sich „VergewaltigungsgegnerInnen“ nennen und damit suggerieren, es gäbe da andere, die solche Gegnerschaft nicht teilen würden – als würde nicht noch der schmierigste CSU-Mann seine Ablehnung von Vergewaltigungen bekunden; als würde nicht eine solche Selbstetikettierung nun wirklich niemanden von niemandem unterscheiden.
Solcherart moralisch vorab ins Recht gesetzt und gegen jede Kritik immunisiert, fallen auch die eklatantesten Widersprüche in den eigenen Erklärungen nicht mehr auf. Im BekennerInnenschreiben zur Veranstaltungssprengung (Interim 513, S.10), das in Spiegelstrichen die Delikte der ‚Bahamas‘ aufführt, heißt es beispielsweise: „Bei Vergewaltigung geht es nicht um Sexualität, sondern um Macht und Unterwerfung!“ Kurze Zeit später aber beschuldigen die AutorInnen die ‚Bahamas‘, sie packe Stammtischparolen in „irritierend-verfälschte Sinnkonstruktionen“, als hätten sie geahnt, daß ihre Argumentation am Wortlaut des Textes zu scheitern drohe – aber das kann nur ein mieser Chauvi-Trick sein. Denn in Wirklichkeit, so die messerscharfe Schlußfolgerung, ginge es darum, „dumpfen Sexismus auch in linken Kreisen wieder salonfähig zu machen: endlich kann Mann wieder ohne Ende ficken, und zwar wann, wo, wie und wen Mann will.“ Fragen wir nicht, wo ausgerechnet das gestanden haben soll (dumpfe Sexisten werden, im Gegensatz zu uns, die „‚wohlklingenden‘ Worthülsen“ schon derart zu durchschauen wissen). Fragen wir auch nicht, ob Typen, die möglichst viel und wahllos Frauen ins Bett kriegen wollen, sich wirklich noch wie in den späten Sechzigern ausgerechnet die linksradikale Szene als Terrain wählen würden. Aber was aus der kategorischen Trennung von Sexualität und Vergewaltigung denn eigentlich geworden ist, wenn so das eigentliche, unverfälschte männliche Begehren aussehen soll, wenn ihm nicht ein Riegel vorgeschoben wird – das sollte doch einmal nachgefragt werden. Mehr noch: Wenn es doch unerläßlich sei, daß Männer nicht so ficken können sollen, wie sie (endlich wieder) wollen, was spricht dann dagegen, das Urteil der „Sexualfeindlichkeit“, das so wütend zurückgewiesen wurde, stolz zu bestätigen?
Kritik und Selbstkritik, die Fähigkeit, kollektiv zu diskutieren und als einzelne verantwortlich zu handeln, erfordert zunächst einmal ein Minimum an Verbindlichkeit, auch in den verwandten Begriffen (und sei es, um deren Begrenztheit und die der Sprache insgesamt zu reflektieren; um aufzufordern, empathisch zuzuhören – also all das, was, wohlwollend verstanden, jene meinen könnten, die sich am Objektivitätsanspruch der Rede über Vergewaltigungen empören). Das ist bei solcher Schludrigkeit in der Sache – immerhin der zentralen, um die es doch es gehen soll – nicht zu haben. Stattdessen müssen die allerabstraktesten Parolen für die Auseinandersetzung einstehen, die geleistet zu sein scheint, wenn von möglichst vielen Gruppen bei möglichst jedem (gleichwie gearteten) Fall, ob Vergewaltigungsvorwurf oder Bahamas-Artikel, Papiere verfaßt werden, an denen an zentraler Stelle die Worte „Definitionsrecht“, „Grenzen“ und „Nein heißt nein!“ vorkommen. Passen sie nicht, herrscht offene Sprachlosigkeit. Dabei hätte es uns schon interessiert, was die KritikerInnen an den Abschnitten über „Körper“, „Lust“ und „Verliebtheit“ in der „Infantilen Inquisition“ auszusetzen gehabt hätten. Einer linksradikalen Szene, die sich nicht zuletzt in anderen Zusammenhängen gerne Slogans wie „Cross the border“ oder „Freies Fluten!“ auf die Fahnen schreibt, sollte die Diskussion über das Verhältnis von Subjekt, grenzüberschreitender Lust und entgrenzender Liebe, über die Zusammenhänge von Ich-Schrumpfung und narzißtischem Stolz auf den eigenen unversehrten Körper doch besser nicht ganz egal sein. Die aber hätte sich unserer Meinung nach am Text – und sei es, weil’s aktuell keinen anderen gibt – selbst dann führen lassen können, wenn die Einschätzung der AAB und der Patriarchatsbegriff für unter aller Kanone gehalten wird.
Aber, so wird es uns wohl entgegnet werden: die Definitionsmacht der Frau! Mit dieser Formel wird jede weitere Diskussion ausgeschlossen. Denn ihr zuliebe müsse, erstens, der Vergewaltigungsbegriff gerade so unscharf gehalten werden, um offen zu sein für die verschiedensten Erlebnisse der definierenden Frauen; auch um den Preis, daß, wie kritisiert wurde, die Unschärfe schließlich jede verbindliche Diskussion unmöglich macht. Zweitens aber hieße, die Definitionsmacht nicht anzuerkennen, in der Konsequenz, nicht jede Vergewaltigung als Vergewaltigung anzuerkennen, diese also zu legitimieren – und solche Legitimation wäre in der Tat indiskutabel. Es hilft nichts, als die Definitionsmacht selbst zu prüfen: darauf, ob sie in der Tat so unangreifbar und die einzige Alternative zu ihr die Apologie der sexuellen Gewalt ist. Reden wir dazu über die SprecherInnenposition, von der aus der Definition die Macht verliehen werden soll.
Denn es sind ja nicht „die Frauen“, die die Definitionsmacht für sich fordern; schon allein die Mitautorinnen dieses Textes beweisen das Gegenteil. Genauso wenig „die betroffenen Frauen“: Nicht erst in Frauenhäusern, auch in der Szene wird wohl fündig werden, wer Fälle sucht, die sich in solcher Macht nicht wiederfinden können oder wollen, aus welchen Gründen auch immer. Die, die da Definitionsmacht fordern, sprechen vielmehr, so allgemein wie möglich, im Namen der Betroffenen, der Frauen, der Emanzipation; wähnen sich so identisch mit deren ureigenen Interessen und wohlverstandenen Anliegen, daß sie diese Differenz, die Stellvertretung, gar nicht mehr zu benennen meinen müssen. Und sie tun gut daran; denn diese Vertretung ist anmaßend. (Besonders grotesk, wenn auch keinesfalls auf sie beschränkt, scheint das an jenen Männergruppen auf, die sich stets hundertfünfzig Prozent mit der guten Sache identifizieren.)
Wie wenig die von „den Frauen“ und „den Betroffenen“ geborgte (zahlenmäßige wie moralische) Autorität wirklich Substanz hat, vielleicht gar selbst nicht so recht geglaubt wird – das zeigt schon die ganze Aufregung der Bahamas-Debatte. Wäre ihre Position in sich so gefestigt und tragfähig, wie die Definitionsmächtigen sie ausgeben, so könnten sie diese eine Gazette gelassener ihren Krams publizieren lassen; zumal tatsächlich aus dem autonomen Kosmos keine weitere Opposition zu befürchten steht. Wäre aber die Definitionsmacht von linken VergewaltigerfreundInnen so gefährdet, wie ihre VerteidigerInnen (unbeschadet der Tatsache, daß sie, wie stets, als einzige sich zu Wort melden) es in Inhalt, Stil und Interventionsmethoden erscheinen lassen: Dann wäre es doch das klügste, zu diskutieren und noch einmal zu diskutieren, auch wenn’s weh tut. Denn was nicht selbstverständlich ist, wird vor allem durch Einsicht selbstverständlich werden, weniger durchs statuierte Exempel. Nein, mit der Verve der linksradikalen moral majority zu agieren und gleichwohl so, als stünde man mit dem Rücken zur Wand, zeigt an, daß da etwas nicht zusammenpaßt. Und das läßt sich nicht mit einem Begriff wie „Überlebende“ (aus dem BekennerInnenschreiben) kitten, mag die Berufung auf ihn auch noch fester zusammenschweißen. Er funktioniert genauso unstimmig, nur noch einmal greller. Fast schon unverschämt an die Überlebenden der Judenvernichtung erinnernd (2), verleiht er den so Benannten einen Status der Unantastbarkeit. Wer wird es wagen, solche mit kleinlicher Kritik zu behelligen – und ebenso ihre VertreterInnen, die im Geiste mit-leiden? Zugleich aber konstruiert die Bezeichnung eine verschwindend kleine und dadurch um so wehrlosere Gruppe; denn die Hervorhebung als „Überlebende“ macht bloß Sinn, wenn das Überleben in der jeweiligen Situation so selten war, daß es erwähnenswert wird. Das ist bei der Shoah wie der ‚Titanic‘ der Fall, nicht aber bei Vergewaltigungen, gerade solchen, die nicht dem Klischee vom fremden Lustmörder im dunklen Wald als Urheber entsprechen. – Womit die Verleihung dieses Titels an Opfer sexueller Gewalt sich statt als Versuch, ihnen gerecht zu werden, endgültig als rhetorische Strategie der BekennerInnen erweist.
Die Betroffenen, auf die sich da berufen wird, haben guten Grund, sich bei ihren WohltäterInnen unwohl zu fühlen. Der genannte Passus über die „Überlebenden“ spricht da Bände. In ihm kommen die Opfer tatsächlich und ausschließlich als Opfer vor, keinesfalls als Handelnde. Nicht einmal mehr die Bedeutung einer Vergewaltigung sollen sie selber verkünden, obgleich doch von der Bedeutung für die Betroffene die Rede ist; denn vorgeworfen wird der ‚Bahamas‘, sie „verschweigt, was eine Vergewaltigung für die Überlebende bedeutet“. Das Totschlagargument ist zwar keines, denn es zeigt nicht etwa mangelnde Empathie der gerügten Redakteure an, die im Gegenteil ihrer LeserInnenschaft zuzutrauen scheinen, auch ohne viel Worte zu wissen, was das Böse ist. Es legt vielmehr den Anspruch der Definitionsmächtigen offen, die sich – bei aller Polemik gegen die Versuche, jenseits des Subjektiven über sexuelle Gewalt zu reden – auf einmal für fähig halten, darüber zu reden, wie sich Vergewaltigungen im einzelnen Menschen (3) ganz allgemein bedeutungsvoll niederschlagen. Woher aber stammt die Befugnis, die nun wirklich ureigenste Aufgabe eines Subjektes zu übernehmen, nämlich zu versuchen, erlittenes Schicksal zu deuten und so in die eigene Geschichte zu integrieren? Woher die Selbstverständlichkeit, die intime Nähe, mit der sich mit Vergewaltigten identifiziert wird, als wäre nicht die Übereinstimmung mit, ja schon das Erahnen von Gefühlswelten anderer Menschen das schwerste und zerbrechlichste?
Genau darin aber besteht das Programm der Definitionsmacht: in der bedingungslosen Legitimation des Gefühls, vergewaltigt worden zu sein. Nur das dürfe gelten, wenn es um die Frage geht, ob entstandenes Leid als Vergewaltigung (mit allen, was daraus folgt) benannt werden könne. Nichts, was sich in Worte fassen ließe, soll zum Urteil herangezogen werden; nicht die (relative) Übereinstimmung der objektiven Situation, der Bruch eines entweder transparenten oder vorauszusetzenden Willens etwa, deren Feststellung schon genug an Sprachüberschreitung, an Bereitschaft zu Vertrauen und Mitgefühl erforderte. Aber die Betroffene soll intuitiv in der Lage sein, ihr Schicksal in dem anderer Vergewaltigter wiederzuerkennen, und die Brücke zu jenen soll ausgerechnet das Subjektivste schlagen, das sich am wenigsten verallgemeinern läßt: das Gefühl des Leids. So transparent erscheint es den Definitionsmächtigen, daß dieses die spontane Identifikation einer Situation als Vergewaltigung über jeden Zweifel erheben soll – ganz jenseits jeder möglichen Lageeinschätzung eines dritten, auch und gerade des beteiligten Anderen. Wer aber so viel Zutrauen in die weibliche Fähigkeit hat, das eigene Gefühlschaos mit dem anderer so sicher identifizieren zu können, um daraus auf eine jeweils stattgehabte, durch einen Täter erlittene Gewalt schließen zu können: Die oder der behauptet nicht nur, auch ohne je in der gleichen Lage gewesen zu sein, genau zu wissen, was beispielsweise das vom Vater gegen ihren Willen penetrierte Mädchen empfindet (als wäre gerade dieses Wissen nicht unendlich schwerer als das sachliche und moralische Urteil, wenn überhaupt, zu erlangen). Weit skrupelloser noch, wird unter dem Banner der Einfühlung in eben solches Leid ein Begriff von Vergewaltigung gestiftet, der noch den eingangs geschilderten Fall von unerwünschtem Wecken umfaßt und wie zum Hohn aufs bekundete Mitgefühl das Gemeinsame in der Gleichheit der zugefügten seelischen Verletzung behauptet.
Zur Sicherheit sei’s betont: Wir wollen keine Hierarchie des Schmerzes errichten, wo der eine mehr zählt als der andere. Daß Schmerzen aber verschiedene sind (und sich in Trauer, Wut, Scham etc., jeweils noch in sich nicht eindeutig, verschieden äußern), hat nun gerade die Folge, daß sie sich anerkennen lassen, ohne legitimatorisch auf andere, denen es genau gleich erginge, verweisen zu müssen. Der Vergleich mag zur Bebilderung, zum Begreifen also und damit zum Bearbeiten, statthaft sein. Nur vollzieht sich ein solcher Prozeß selten im Medium der Öffentlichkeit; und wollte eine linksradikale es als ihre Aufgabe ansehen, dabei auf die Sprünge zu helfen, wäre das erst recht von einer Zudringlichkeit gegenüber den Individuen, die doch gerade von den Definitionsmächtigen als ‚Seelenstriptease‘ abgelehnt wird. Was eine politische Szene am Leid von Menschen vorrangig zu beschäftigen hätte, wäre die Unterschiedlichkeit der Ursachen festzuhalten, um sich um sie kümmern zu können. Auch einem Menschen, den der Straßenverkehr in den Rollstuhl gebracht hat, geht’s dreckig. Es ließe sich nun diskutieren, ob genauso dreckig wie Vergewaltigten, um zukünftig auch rowdyhafte Autofahrer Vergewaltiger nennen zu können. Damit mag vielleicht mehr moralische Empörung produziert werden, aber doch weniger Wissen, als es möglich wäre, und ganz sicher nicht mehr situationsgerechte Maßnahmen, Unfälle zu verhindern. Ebenso ist uns an einer Differenzierung zwischen Vergewaltigung, Übergriff und unempathischem Mackerverhalten nicht darum gelegen, um unser Mitleid korrekt dosieren, sondern um beispielsweise begreifen zu können, warum auch Männer, die keine Lust, eventuell gar Ekel dabei empfinden, Willen zu brechen und Frauen zu erniedrigen, trotzdem sich ignorant den Wünschen einer Anderen gegenüber verhalten können und denken, sie gingen schon konform. (Ein anderer Grund ist, zugegeben, die Frage nach den Sanktionen; mag das Täterkumpanei nennen, wer will. Aber die Klage der Stammtische, daß es nie um den Schutz der Opfer, sondern immer nur um den der Täter gehe, ist nicht unsere. Leider klingt sie allzuoft im hegemonialen autonomen Diskurs an, wenn es gegen jene, die Ausschlüsse und Attacken gegen „geoutete“ Männer problematisieren wollen, heißt, die Interessen der Frau ständen an erster Stelle; als ob diese nur gewahrt werden könnten in einer Strafprozeßordnung, die weder Verteidigungs- noch Revisionsinstanz kennt. Die, die sich in die Taschen lügen, sie verhängten keine Strafe, es müsse daher auch nicht über Strafzumessung diskutiert werden, sind, nebenbei gesagt, meist die größten Despoten; besonders, wenn sie die Lüge wahr machen und die Strafe in eine gemeinsame, männlich bestückte Hobbytherapie verwandeln – mit regelmäßigen Berichten über den Fortgang an die linksradikale Öffentlichkeit, wie vor einigen Jahren in einem Hamburger Fall gefordert. Da ist uns die Aufforderung: „Laß dich hier nicht mehr blicken!“ Männern gegenüber, die sich als Vergewaltiger erwiesen haben, allemal sympathischer; in ihr wird die Ohnmacht, was zu tun sei, zumindest nicht hinter allgemeinen Prinzipien und Verfahrensregeln des gerechten antipatriarchalen Verhaltens verborgen.)
Die Hierarchie der Leiden produziert in Wirklichkeit bloß die Definitionsmacht selbst. Ihr zugrunde liegt schließlich der Gedanke, das bloße „Was war?“, durchaus beschreibbar in verallgemeinernden Begriffen, reiche nicht aus; es müsse wesentlich der Name „Vergewaltigung“ hinzu- oder an die Stelle dessen treten. So erst wäre die Scheußlichkeit der Tat und des Täters adäquat gefaßt. Implizit wird so aber gerade eingestanden, daß das, worum es geht, nicht allein in der Lage ist, die gewünschte Abscheu hervorzurufen und sich daher der Bilder von Vergewaltigung – der ‚herkömmlichen‘, der vor dem erweiterten Begriff der Definitionsmacht – bedienen muß. Denn diese sind es ja, die jedeR im Kopf hat, wenn von Vergewaltigung die Rede ist, und nicht etwa solche wie die vom (wir wiederholen: unbeanstandeten!) Gerücht über den AAB-Fall. Wozu sonst wäre der Kampf so wichtig, „Vergewaltigung“ definieren zu dürfen? Wichtig im übrigen weniger den Betroffenen selber, die – in vielerlei Hinsicht bezeichnend – im Verlaufe einer Definitionsmachtkampagne meist recht schnell in den Hintergrund treten, wenn sie nicht, wie uns auch schon begegnet ist, ohnehin von Anfang an dagegen waren; sondern wichtig für jene, die sich als ihre SprecherInnen begreifen und dabei offensichtlich weniger an der Sache gelegen ist, sondern am emotionalen Mehrwert, den die Identifikation mit einer Vergewaltigten so mit sich zu bringen scheint.
Der Vertretungsanspruch der Definitionsmacht bezieht sich jedoch auf mehr als bloß die Betroffenen, geht vielmehr gleich aufs Ganze: auf ein ganzes Geschlecht von Opfern. AktivistInnen nennen sich gerne, sofern sie sich nicht als männlicher Anhang zu erkennen geben, FeministInnen oder, so einfach wie unbescheiden, (die) FrauenLesben. Wer widerspricht schon gerne der Hälfte der Menschheit, zumal der unterdrückten? Nur hoffen wir, daß diese Hälfte, so real ihre Zwänge auch sind, nicht so aussehen, wie die Definitionsmächtigen sie zeichnen und mit ihren Aktionen zu Hilfe zu kommen meinen.
Über den Verlauf der gesprengten Veranstaltung „Infantile Inquisition“ wollen wir uns nicht weiter äußern – mangels Anwesenheit wäre jeder Kommentar zu dem, was wer wo wie warum gesagt hat, einer auf Treu und Glauben. Auffällig aber ist, was sich durch fast alle Beschreibungen der GegnerInnen zieht: Sie selber scheinen nach dem Krachschlagen nicht mehr vorgekommen zu sein bzw. wenn, dann nur als Ziel von Schlägen, Tritten und Schimpfkanonaden. Ein Höhepunkt dieser Darstellungsweise findet sich im Politporno „Ein paar Informationen betreffend die Antifaschistische Aktion Berlin“ (4). Detailreich werden die bad boys beschrieben, bis man förmlich des Redners „monotone, kehlige Stimme“ und das „dreckige Lachen“ der AAB-Schläger zu hören meint. Die Gegenseite existiert nur als Lücke im Text (5); keine ihrer Handlungen wird beschrieben. Nur ominös erscheinen sie in Formulierungen wie: „als dies nicht gelang“ – nämlich „die Feministinnen mit Gewalt hinauszuschieben“ – „schlug [die AAB] vor, ‚dann müssen wir jetzt die Polizei rufen!‘“ Der Ruf nach der Polizei als letzte Rettung der Vergewaltigerfreunde paßt zwar gut in die Phantasieproduktion, aber schlecht in den Textverlauf. Dessen Komposition hatte nämlich bis dahin darin bestanden, Unschuldige von überlegenen Gegnern mit „Mundschutz“ und „Schlagring“ „brutal zusammen schlagen“ zu lassen, je wehrloser, desto besser: „trat brutalst auf eine kleine Frau los“ (gemeint ist der „bekannteste Schläger der AAB“, der zum Treten extra den Schlagring überzieht). Da muß es die LeserIn schon wundern, warum solche Bestien sich ihrer Gegner auf einmal nicht anders als mit der Polizei zu erwehren wissen. Durchaus drollig der Versuch der Verfasser, den Bruch zu glätten und das plötzliche Innehalten der AAB zu erklären mit der „Angst, sich in der Szene“ – nein, nicht eine Anzeige wegen versuchten Totschlags, sondern, ausgerechnet! – „einen weiteren Sexismus-Vorwurf einzuhandeln.“. Desto dringlicher muß den Autoren das Bedürfnis gewesen sein, die protestierenden Frauen auf Teufel komm raus nicht als Handelnde und dafür auch Verantwortung Übernehmende zu zeichnen, sondern als passiv erleidende schöne Seelen. In diesem wie in fast allen Berichten über den Abend wird skandalisiert, daß die VeranstalterInnen sich überhaupt zur Wehr gesetzt haben, und besondere Exzesse dienen dann zur Illustration dieses Skandals. Wer eine Propagandashow von Machoschweinen sprengen will, rechnet gemeinhin nicht damit, daß der Auftritt als Offenbarung verstanden wird, schleunigst innezuhalten; sondern mit Gegenwehr. Hier aber werden, vor allem von den Sympathisanten, statt Subjekte, die die Wirkungen ihrer Handlungen einkalkulieren und sich dennoch aus zu diskutierenden Gründen militant zur Wehr setzen, Inkarnationen der Weiblichkeit erheischt, unschuldig das Übel erleidend und nicht von dieser Welt.
Dieser Zug ist aber kennzeichnend fürs Frauenbild der Definitionsmacht überhaupt. Wie und wie sehr er sich niederschlägt in der Kennzeichnung des weiblichen Geschlechts als wesentlich das der potentiellen Opfer, darüber ließe sich sicher streiten (es hat ja auch Realitäten für sich); ein andermal, wenn Interesse besteht. Frappant ist immerhin die Bereitschaft, so zu agieren, als befänden wir uns noch immer in den frühen 70ern, als gälte es immer noch überhaupt erst die (linken) Männer aus ihren selbstherrlichen Machoträumen von Nebenwiderspruch und Ohne-Ende-Ficken zu erwecken – auch das eine Form der Entwirklichung von weiblicher Subjektivität, hier die der Akteurinnen der Neuen Frauenbewegung. Deren relative Erfolge zur Kenntnis zu nehmen, und wenn sie auch nur das taktische Verhalten linker Männer ihren Genossinnen gegenüber beträfen, hieße ja nicht, Friede, Freude und Verschwinden des Geschlechterverhältnisses zu propagieren, sondern vielmehr dessen neueste Arrangements erfassen zu können. Denn dazu gehört sicherlich der gute Genosse mit dem feministischen Über-Ich, siegreich im Hahnenkampf um den Titel des antipatriarchalsten Mannes. Vielleicht erschiene dann gar die auch in autonomen Kreisen anzutreffende neue Unlust am Sex, männlicherseits so hervorragend als Verzicht auf mackerhafte Anmache zu veredeln, vielmehr als aktuelle Ausprägung der Misogynie, der Abneigung gegen den störenden Frauenkörper…
Nur wäre so etwas im Diskursrahmen der Definitionsmacht nicht zu diskutieren. Denn da gilt das Ideal der Frau als Mensch ohne Begehren – nicht primär im sexuellen Sinne, sondern im umfassenderen all der Lüste und Widersprüche, die erst ein irdischen Wesen ausmachen. Wird angezweifelt, daß ein von einer Frau vorgetragener Vergewaltigungsvorwurf von unbedingtem Wahrheitsgehalt sein muß, so lautet die Antwort in der Regel, sie tue so etwas ja wohl nicht aus Spaß. Niemandem aber scheint aufzufallen, daß es eine ganze Reihe deutlich besserer Gründe gibt, jemanden einer Vergewaltigung zu bezichtigen, ohne daß dieser tatsächlich verantwortlich wäre. Warum sollen Frauen sich nicht den allzumenschlichen Freuden der Rache hingeben wollen? Warum gilt es als ausgeschlossen, daß auch Frauen sich irren könnten, Verantwortung oder schlechtes Gewissen abwälzen möchten? Nichts anderes wäre von denen zu erwarten, die keine Götter sind, sondern Individuen. Gerade in der Sexualität, wo das Begehren das Begehren des Anderen ist, Wünsche sich auf Zeit verschlingen, ohne daß ihr Ursprung bei mir oder bei dir noch auszumachen wäre, gerade in der gesellschaftlichen Position der Frau, mit der Bürde belastet, weniger Herr(in) der Lage sein zu sollen und dennoch Hüterin der Moral und Stütze des Wir, gerade da also hieße es, diese Bürde noch drückender zu machen, ihr reines Empfinden zur einzigen Quelle des Urteils zu erklären. Jede in dieser Lage wird einen Anderen suchen, der für ihre Wahrheit bürgt, und sei es einen fiktiven im Selbstgespräch; und gerade das scheitert im Modus des wortlosen Treu und Glaubens (6). Versuche, in welcher Form auch immer, das Geschehen durch den Blick eines Dritten, das Medium sprachlicher Objektivierung, anzuerkennen, sollen so nicht bloß „dem Täter“, sondern allen Beteiligten gerecht werden. Und sie werden es, trotz aller Grenzen der Kommunizierbarkeit, den Frauen allemal mehr, als wenn ihnen per Definitionsmacht zugleich mit dem Blankocheck die Zuschreibung verliehen wird, daß sie stets frei von Rachewünschen seien, frei von der Versuchung, schambesetzte Einwilligungen in ein sexuelles Geschehen nachträglich als fremdverursacht zu deklarieren, frei also vom menschlichen Recht auf den Irrtum. Die Verkitschung der Frauen zu makellosen Geschöpfen ist eine der raffiniertesten Bosheiten der patriarchalen Gesellschaft.
Nun werden die FreundInnen der Definitionsmacht einzuwenden wissen, daß Opfern sexueller Gewalt diese sprachliche Objektivierung nicht zuzumuten sei, vielmehr einer zweiten Vergewaltigung gleichkomme. Diese These ist inzwischen so zum Dogma geronnen, daß sie in der aktuellen Debatte schon gar nicht mehr begründet werden muß. Unter der Hand wird jede Redesituation einer Vergewaltigten mit jener vor deutschen Gerichten kurzgeschlossen; der berechtigte Ekel vor grinsenden Richtern und schmierigen Verteidigern, die nach der Länge des Rockes fragen, wird so übertragen auf jede Frage danach, was denn nun eigentlich geschehen sei. Ob solche Reaktionen von gemischten oder gar rein weiblichen Plena in der autonomen Szene auch zu erwarten sind, wissen wir nicht; entscheidend aber ist, daß die Definitionsmacht gar nicht mehr zum Ziel hat, das zu verhindern und Formen zu finden, in denen Vorwürfe auch ohne demütigendes oder anderweitig psychisch allzu belastendes Setting zu kommunizieren wären. Die (aus manchen Gründen und in manchen Fällen) durchaus verständlichen Hemmungen, das vor anderen auszusprechen, was war, werden statt dessen als normativ für den Szene-Umgang gesetzt. Als Ideal gilt für jetzt und für die Zukunft nicht etwa, mit Donnerhall das Geschehene zu verkünden, um sodann pragmatisch nach Wegen zu suchen, diesem Ideal nahe zu kommen, solange noch Voyeurismus und, bei der Betroffenen selbst, die Überreste patriarchaler Moral verhindern, daß alle unmißverständlich zu hören bekommen, was ihr angetan wurde. (Und gerade weil die Frauen, die es zum öffentlichen Vorwurf kommen lassen, den ersten, schwersten Schritt über Furcht und Scham hinweg schon getan haben, müßte ein solches Bestreben gar nicht so utopisch erscheinen.) Statt sich auf die je konkreten Bedürfnissen, die je besonderen Beteiligten einzulassen, um der Situation angemessen handeln zu können, muß ein hieb- und stichfestes, in Stein gemeißeltes Standardverfahren her. Das aber verhärtet nicht bloß das Denken, sondern auch ein Bild der Geschlechter, die sich ausnahmslos feindlich und ohne die Chance des Verstehens gegenüberstehen, vor allem ein Bild der Frau, die ganz Opfer zu sein hat und gar nicht Subjekt, weil ihr Sprechen nicht erwünscht ist.
Schon auf den Ist-Zustand reagiert die Definitionsmacht nicht pragmatisch, sondern gewährt Raum für die obskursten Identifikationswünsche und Frauenbilder; nicht zuletzt aber auch fürs Streben nach Eindeutigkeiten. Das Verhalten der Einzelnen stellt sich nicht, wie es dem falschen Ganzen angemessen wäre, als ambivalent dar, fordert nicht mehr, stets aufs Neue, die Urteilskraft heraus, sondern wird auf den immer gleichen Nenner gebracht. Und was infolgedessen nicht mehr zu vermitteln ist, fällt dann eben schroff auseinander, ohne daß der Widerspruch noch jemanden kümmert. Paradebeispiel hierfür ist der Vorwurf im BekennerInnenschreiben, die Bahamas individualisiere Gewalt gegen Frauen und begreife sie nicht als alltägliche Manifestation des Patriarchats. Anders als individualisierend ist der Umgang mit sexueller Gewalt allerdings schwer zu denken, und auch die Definitionsmächtigen verzichten selten mit der Begründung, es habe ja in Wirklichkeit das Patriarchat gehandelt, auf individuelle Anklagen. Der Aufruf dient ja auch dazu, gerade die Dringlichkeit des Vorgehens gegen einzelne Täter, ob AAB, ob Bahamas, zu unterstreichen. Nur fällt so die nicht ganz uninteressante Frage unter den Tisch, wieviel Freiheit der einzelne Mann beispielsweise hat, gegen seine sexistische Verfaßtheit zu handeln; und sie muß es, weil sich sonst erweisen könnte, daß noch die moralisch gerechtfertigste Anklage ein Hauch von Willkür umweht. Und daß hieße wohl, Reinheit und Unangreifbarkeit über das aushaltbare Maß hinaus zu gefährden. Gleiches gilt für andere, ebenso uneindeutig zu beantwortende Fragen, auf den verschiedensten Ebenen – genannt seien bloß das Verhältnis vom Anspruch: „Das Private ist politisch!“ zum verständlichen Wunsch nach der schützenden Intimsphäre, die zumindest der Betroffenen ja ungeschmälert zugestanden wird; oder auch die dringliche Frage nach dem hierarchischen Anteil des Geschlechterverhältnis zu seiner Gewalt beiden Geschlechtern gegenüber, die, nach einem Bonmot, Mann und Frau wie Hemden durch die Heißmangel walze, so daß sich die Frage, wer oben liege, erübrigen würde. Mag diese Antwort auch nicht befriedigen: Die autonome Praxis, die Geschlechter ganz unproblematisch nach Tätern und Opfern zu sortieren, tut’s noch viel weniger. Da fällt der Terror, ein echter Junge sein zu müssen, genauso heraus wie die vergiftete Macht, die die patriarchale Familie der Mutter im Bereich der Verwaltung des Emotionalen gewährt. Solche manichäischen Geschlechterbilder weichen nur jenen bedrängenden Fragen aus, die eine bessere – und das heißt: den Widersprüchen Rechnung tragende – Klärung verlangen, aus theoretischen, vor allem aber auch praktischen Gründen. Letztere mag ermessen, wer sich an den guten alten autonomen Slogan erinnert: Dein Wunsch nach einfachen Lösungen heißt Krieg.
Wenn die Definitionsmacht schon für die Anforderungen der Gegenwart hinter dem Möglichen zurückbleibt, um wievieles weniger noch repräsentiert sie ein Potential an sexueller Emanzipation. Für den Wunsch nach einer Welt, in der Frauen und Männer Menschen geworden sind, findet sich dort kein Platz. Was für den so ganz anderen, autonomen Umgang mit den Ekligkeiten patriarchaler Gesellschaft einstehen soll, erweist sich vielmehr als die linksradikale Ausbuchstabierung der neuesten bürgerlichen Trends. Hier wie da errichten beide Geschlechter ihre neuen, narzißtischen Körperpanzer und sind peinlich darauf bedacht, daß ja kein Genuß eines anderen diesen beflecke, ob Zigarettendunst, Lockrufe der Straßendealer oder begehrliche Blicke. Während die tatsächliche sexuelle Interaktion beständig abnimmt, begeistern sich die Menschen für deren vertraglich lückenlose Regelung. Gerne gesehene Talkshowgäste sind daher Sadomasochisten, die den Normalos verraten dürfen, wie man erotische Abläufe gemeinsam plant und Regeln unterwirft und wann welche Codewörter benutzt. Sexualmoral, so Gunther Schmidt in seinem Buch „Sexuelle Verhältnisse“, weicht der Verhandlungsmoral, in der alles erlaubt ist, wenn vorher darüber Einigung erzielt wurde; und als paradigmatische Abartigkeit gilt daher inzwischen die Päderastie, weil Kinder als per se nicht vertragsfähig gelten (auch hierbei war Anfang der 90er zu beobachten, wie die ursprünglich radikalfeministische und autonome Kampagne gegen sexuellen Mißbrauch neben Aufklärung ebenso Stichworte für RTL-Familiendramen hervorbrachte). Für eben jene Abneigung vor dem Ungeplanten, Unabgesprochenen steht in der Definitionsmacht der Begriff der Grenzverletzung ein; er bringt zum Verschwinden, daß jede sexuelle Handlung, die nicht bloß Gleiches wiederholt, Grenzen überwindet und in immer intimere Bereiche vorstößt. Noch die behutsamsten PartnerInnen, die sich vor jedem neu berührten Körperteil um Erlaubnis bitten, kommen strenggenommen aus dem Dilemma nicht heraus: JedeR weiß, daß man nach Geschlechtsverkehr nicht wie nach der Uhrzeit fragt.
Aus der Übertretung ansonsten feststehender Grenzen, auf dessen nachträgliche Gestattung jede erotische Handlung spekuliert, zieht sie ihre Spannung, ihre Schönheit genauso wie ihre Gefahr; denn die Spekulation kann natürlich fehlgehen. Das bedeutet keinen Freibrief für alle Arten des unvermittelten Griffs an den Körper beispielsweise; manches Wissen, welcher Wunsch auf keinen Fall Anerkennung finden wird, kann man den Subjekten problemlos unterstellen (daß einer Frau nicht einfach an Brust und Hintern gefaßt wird, haben die Männer wahrlich oft genug zu hören bekommen). Aber die nie ganz auflösbare, Spannungen hervorrufende Unsicherheit zu leugnen und jeden mißgebilligten Grenzübertritt als subjektives Versagen zu verhandeln, hieße von den Menschen Unmögliches verlangen – die perfekte sexuelle Kommunikation. Schon im Verkehr mit Worten sind Momente jenseits von Banalität, Einsamkeit und Verletzung selten und kostbar; wie erst im ekstatischen der Körper. Dazu sind die, die in diesen Verhältnissen leben müssen, allesamt zu kaputt, und sie werden nicht davon heiler, daß zu den drückend unerreichbaren bürgerlichen Idealbildern des ganzen Mannes und der ganzen Frau noch das autonome des ganz Empathischen den Druck begriffslos verstärkt. Einzig im Medium des Theoretischen ist er zu erhöhen, als Einsicht in die notwendige Unzulänglichkeit der leiblichen Vermischung, solange die Körperpanzer der bürgerlichen Subjektformen herrschen. Das schließt die Abwehr gegen (in der Regel) männliche Zudringlichkeiten nicht aus und doch ebenso das dem Kampf entgegengesetzte Bild ein: die Entlastung der einzelnen von der Schmach des permanenten individuellen Versagens, die wechselseitiges Verzeihen denkbar macht. Die Streitlust wie der Großmut eint die Absage an die Angst, die beiden Geschlechtern aufgeherrscht ist. Das Gerede von den Grenzen hingegen rationalisiert eine sexuelle Ausprägung des berüchtigten subjektiven Sicherheitsgefühls, das aus Furcht vor Risiken lieber selbstgenügsam bei sich bleibt bzw. im altbewährten Pärchen. Denn es allein bietet am ehesten Gewähr, sich schadlos zu halten: kein Unbekannter, dessen Begehren Abgründe aufreißt, keine Unbekannte, die aufgrund von Wunden, und seien es tapsig zugefügte, an die Öffentlichkeit sich wenden wird. Die autonome Sexualmoral befördert, ob sie will oder nicht, die gesellschaftliche Renaissance der monogamen Zweierkiste. Jene Utopie aber, die auch die ‚Bahamas‘ bezeichnet, von Subjekten, die aus ihrer engen Form heraustretend sich zwecklos im Genuß an anderen verschwenden, hat ihr, so scheint es, die Sprache verschlagen.
Les Madeleines, März 2001
Anmerkungen:
(1) Daß es das nicht sein kann, sagt schon die Logik einer Vergewaltigung: des Täters Lust besteht ja fast immer darin, gegen den Willen der Frau zu handeln. Geteilte Lust wäre so für ihn keine mehr. Auch ansonsten läßt sich vom empirischen Befund masochistischer Phantasien bei vielen Frauen nicht auf die Rechtfertigung von Vergewaltigungen schließen – im Gegenteil. Illustrieren läßt sich das am besten im Vergleich mit dem Kindesmißbrauch: Auch hier vertreten bekanntlich einige Übereifrige, die bloße Feststellung frühkindlicher Sexuallust stelle bereits eine Legitimitation des erwachsenen Übergriffes dar. Wären aber Kinder tatsächlich sexuell so ohne Ahnung und Verlangen, so wäre schwer zu erklären, warum eine erzwungene Penetration beispielsweise anderes und schlimmeres als jede andere Körperverletzung wäre. Erst die gewalttätige Enteignung und der damit verbundene Kontrollverlust über die zugleich allerintimsten wie schon immer beunruhigenden Phantasien machen das demütigende der Vergewaltigung aus, nicht nur für das Kind, und erklären die Scham darüber: Das also ist es, was ich mir gewünscht habe, wispert böse das Über-Ich und verwandelt so das Erlittene in zugleich logische Konsequenz wie gerechte Strafe eines von Anfang an verdorbenen Begehrens.
(2) Woher nicht nur wir den Namen „Überlebende“, ohne jede weitere Bestimmung, einzig kennen.
(3) Beachtet sei der Singular: „die Überlebende“, der im übrigen nicht nur anzeigt, daß es sich hier wahrhaft um den Einzelfall handeln soll, sondern auch noch um einen stets weiblichen. Das paßt zum Schweigen im Definitionsmachtdiskurs über etwaige Kriterien, nach denen Jungen und Männer ihren Anspruch darauf, Opfer einer Vergewaltigung gewesen zu sein, samt entsprechender Konsequenzen geltend machen können. – Daß es männliche Opfer gibt, wird doch hoffentlich niemand in Abrede stellen; sie scheinen jedoch das Pech zu haben, dem „Geschlecht der Täter“ anzugehören. Und bevor die Schubladen durcheinander zu geraten drohen, bleiben sie in der linksradikalen Rede lieber außen vor.
(4) Interim 515, 30.11.00, S. 20f. – Den Jargon des Gegners zu paraphrasieren gehört sicherlich in den Bereich möglicher Stilmittel. Aber die in diesem Text abgedruckte Phantasie über die Motive, einen Schwulen nicht ins Schwulenreferat zu wählen, fällt nicht nur wegen ihres Opferpathos auf. Da wird von einem StuPa berichtet, das Schwulenreferate einrichtet, nur um anschließend Schwule aus Schwulenhaß nicht hineinzuwählen. Zur Illustration der Motive der Beteiligten, vor allem eines Delegierten der AAB natürlich, wird anschließend fabuliert: „Es ist wie in einem schmierigen Softporno aus den 70ern: Erst muß der Tunte eine aufs Maul gehauen werden, bevor die Frau ‚rangenommen‘ wird. Doch schon bald stimmt sie lustentbrannt in ihre ‚Vergewaltigung‘ ein.“ Wenn das den Verfassern als Softporno gilt, so wollen wir gar nicht wissen, was bei ihnen unter Hardcore läuft. Von ihren Bildern, die kundzutun, allzumal mit dieser Wort- und Gänsefüßchenwahl, sie niemand gezwungen hat außer ihr eigenes Unbewußtes, haben wir auch so mehr als genug.
(5) Ein besonders schönes Beispiel dafür bietet der Satz, die Autoren hätten vieles „erst hinterher“ mitbekommen, „da die AAB ihre Gewalttaten immer durch Kettenbildung vor Blicken verbarg.“ Und das soll inmitten einer Saalschlacht gelingen, ohne daß zumindest Schmerzensschreie hörbar würden? Hier sind die Lücken, die notwendig blinden Flecken der Wahrnehmung so zwanghaft wie buchstäblich in den Text eingeflossen, daß sie unmittelbar zur Sprache kommen. Das macht dieses Dokument, von vier Gruppen unterzeichnet, von einer Redaktion kommentarlos in die Zeitung gehievt und von niemandem widersprochen, so symptomatisch für die Szene wie kein zweites.
(6) Ein beliebtes Motiv in Horrorfilmen: Die ProtagonistIn hat das Grauen erblickt, und die Frustration, wenn die anderen ihr bestätigen, daß es subjektiv wohl so für sie gewesen sei, können alle ZuschauerInnen mitfühlen. Wer ZeugInnen sucht für Erlittenes, möchte erzählen und noch einmal erzählen und nicht beschieden bekommen, daß man ihr oder ihm auch ohne viele Worte glaube – und gar noch das subjektive Empfinden, dessen Tücken und Fallen die Erzählung doch gerade entfliehen will. Bemerkt denn niemand das Demütigende im Bescheid, man glaube der klagenden Frau, weil man sich die Anerkennung der Klagen von Frauen, unabhängig vom konkreten Fall, zum Prinzip gemacht habe, und sie brauche gar nicht weiter zu reden?