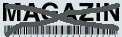Keine Definitionsmacht für Niemand!
Die Definitionsmacht ist am Ende. Das weiß eigentlich jeder. Das jüngste Revival im Zusammenhang mit den „critical whiteness“-Debatten ist kein Beleg für ihre Durchsetzung – der verschärfte Ton ist ein Todeszucken. Die grundlegenden Widersprüche sind einfach zu groß. Man kann den Leuten nicht erzählen, sie sollen sich völlig von den Erkenntnisgrundlagen ihres gesellschaftlichen Lebensumfeldes entfernen. Das funktioniert alle paar Jahrzehnte im kleinen Kreis, wenn wieder mal vergessen wurde, wie beschissen es beim letzten Mal gelaufen ist. Aber dauerhaft geht es nicht. Vor vielleicht fünf Jahren galt die Definitionsmacht erneut als unumstößliche Wahrheit und als irgendwie antisexistisch radikal. Wer ein besonderer Freund der unterdrückten Frauen sein wollte, der musste bloß das einzige Axiom bedingungslos akzeptieren und rigoros verteidigen, das die Definitionsmacht bereit hält: Die Frage, was als sexueller Übergriff gilt, bestimmt eine einzige Person – diejenige, die sich davon, nach welchen Kriterien auch immer, betroffen fühlt. Jeder, der das nicht akzeptiert, ist ein Sympathisant der patriarchalen Gewalt, mithin: politischer Feind. Das ist für die meisten eine einfache Welt mit einer noch nie da gewesenen Eindeutigkeit von „Gut“ und „Böse“. Das ist ein erhebendes Gefühl, besonders für die Antifas, Autonomen, Feministen, die jeder mit deutschsprachiger Szeneerfahrung kennt: Sie lieben ihren Lifestyle mit einer Mischung aus Genuss und weltschmerzelnder Tragik. Sie haben ihren hauptsächlichen sozialen Bezugsrahmen im lokalen AZ. Sie entstammen meist der Mittelschicht und haben entsprechend gute Anbindung an die hiesigen Bildungsinstitutionen. Sie sprechen fließendes Deutsch. Sie sind so gut wie nie Ausländer, eigentlich niemals „dunkelhäutig“. Eine erschreckend große Anzahl hat psychische Probleme. Sie neigen zu starren politischen Dichotomien, weitgehend unbeweglichen weltanschaulichen Glaubenssystemen: Sie halten ihre Unnachgiebigkeit für Radikalität, ihre Unverständlichkeit für Differenziertheit und ihre Aggressionsbereitschaft für Plausibilität. Diese Leute sind häufig tonangebend in linken Zusammenhängen. Man hat ihnen diese Macht aus Unbedarftheit und anfänglicher Begeisterung und in Ermangelung besserer Alternativen übertragen. Sie haben sich mit politischem Verbalradikalismus und argumentativen Allgemeinplätzen den Status erarbeitet, besonders vertrauenswürdig zu sein. Und zuschlagen können sie auch. Deswegen schützen sie die Party nach dem Kongress, das Antifa-Café oder das antimilitaristische Theorie-Camp. Dort mustern diese Leute ihr Gegenüber genau, suchen nach Abweichungen – besonders bei Leuten, die sie nicht kennen. Sie warten auf ein falsches Wort, auf verräterische Körpersprache. Sie wollen, dass die Unbekannten sich falsch verhalten, damit sie loslegen können: Aufgebrachtes Herunterrattern von einstudierten Argumenten in einem einheitlichen Jargon, manchmal von vornherein aggressiv, manchmal trotzig – und fast immer umringt von drei, vier, fünf, zehn oder gar zwanzig (meist männlichen) Sympathisanten, die auf „ihr Zeichen“ warten. Ihre Kontrahenten reagieren auf die Bedrohungssituation naturgemäß mit Panik, Hilflosigkeit, Trotz oder Angriff. In jedem Fall: Wenn sie nicht einsehen, dann sind sie dran. Dann wird es plötzlich lauter. Einer der Rundumstehenden hat mittlerweile die Quarzsandhandschuhe angezogen und schubst den Delinquenten. Wenn der sich jetzt wehrt, hat er verloren. Dann rasselt es Schläge, Tritte, womöglich zückt einer einen Teleskopschlagstock oder sprüht ein besonders starkes Pfeffergel, das er sich aus den USA bestellt hat. Man verfrachtet den Malträtierten auf die Straße, wo er sich alleine oder mit Hilfe seiner leicht verletzten Begleiter zur nächstgelegenen Haltestelle schleppt. Die Polizei kann er sich sparen: Niemand hat irgendwas gesehen und die Mehrheit der Schläger war vermummt. Diese Abfertigung wird zumindest jenen zuteil, die mit der Definitionsmacht-Szene wenig bis gar nichts zu tun haben und schlicht mit ihrem normalen Habitus auf der falschen Musikveranstaltung gelandet sind. Noch weitreichender sind die Konsequenzen für die Integrierten, für die Leute „aus der Szene“.
Matthias ist 23 und macht seit sechs Jahren Antifa-Arbeit. Er schreibt Redebeiträge, ist im Lesekreis, läuft in Demo-Ketten mit – gerne erste Reihe, denn er ist etwas größer als der durchschnittliche Antifa, trainiert im Fitness-Studio und macht Krav Maga. Es schmeichelt ihm, dass man ihn häufig für die handfesten Auseinandersetzungen empfiehlt. Er geht gerne zum Fußball, trinkt wenig Alkohol und feiert und pöbelt gerne auf Elektro-Parties. Viele Feministinnen finden ihn zum Kotzen, denn er buttert gerne Leute in Diskussionen runter. Aber wie das halt so ist, geht von dem rebellischen Image ein gewisser Reiz aus. Deswegen ist Matthias selten alleine und fickt, wie die meisten seiner politischen Weggefährten, weibliche Antifa-Ultras und die eine oder andere Besetzerin. Mal kommt es zur Beziehung, mal bleibt es nur ein One-Night-Stand. Annika, 20, ist erst seit zwei Jahren in der Szene. Es fällt ihr nach wie vor schwer, in den männerdominierten Diskussionen mitzuhalten. Sie interessiert sich außerordentlich für die theoretischen Veranstaltungen, denn sie ist es satt, auf den Vorträgen immer nur in der Küche zu stehen. Sie tanzt ebenfalls gerne auf Parties, zieht hin und wieder etwas Speed, hat mit dem Joggen angefangen, um bei zukünftigen Aktionen besser mitzukommen. Annika hatte eine Menge beschissener Beziehungen, besonders in der Zeit vor ihrem politischen Aktivismus. Mit ihrem letzten Freund ist es gerade zu Ende gegangen. Sie musste die WG verlassen, in der sie gemeinsam gewohnt haben, und hat das Gefühl, dass sich viele ihre Freunde auf seine Seite geschlagen hätten. Die Queer-Party an diesem Wochenende ist eine gute Gelegenheit, den angestauten Frust loszuwerden.
Matthias verbringt den Party-Abend mit den Leuten vom „Schutz“ an der Tür. Er trinkt etwas mehr als gewöhnlich. Schon beim Reinkommen fällt ihm Annika auf, die er bislang nur flüchtig vom ein oder anderen Plenum kennt: Er lächelt sie an, sie lächelt zurück. Auch sie kennt Matthias, konnte ihn aber bislang nicht gut leiden. Viele ihrer Freunde und Freundinnen aus dem queer-feministischen Umfeld reden nicht gut von ihm: Der prollt ständig rum mit Prügel-Geschichten, trägt selbst auf Parties sichtbar die Spange mit dem Pfefferspray an der Hosentasche und, überhaupt, wie laut der immer redet und die ganze Macker-Attitüde. Stunden später, die Party ist im vollen Gange, auch Annika hat mittlerweile mehr getrunken als gewöhnlich. Sie tanzt zu Audiolith-Klängen durch die Menge und findet sich plötzlich Matthias gegenüber – sie tanzen miteinander und irgendwann küssen sie sich. Nach einer Stunde schwitzigem Rummachen verschwinden sie von der Party, ohne zu irgendjemandem „Tschüss“ zu sagen. Matthias wohnt ganz in der Nähe und bei ihm zuhause angelangt landen sie ruck-zuck in seinem Bett. In diesem Moment denkt keiner an den Antisexismus-Reader, der im Eingangsbereich der Queer-Party ausliegt. Matthias denkt nicht an die warnenden Worte seiner Freunde, sich nicht mit „den Harcore-Feministinnen“ einzulassen und Annika denkt nicht daran, ob es eigentlich ihren Prinzipien widerspricht, wenn ein Typ ihr beim Sex auf den Hintern schlägt. Nachgefragt hat er nicht. Zugestimmt hat sie auch nicht. Das kam ihnen in diesem Moment gar nicht in den Sinn.
Einige Zeit nach dem Intermezzo zwischen Annika und Matthias zeichnet sich ab, dass die beiden nicht für eine Beziehung miteinander geeignet sind. Matthias hat eh nur Politik im Kopf und Annika hat die Schnauze voll davon, dass er bei Diskussionen immer Recht behalten muss. Sie haben noch ein paar mal was miteinander, aber wirklich Spaß macht es beiden nicht. Matthias beendet die ganze Sache und konzentriert sich wieder auf seinen Fußball-Aktivismus. Annika zieht sich ebenfalls zurück und verbringt wieder mehr Zeit im TransLesbenFrauen-Café. Dort berichtet sie ihren Freunden von der Geschichte. Je mehr sie ins Detail geht, desto entsetzter reagieren ihre engsten Vertrauten: Ob sie das nicht „komisch“ fände, wenn er sie einfach so schlägt, ohne zu fragen? Das wäre ja schon okay, wenn man das ausgemacht hätte, aber einfach so? Wie sie sich denn die Zeit danach so gefühlt habe, will ihre beste Freundin wissen. Annika denkt nach und kommt zum Schluss: Nicht so sehr gut. Matthias wäre regelrecht kaltherzig gewesen und beim Sex auch nicht gerade rücksichtsvoll. Annikas Freundin guckt sie mit einer Mischung aus Mitleid und Verständnis an: Es sei jetzt „ganz wichtig“, dass sie „gut auf sich hört.“ Annikas Kopf pulsiert. Auf dem Weg nach Hause drängen sich die Argumente immer klarer auf: Matthias hat sie vergewaltigt.
Wochen später hat sich eine in Szene-Kreisen mehr als bekannte Situation eingestellt: Über diverse Mailing-Listen und interne Foren warnt eine größtenteils anonyme „Unterstützer_innengruppe“ vor „M., dem Vergewaltiger“. Er habe sich uneinsichtig gezeigt, unwillig, „seinen Täterstatus zu reflektieren“ und suche „auf provokative Weise Rückendeckung bei seinem männlichen Umfeld.“ Alle Gruppen und Locations seien aufgerufen, die politische Zusammenarbeit mit ihm einzustellen und Hausverbote auszusprechen. So gebiete es der Respekt vor den „Bedürfnissen der Betroffenen“. Matthias engstes Umfeld ist zutiefst verunsichert, denn keiner möchte gerne weiter als nötig in die Schusslinie gezogen werden. Manche ehemaligen Kumpanen sind sogar gegen ihn aggressiv geworden, als er auf das erste Hausverbot nicht gleich reagiert hat. Schon munkeln einige Leute, Matthias WG würde sich nicht eindeutig genug positionieren. Bei den konsequenteren „Defma“-Vertretern ist es schon längst beschlossene Sache: Wer jetzt noch zu Matthias hält, der ist ein Täterschützer. Annika geht es unterdessen extrem schlecht. Sie ist ständig erkältet, hat starken Reizhusten. Sie möchte nicht mehr gerne weggehen, weil die Leute sie alle so komisch angucken. Ihre Freunde aus dem Queer-Café hatten zwar zugesagt, sie aus der Sache rauszuhalten und ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit beizustehen, aber nach einigen aufreibenden Gesprächen hilft ihr das auch nicht weiter. Sie ist es satt, ständig gefragt zu werden, was denn jetzt eigentlich ihre „Wünsche“ wären. Die Sache ist im Rollen und für Annika längst nicht kontrollierbar. Eigentlich sieht sie sich nicht gerne als „Opfer“. Aber das Umfeld beschwichtigt: Es ginge jetzt darum, wieder „Kontrolle über ihr Leben“ zu gewinnen. Und bloß weil die Anderen sich stur stellen und „einen Diskurs zu Gunsten des Täters fahren“, soll sie nicht „ihre Perspektive“ in Zweifel stellen: Das sei ihr gutes Recht und wiederum „sehr wichtig“. Die Leute würden ihre „Retraumatisierung“ in Kauf nehmen und davor gilt es, sich zu schützen. Annika geht seit einem Jahr zu einer Psychologin. Auf Empfehlung einer Freundin hat sie neuerdings zwei Termine die Woche, um „das Geschehene aufzuarbeiten.“ Aber ihre Psychologin reagiert nicht so, wie sie es sich versprochen hat. Die „Definitionsmacht-Debatte“ scheint sie nicht gut nachvollziehen zu können. Und sie reagiert auch nicht aufgebracht, sondern lediglich mit ernstem Schweigen, wenn Annika die Argumente wiederholt.
Annika geht es schlecht. Matthias geht es auch schlecht. Eigentlich geht es niemandem gut. Höchstens den Leuten, für die Definitionsmacht einen Großteil ihrer politischen Identität ausmacht. Denn sie fühlen sich im Recht. So richtig lange hält das aber auch nicht an. Dann wird man irgendwann sauer, dass die Anderen nicht mitspielen und dann setzt Resignation ein. Das bisherige Gefühl der politischen und ethischen Auserwähltheit weicht einer vollständigen Frustration. Und auf diese Frustration folgt die nächste Welle von Aggression. Gut geht es den überzeugten „Defma“-Vertretern also auch nicht. Sie klammern sich lediglich daran, dass ihre politische Lieblingsstrategie angeblich irgendwo im Universum die Ergebnisse bringt, die sie sich davon versprechen. Und weil das theoretisch so sein müsste, wollen sie nicht wahrhaben, dass das eigentlich niemals der Fall ist. Ganz im Gegenteil: Die Definitionsmacht treibt Menschen auseinander. Sie setzt alle Beteiligten dem Druck aus, sich für jetzt und die Zukunft eindeutig zu positionieren. Sie schafft ein Denkschema, das zwischenmenschliche Probleme zu einer Frage der politischen Lagerzugehörigkeit macht. Sie schafft Empfindungen, ausgeliefert zu sein: ausgeliefert an das wankelmütige Umfeld provisorischer „Unterstützergruppen“; ausgeliefert an die Gunst einer politischen Subkultur, deren menschliche und ideologische Zusammensetzung sich manchmal alle paar Monate ändert; und ausgeliefert an die regelrechte Pflicht des passiven Opfers: Wer jemals eine Definitionsmacht-Debatte gegen einen Anderen durchsetzt, der sollte unter Garantie keinen Rückzieher machen, wenn er nicht auf böswillige Art und Weise zerfleischt werden möchte. Die Definitionsmacht entfernt „die Betroffenen“ außerdem vom schützenden gesellschaftlichen Umfeld: Kein Vater und keine Mutter, die wenigsten Psychologen und erst recht kein bürgerlicher Freundeskreis können die Spezialkonstellation von Momentverfassung, politischer Überzeugung und sozialem Chaos der innerlinken Szene-Strukturen angemessen nachvollziehen und berücksichtigen, wenn die Getriebenen panisch um Hilfe flehen. Im schlimmsten Fall distanzieren sich die fremdernannten „Opfer“ von allen Vertretern der „Täterperspektive“ und versinken in der kleinen Sub-Subkultur der Definitionsmacht-Hardliner. Jeder, der schon mal einen Blick in einen gähnend leeren TransLesbenFrauen-Schlafraum geworfen hat, kann sich denken, dass das kein schönes Leben ist. Und kein gesunder Menschenverstand kann in einer solchen Situation noch auflösen. Wie so oft in autonomen Zusammenhängen haben ideologische Unstimmigkeiten, menschliche Machtstrukturen und das trügerische Gefühl, „das Richtige zu tun“, Menschen unwiderruflich zu Feinden gemacht. Vielleicht hätte Annika demnächst einen Typen gefunden, der besser zu ihr passt. Vielleicht hätte irgendwer Matthias verständlich machen können, dass man Leute in Kurzzeitaffären schnell mal auf dem falschen Fuß erwischen kann, damit er in Zukunft vielleicht noch etwas einfühlsamer wird. Vielleicht wären sie ohne Definitionsmacht später doch noch mal zusammengekommen. Aber solche Wege sind verstellt. Annika darf kann sich nur noch zwischen verschiedenen „Schutzräumen“ bewegen und Matthias zieht sich ins unpolitische Ultra-Spektrum zurück, weil weder er noch irgendjemand anderes Bock auf „Täterarbeit“ hat. Politische Arbeit machen beide nicht mehr wirklich. Die Definitionsmacht fordert allseitige Ergebenheit, sie ist undurchlässig, repressiv und widersprüchlich. Sie kann beseitigt werden, ohne, dass man sich die Finger schmutzig macht. Sie kann ersetzt werden durch menschennähere Umgangsformen. Sie kann verschwinden, ohne dass sich ihre bisherigen Befürworter und Gegner schämen müssten, sie derartig lange verehrt zu haben. Es wäre ein Zeichen von menschlichem und politischem Mut, wenn sich „die Szene“ aus dieser Verstrickung befreien könnte. Sie verfügt über ein Grundmaß an Empathie und Vernunft, das ihr neue Wege eröffnen kann. Sie darf diese Wege gehen.
Anonym, Juli 2013