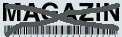Gedanken zum Frühlingsanfang
Zur Kritik an der Bahamas-Ausgabe „Hauptsache Sexualität“
So hässlich es im allgemeinen ist, mit einem Bekenntnis an die Öffentlichkeit zu gehen, so nötig ist dies, leider, wenn es um die von der Bahamas aufgeworfene Debatte zur linksradikalen Sexualmoral und zum Antipat-Aktivismus geht. Denn diese Debatte kennt nur noch die Abgrenzung – oder aber den Verlust der Satisfaktionsfähigkeit. Um also nicht Gefahr zu laufen, zur Gemeinde jener hochdifferenzierten Schlaumeier gerechnet zu werden, die endlich der gemeinhin naserümpfend betrachteten Bewegungsfraktion sich als Lieferanten schwer durchdachter Argumente gegen Vergewaltigerfreunde andienen können, bekunden wir: Daß wir mit der Attacke gegen Sexualverdrängung und Strafbedürfnis konform gehen, ist nachzulesen, und daß von einem Patriarchat, d.h. einem (gar noch ‚eigenständigen‘) Herrschaftsverhältnis ‚der Männer‘ über ‚die Frauen‘, zu reden nur Sinn stiftet, aber keine Erkenntnis, setzen wir ebenso voraus. Gerade das macht die Suche nach dem treffenden Verdikt übers (post-) bürgerliche Geschlechterverhältnis nicht obsolet, sondern umso dringlicher. In der Hoffnung, die nur an Rancune Interessierten treibe inzwischen schon längst anderes herum, wollen wir daher unsere Thesen, die zunächst für die interne Diskussion gedacht waren und deren kursorischer Charakter trotz Überarbeitung sich nicht übersehen läßt, zur Diskussion stellen. Im engeren Sinne Manöverkritik soll nach Möglichkeit zurückstehen. Natürlich gab manch Unsinn Anlaß zum Ärger, auch für die mit der Intervention Solidarischen. Natürlich braucht es zur Widerlegung des populären Mißbrauchsmythos, wer sich am wenigsten erinnere, sei am sichersten Opfer, nicht die apodiktische Behauptung, „tatsächlich Widerfahrenes wird nämlich nicht verdrängt“ (32), zumal der in den Zeugenstand gerufene Freud selber mehrfach die Fähigkeit der Hysteriker benennt, „einen traumatischen Eindruck der Amnesie verfallen zu lassen“ . Natürlich ist, außer Weißglut bei den Gegnern, wenig damit gewonnen, die „traumatische Erfahrung“, vulgo Vergewaltigung, kleiner Mädchen mit Verführung zu erklären, die ihnen um so besser gelänge, je weniger „vaterdominiert“ (31) die Familie wäre – als würden nicht damit, statt sie zu kritisieren, die Projektionen kindlich-unschuldiger Passivität und erwachsen-notgeiler Aktivität einfach umgedreht werden; als unterstellte nicht der Begriff „Verführung“ ein Mindestmaß an Bewußtsein, das dem ödipalen Begehren gerade abgeht. Diese, und manche (nicht viele) andere Sätze, wären besser unterblieben. Aber gerade deswegen lohnt auch kein Streit um sie.
Mit Freud in der Sesamstraße
„Die Libido“, heißt es in „Die Macht des Sexuellen“, sei „nicht gut und nicht schlecht“ (17). Aber ihre jeweiligen Fixierungen kommen unterschiedlich gut weg: Orale Phase, so ist in „Belästigung durch das Geschlecht“ zu erfahren, bedeute narzißtische, auto- und omnierotische Lust, die keinen Anderen kennt. Ganz ähnlich die anale Phase: „autonomes Vergnügen“, „selbstgenügsame[r] Narzißmus“ (27). Die genitale Phase bereite hingegen „dem kindlichen Primär-Narzißmus den Garaus“ (53). Und damit die Wertschätzung der verschiedenen Phasen der kindlichen Sexualentwicklung so richtig klar wird, werden sie metaphorisch mit der Menschheitsgeschichte analogisiert: „der vorgeschichtlichen, quasi oralen und analen Phase des Menschengeschlechts“ (35) stehen die „raffinierten Genüsse“ (ebd.) der genitalen Phase gegenüber. Nun ist Holger Schatz, so Halbgares er auch sonst schreibt, keinesfalls der einzige, der davon „nicht die blasseste Ahnung“ (53) hat. Bei Freud selber finden sich die genannten Phasen durchaus anders gefaßt. Nicht nur sind sie nach spezifischen erogenen Zonen benannt und damit schon etwas anderes als undifferenziert und omnierotisch, sondern kennen jeweils spezifische Konstellationen aus Selbst- und Fremdbezug . Vor allem aber heißt es zum Verhältnis von Narzißmus und phallischer Phase recht unmißverständlich: „Wenn die Liebesbefriedigung auf dem Boden des Ödipuskomplexes den Penis kosten soll, so muß es zum Konflikt zwischen dem narzißtischen Interesse an diesem Körperteile und der libidinösen Besetzung der elterlichen Objekte kommen. In diesem Konflikt siegt normalerweise die erstere Macht; das Ich des Kindes wendet sich vom Ödipuskomplex ab.“ Auch vor der Kastrationsdrohung regieren nicht allein die Objektbeziehungen: „Die hohe narzißtische Einschätzung des Penis kann sich darauf berufen, daß der Besitz dieses Organs die Gewähr für eine Wiedervereinigung mit der Mutter (dem Mutterersatz) im Akt des Koitus enthält.“ Nicht nur Ich- und Objektlibido sind, gleich in welcher Phase, wechselseitig vermittelt, sondern ebenso genitale und frühere, symbiotische Triebziele. Marzahns und Treptows Gleichung, ohne „glaubhaften Vollstrecker“ der Kastrationsdrohung keine Grenze für den „Größenwahn des primären Narzißmus“ (29f), geht, von allen moralischen Implikationen einmal abgesehen, schon triebtheoretisch nicht auf. Weder lässt sich die ‚genitale Phase‘ einer asozialen Infantilität einfach entgegensetzen, noch stellt diese jenen Naturzustand vor, als der sie beschrieben wird: „Gesellschaft findet“ eben nicht „ein Arsenal von Vorstellungen, Verhaltensweisen, Objektbindungen [!] vor, die ihren Ursprung allein in der ‚inneren Realität‘ haben“ (27) – dergleichen Autarkie ist nirgends. Zwar bezeichnet der Trieb als Grenzbegriff von Psychischem und Somatischem ein Moment des (wie gesellschaftlich auch immer gesetzten) Ungesellschaftlichen, auf das zu beharren notwendig ist. Aber dieses Moment, wie im zitierten Satz, fein säuberlich aufzulisten, macht die Rede ideologisch. Jene, die sich den eindeutigen Bescheid ersehnen, wofür ‚die Gesellschaft‘ und wofür ‚der Mensch‘ verantwortlich ist, verstehen sie allzu gut. Der kindliche Körper steht von Anfang an im libidinösen Fokus seiner Umgebung und konstituiert sich als Subjekt entlang der Rätselfrage, was es im Begehren der Anderen sei . Ausdrücklich widerspricht Freud einer Konzeption vom primären Narzißmus, wie er in der Bahamas vor- und zugleich so schlecht wegkommt: „Es ist eine notwendige Annahme, daß eine dem Ich vergleichbare Einheit nicht von Anfang an im Individuum vorhanden ist; das Ich muß entwickelt werden. Die autoerotischen Triebe aber sind uranfänglich; es muß also irgend etwas zum Autoerotismus hinzukommen, eine neue psychische Aktion, um den Narzißmus zu gestalten.“ In dieser terminologischen Differenzierung drückt sich deutlich aus, daß der Narzißmus nicht bloß zur Objektlibido, wie oben dargestellt, sondern auch in sich vermittelt ist – uneindeutig wie das Ich selber, partikulare psychische Instanz sowohl wie Repräsentant des Ganzen. „Ich ist ein Anderer“ (Rimbaud): Die Liebe richtet sich immer auf ein Bild desselben – auf den Körper, wie er im Spiegel erscheint, und seine glatte Oberfläche, auf ein Ich-Ideal, wie es im Ödipus modelliert wird, oder auf ein Objekt, das als gleiches vorgestellt wird; und manche libidinöse Verästelung führt auch zur Masse und ihrem Führer, dem scheinbaren Gegenteil des Individuellen. Kein narzißtischer Selbstbezug, ob in der Perversion oder im Größenwahn, ist daher einfach die bruchlose Fortsetzung des infantilen Autoerotismus, sondern vielfach verwandelt und Frühkindliches stets neu interpretierend. Die Diagnose ‚Narzißmus‘ über die modernen Subjekte mag daher treffend sein, für sich verrät sie nicht viel; ebensowenig ‚Infantilismus‘. Dahinter kann genauso ein Mensch sich verbergen, der sein imaginäres Ich in Nation und Warenspektakel (oder im autonomen Definitionsmachtmob) veräußert wiederfindet, wie einer, der am Glück einer Kindheit festhält, als seine Wünsche noch etwas galten. Daß sie das bei den wenigsten wirklich taten, macht die Charakterisierung des ungehemmten Größenwahns als infantilen, wie er sich in der Bahamas stetig findet, noch problematischer. In der frühen Kindheit wechseln sich Allmacht und Ohnmacht, unbegrenztes Wünschen und traumatische Versagungen beständig ab. Wer im ÖPNV zusieht, wie Eltern ihre Kinder behandeln, weiß, daß diese kaum guten Grund haben, sich als Nabel der Welt zu begreifen. Nicht sich selber zu mögen lernen sie, sondern den Umgang mit Angst und Hilflosigkeit; die dagegen abschottende Anmaßung, alles stehe einem zu, ist, egal in welchem Alter sie auftritt, wesentlich abgeklärt, ja erwachsen. Wer solches als urtümliche Triebbetätigung auffaßt, schreibt schon, wider alle Kritik am vergesellschafteten Sexus, am Eingriffstitel zur kulturellen Bearbeitung der rohen, ungeschlachten Libido, gleich all den Therapeuten, denen ebenfalls die „Herausforderung des Erwachsenseins“ (35) am Herzen liegt. Auch das macht die Rede von einzuübenden „Grenzen“, gelernter „Grenzziehung“ (30) so unschön ideologisch, wie schon die Wortwahl es anzeigt.
Das (sexuelle) Richtige im Falschen
Ohne affirmatives Bewußtsein ist die blanke Ablehnung des Narzißmus ebensowenig zu haben wie die blanke Bejahung der genitalen Sexualität. „So wie die Partialtriebe, sofern sie nicht genital sich erfüllten, etwas Vergebliches behalten, als gehörten sie einem Stadium an, das Lust noch nicht kennt, so ist die von den als pervers geächteten Partialtrieben ganz gereinigte Genitalität arm, stumpf, gleichsam zum Punkt zusammengeschrumpft. […] In der genitalen Zentrierung aufs Ich und auf die in sich ebenso feste Andere steckt Narzißmus“, heißt es bei Adorno, und Benjamin soll der ‚genitale Charakter‘ an einen blonden Siegfried erinnert haben . Das spricht nicht dagegen, daß phylo- und ontogenetisch erreichte Niveau des Genitalprimats gegen die allgegenwärtigen Regressionen zu verteidigen, zumal in Opposition zu einer Szene, die bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit herunterbetet, Sex ginge ja wohl auch ohne Schwanz. Wohl aber spricht es dafür, genauer zu schauen, was in den katastrophischen Einschnitten, in denen orale und anale Phase untergehen, mit ihnen verlorengeht: Ob das Bild des Schlaraffenlandes allein den „tiefen Widerwillen, aktive Objektbeziehungen aufzubauen“ (35) widerspiegelt oder nicht doch auch, wie immer gebrochen, die Idee des ewigen Friedens. Freud und seine Schüler begriffen die Genitalität als einen genauso erklärungsbedürftigen Tatbestand wie andere Triebschicksale – und doch zugleich als Telos der Heilung, als Norm, die sich allein aus den Abweichungen, den Perversionen, Hysterien und Neurosen, erschließt. Dieses charakteristische Schwanken zwischen Empirie und Ideal findet sich auch in der Bahamas, die von der ‚genitalen Phase‘ spricht, während es bei Freud zwar, nach der Pubertät, eine genitale Sexualität geben kann, aber keine solche Phase; die heißt bewusst die phallische. Der terminologische Bastard schmiedet so einen (mehr oder minder verlässlich dem analen folgenden) Lebensabschnitt, der, da er die Geschlechterdifferenz nicht kennt, kein reines Vorbild abgeben dürfte, mit jenem hohen Ziel einer wahrhaft erwachsenen Sexualität zusammen, von der Freud an mancher Stelle seufzend einbekennt, sie sei als reine, ganz ohne Regressionen, wohl bei keinem zu haben. Beides wird so zusammengebracht – eine Sexualorganisation, die utopisch das mögliche Bessere repräsentiert und doch, zumindest in besseren Zeiten, real existiert. Die stillschweigende Revision dessen, was in den Begriffen mit enthalten ist, folgt zwangsläufig: In seinem theoretischen Kontext ist das Genitalprimat, durchaus schlüssig, verknüpft mit der Propaganda des ‚reifen‘ vaginalen Orgasmus, da der klitoridale den unüberwundenen Penisneid offenbare. Für die Redaktion hingegen ist es vereinbar mit dem Bekenntnis zur „Perversion, der wir manches abgewinnen“ (37). Bei der aber klappt’s nun, ganz freudianisch-orthodox, nicht mit der Integration der Partialtriebe zur genitalen Organisation. Die genannten Widersprüche künden davon, daß es den jeweiligen AutorInnen bei ihrem Unterfangen, sympathischerweise, nicht ganz geheuer war – ganz wie Freud selber, der den Schwulen unaufgelösten Ödipus diagnostizierte und dennoch ihre Triebwahl als legitim zu verteidigen wußte. Sie werfen vor allem aber ein Licht auf die Probleme, überhaupt den Guten unter den psychoanalytischen Termini zu finden. Gilt es, beliebte Frage, die Macht des Ichs zu stärken oder, im Gegenteil, seinen Panzer aufzubrechen und das Unbewußte fließen zu lassen? (Auch aus den Bahamas-Texten lassen sich da verschiedene Antworten destillieren.) Über-Ich – nützlich oder brutal? (Ganz missen mögen es zumindest Marzahn / Treptow nicht, vgl. S. 30). – Letzlich sind solche Fragen falsch gestellt. Statt auf dieses oder jenes bestimmte Triebschicksal, diese oder jene bestimmte Instanz zu setzen, gilt es vielmehr, sich dem Gegenstand zu überlassen. Als in sich entzweite und ganz unmögliche, der festen Begrifflichkeit entfliehende, produziert die Psyche wuchernd Bedeutungen und läßt dabei ihre Potentialität aufscheinen: die grenzenlose Mannigfaltigkeit der Wünsche, von der Freud als „Mycelium“ spricht und die sich gegen jede zwanghafte Identifizierung richtet. Insofern muß ein Johnny Rotten nicht zu den „Sexualpessimisten“ (20) geschlagen werden, bloß weil er Leidenschaften evozierte, die, wenigstens 1977, der Kulturindustrie mehr Rätsel aufgaben als die phallischen der Hippies – genauso, wie man der Genitalität Freuden, animalische wie auskomponierte, abgewinnen kann, ohne den Gangsta-Rappern und ihren Bräuten diese mit dem Verdikt „unüberwundene infantile Sexualität“ absprechen zu müssen, weil deren Variante des Steckkontakts nicht zum Ideal passen will.
Der Phallus als Organ von Lust und Macht
Es ist, die Bahamas sagt es selber, die genitale Sexualität (und damit einhergehend die geschlechtliche Identifizierung) Ergebnis nie allein der Lust, der an der Erregung der Nervenenden ebensowenig wie der an den Anderen. Es ist auch nicht die Bemächtigungstendenz allein, die die Lust aggressiv macht; es ist deren Verquickung mit Angst und Ohnmacht. Das Kind, was den Liebesverlust mehr fürchten muß als alles andere, weil sein Leben daran hängt, Objekt des Begehrens der ihn Pflegenden zu sein, erfährt dunkel, daß diesen ein Genuß offensteht, aus dem es ausgeschlossen bleibt; was es psychisch kaum repräsentieren kann (und darin umso bedrohlicher erscheint), versucht es praktisch, identifikatorisch, anzueignen. Nicht erst die Auflösung des Ödipuskomplexes, die Anerkennung des väterlichen Gesetzes, speist sich aus traumatischer Furcht und durch sie freigesetzte Energien, sondern bereits der Eintritt ins Drama, d.h. das Begehren des gegengeschlechtlichen Elternteils. Abwenden soll es den Schrecken, im Begehren der Eltern vielleicht doch nicht vorgesehen zu sein – und zitiert dabei den neuen Schrecken der Kastrationsdrohung herbei, in dem die geschlechtliche Differenzierung erscheint. Wahr, daß Trauma und Verzicht im (traditionellen) Verlauf der ödipalen Subjektivierung durchs väterliche Gesetz akzeptabel gemacht werden, dem Jungen mehr als dem Mädchen. Nur erschöpft es sich nicht darin, jenem den Zugang zur Objektwelt des Begehrens zu stiften. Der Verzicht auf den unmöglichen, vollen, Angst und Lust verschlingenden Genuß, den inzestuösen am mütterlichen Körper, wird identifiziert als Selbstermächtigung des Subjekts: als Verwandlung symbiotischer Abhängigkeit, ohnmächtiger Bedingtheit in Autonomie und Souveränität, als Transsubstantiation im Zeichen des Phallus und im Namen des Vaters. Ein Tausch findet statt – alle Frauen als mögliche Objekte gegen diese eine – und zugleich alles andere als das: Denn an der Mutter wird nicht nur (qua nachträglicher, unbewußter Deutung) gelernt, was Begehren heißt, sondern auch, was es nicht heißen darf. Fortan wird jeder Wunsch nach dem anderen Geschlecht einen Mangel bezeichnen, ein schlechter Ersatz fürs eigenhändig verratene Glück. Freuds mythischer Urvater steht in „Totem und Tabu“ sowohl fürs Gesetz des Exogamie wie auch, als Grund für den Aufstand der Horde gegen ihn, für die dunkle, unerfahrbare Lust an den verbotenen Früchten – den Weibchen, die ihm allein erlaubt waren. Wie bei den unterlegenen Männchen ist auch beim bürgerlichen Sohn das eine als Antrieb zu Introjektion und Identifizierung vom anderen nicht zu trennen. Der Besitz des Phallus verspricht die väterliche Macht und symbolisiert, als Ziel der Kastrationsdrohung, dessen Verfügungsgewalt über den eigenen, verletzlichen Körper. Nur Unterwerfung darunter weist den Weg aus der überwältigenden Angstlust (frühkindlicher) Heteronomie, die sich zugleich verewigt. Als verworfenes Glück ist diese, verwandelt zum Schreckbild des Verworfenen, dem selbstbewußten, sich zu den Objekten des Begehrens als Subjekt verhaltenden Bürger stets präsent, stets wie zum allerersten Mal niederzukämpfen, um zu werden, was er vorgibt zu sein: autonom. Seiner Befreiung aus feudaler, sumpfiger Naturbefangenheit wiesen Scheiterhaufen den Weg, auf denen die bösen alten Mütterchen brannten; und jedes werdende Subjekt wiederholt im familiären Rahmen solchen geschichtlichen Schlag als Emanzipation aus einer Verstrickung, die fürs Glück nur als unmögliches, Wut erregendes stehen darf. Als gesellschaftlich Unterlegene, deren Macht dem Kleinkind gegenüber realer Schein ist, stehen Frauen als phantasmatisch vermittelte Opfer bereit, wenn Ohnmacht (im Kapitalismus nur allzu gerechtfertigte) Furcht entfesselt und die Sicherheit des väterlichen Gesetzes, die Aufgabe des Begehrens, in Frage stellt. Wie manches des Gesagten ebenso für den geschlechtsidentisch geschmiedeten Subjektpanzer des Mädchens gilt, so sicher auch für vorkapitalistische Zeiten. JedeR, der Mensch sein will, ist verwiesen auf den (immer auch traumatischen) Ausbruch aus der Unmittelbarkeit. Die bürgerliche Organisation des Sprunges in die Individualität aber schöpft die notwendige Energie aus einer unversöhnlichen Konstellation von Eros und Thanatos, aus Machtgefällen, in die die Libido eingeschrieben wird – und zu deren Darstellung es nicht zuletzt eines asymmetrischen Geschlechterverhältnisses bedarf: als Repräsentantin bedrohlicher, unüberbrückbar Differenz und als Reservoir phantasmatischer Inszenierungen, deren bedeutendste eben die Verwandlung verschlingender Allmacht in phallisch beherrschbare Ohnmacht ist. Daß in postbürgerlichen Zeiten sich an diesem Verhältnis wie überhaupt in den Familien einiges ändert, braucht keine lange Diskussion. Bezeichnend jedoch, was fast ausnahmslos sich durchhält (und von der Bahamas verschämt verschwiegen wird): die Mutter als primäre Bezugsperson – und damit die Voraussetzung dafür, daß die Frau das Symptom des Mannes bleibt (und, vielleicht, auch der Frau, die selber schließlich Wünsche in und aus der Abhängigkeit zu verschieben hat). Marzahn / Treptow analysieren überzeugend die Mutter als Repräsentantin des Lustobjekts wie des Verbots und benennen die Misogynie, die so erzeugt wird. Die dringliche Frage, wie dieser Befund sich zur Diagnose vom Verschwinden der Geschlechter verhält, stellen sie leider nicht.
Das echte und das unechte Patriarchat
Das Geschlechterverhältnis als System, Unmögliches zu verbinden und Widersprüchliches zu vereinheitlichen, produziert dabei stets neue Widersprüche und Unmöglichkeiten; und die Gefahr besteht, einzelne Momente triumphierend gegen andere auszuspielen – ob im Verweis auf Täter- und Opferidentitäten oder in der theoretischen Kritik dieses Konzepts. Natürlich stellt, beispielsweise, ein Vergewaltiger nicht den Idealtypen des Patriarchen dar, sondern erweist sich in der Regel als jämmerlicher Kaputtnik – ohne daß doch viel gewonnen wäre, wie in der „Infantilen Inquition“ sexuelle Gewalt geschlechtsneutral als „Ausdruck des gesellschaftlichen Unglücks der warentauschenden Gesellschaft“ zu fassen. In ihr verwirklicht sich vielmehr der Exzeß, der das Gesetz des Vaters überschreitet und als illegitimer Surplus-Genuß diesem doch zu Grunde liegt: individuell, indem die Identifikation mit dem allmächtigen, unheimlich-lustvollen Aggressor wider die Mutter überhaupt erst die Anerkennung des Gesetzes (notfalls immer und immer wieder) bewirkt ; und gesellschaftlich, indem die guten Jungen einen ehrbaren Grund haben, ihre Mädchen schützend nach Hause zu begleiten. Das ausschließende und dennoch komplementäre Verhältnis von Ordnung und Exzeß bestimmt das Bild, das die Geschlechter abgeben – und vielleicht auch die Wahrnehmung des Endes der Ungleichheit, des Verschwindens des Patriarchats. Die Diagnose der Bahamas leitet sich vor allem aus dessen geschichtlicher Überholtheit ab: Dank des Werts sei die patriarchale Autorität ausgehöhlt, entsubstantialisiert. Wann aber war das je so ganz anders? Jedes Verhältnis, das auf Tradition verweist, eignet per se ein Flair, nicht up-to-date zu sein. Jeder Mann hat den Namen des Vaters, der ihm Autorität verleiht, nur vererbt bekommen, und sein Vater ebenso; und keiner könnte je einem phantasmatischen Urpatriarchen das Wasser reichen. Immer ist dieser in ihm nicht voll anwesend, macht ihn klein und häßlich – wie z.B. die Figuren in Maupassants Novellen, die gründlich mit der Vorstellung aufräumen, selbst in den Zeiten von Kafkas Vater hätte eine irgend relevante Anzahl „Schwerenöter und wilde Männer […], hemdsärmelige Patriarchen“ (33) existiert. Immer schon war jeder Mann, jede Frau es gleichsam nicht ganz ‚in echt‘. Auf den Besitz des Phallus den Anspruch aufzubauen, die ganze, allgemeine (und ergo geschlechtslose) Menschheit zu repräsentieren, wie ihn so viele Sprachen dokumentieren – welch ein aussichtsloses Unterfangen! Und wie der Mann, der ein ganzer sein will, unvermittelt in den kühlen Kopf und den wilden Hengst auseinander fällt, der alles im Griff hat und dabei T-Shirts trägt, auf denen mit Pfeil auf den Schwanz gedruckt steht: „Ich will nicht, aber er will“ – so schließen sich die Bilder, was eine Frau zu sein hat, stets und immer wieder gegenseitig aus, triebhaft und tugendsam, unwillkürlich naturnah und listig beschlagen, Herrin des Privaten und Schlüsselfigur öffentlicher Anliegen (ob als Spenderin des guten Betriebsklimas oder des hochwertigen Nachwuchses für den Volkskörper). Die Unmöglichkeit, mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinzustimmen, ist kein Zufall, sondern Programm. Wie oben angerissen, verläuft die kontrafaktische Behauptung der Subjektivität über die Engführung der Geschlechtlichkeit, die fortan, wie die Karotte vor der Nase, das Subjekt umtreibt – real die Spaltungen produzierend, die es als Phantasma der Ganzheit zu heilen verspricht. Wie Freud einmal schrieb, ist es der basale Widerspruch des Knaben, daß er männlich nur wird, indem er, im Ausgang des ödipalen Dramas, auf die Ausübung der Männlichkeit verzichtet. Diese Struktur aber erhält sich auch nach der Latenzphase, nach der es mit dem Verzicht nicht zu Ende ist, und ebenso nicht beim Knaben allein. Im Geschlechterverhältnis lernt das bürgerliche Subjekt zu integrieren, was nicht zu integrieren ist. Daher besagt es nichts gegen sein Fortbestehen, wenn die Rollenanforderungen sich vervielfältigen, wie es im Zeitalter der totalen und total widersprüchlichen Vergesellschaftung geschieht, in der auch Männer als Kunden der Reproduktionsindustrie, auch Frauen als Lohnarbeiter, auch Gefühle in der Öffentlichkeit gefragt sind. Der Zwang zur phantasmatischen Ganzheit mag steigen, die Subjekte taumeln lassen, aber kaum ihr Bilderreservoir, ihre Praktiken der geschlechtlichen Identifizierung in Frage stellen, sondern eher noch zwanghafter ans Herz legen. Gerade die Unfähigkeit, ein Auto zu reparieren oder einer Dame die Tür aufzuhalten, speist den Drang, als ganzer Kerl zu gelten, ganz im Einklang mit jenem mächtigen Traditionsstrang, gegen jede Logik so zu tun, als ob. Man schaue nur auf die Love-Parade, Inbegriff des angestrengten Narzißmus, und auf die eindeutig männlichen und weiblichen Körper, die dort ausgestellt werden und nur die Kritiker ahnen lassen, daß sie zueinander nicht kommen können.
Das obszöne Antlitz der Tyrannei
Genauso fraglich, ob die substanzlos gewordene väterliche Autorität verschwindet – oder nicht vielmehr in einer Konstellation der willkürlichen Tyrannei verharrt, wie sie Horkheimer & co in den 30er Jahren analysierten. Damals hatte die Tatsache, daß der Überhang des Objektiven den Einzelnen demonstrierte, wie wenig sie zu sagen haben, ja nicht etwa dazu geführt, daß sie als pater familias die Klappe hielten. Vielmehr zogen sie ein die Ohnmacht kompensierendes Regiment auf, gegen das Frau und Kinder nur rebellierten, um eine stärkere Macht zu installieren – die aber wiederum, ob faschistisch oder kulturindustriell, die Familie ideologisch ins Recht setzte. Der double bind bindet die Subjekte am besten – und die prekäre, nicht ganz geglaubte, gerade darum aber schrankenlose, nicht rationalisierbare und so auf Rationalität gleich ganz verzichtende Macht, wie sie der degradierten und zugleich verklärten Familie innewohnt, ist dem postbürgerli-chen Kapitalismus die angemessenste, die, die einen fürs Leben lernen läßt. Mag auch 68 in einigen Familien der bis dato vorherrschende Prügelfaschist samt dazugehörigem Mutterideal abgelöst worden sein, so sollte eine Untersuchung, was an die Stelle getreten ist, sich nicht allzusehr blenden lassen von Vätern, die schweigen statt schlagen. Vielleicht ist es nicht immer Hilflosigkeit, sondern das aktuelle Gewand des Tyrannen: die aggressive, die böse Gleichgültigkeit, die dem Kind alles andere als egal sein kann, weil es seine Ohnmacht, mit Worten etwas ausrichten zu können, demonstriert bekommt, bis es schließlich begreift, daß nur das Messer helfen kann. Gerade die Psychoanalyse könnte darüberhinaus lehren, daß es auf ein tatsächliches Verhalten der Repräsentanten der Männlichkeit allein nicht ankommt; daß also der noch so abgefuckte oder gar abwesende Vater nicht einfach behavioristisch seine Nachkommen prägt, sondern stets durch deren Wünsche, Phantasien und psychischen Zwänge vermittelt ist. Der imaginäre Vater, das Liebesobjekt, der symbolische Vater, der Gesetzgeber, der traumatisch-obszöne Vater, der kastrierende Konkurrent, entstammen allesamt nicht einfach der Erfahrung. Gleiches gilt für die „Muster für ‚Weiblickeit‘“ (29), die nicht einfach verschwinden, bloß weil Muttern statt Kleidung zu reparieren Fertiggerichte aufwärmt. Wer schwärmen will, wird sich später an die tollen Batikkissen erinnern, für die dank Mikrowelle so viel Zeit war, während der (und auch die) Misogyne gerade jene Dequalifizierung als Überlegenheitsbeweis des Mannes interpretieren kann. Daß in der libidinösen Ökonomie eine Leerstelle für Platzhalter der männlichen Autorität weiterhin vorgesehen ist, gestehen Marzahn / Treptow zumindest Mädchen zu – ohne allerdings zu erklären, warum zwar „etwaige Lebenspartner, Geliebte der Mutter“ oder der „große Bruder“ (31) sie ausfüllen könnten, nicht aber der Vater. All diese Figuren eint sicherlich ihr leicht illegitimer Charakter, der klare Ordnungen in Frage stellt; nur trägt (in den von Freud analysierten Schlagephantasien zum Beispiel) der Vater selber dieses Gesicht, das des obszönen Doubles des Herrn. Züge des Grausamen trägt, vor allem hierzulande, fast jeder, und seien es jene jämmerlichen, die im symbiotischen Zugriff aufs wehrlose Schutzbefohlene, das den einzigen Lebenssinn seines Erzeugers zu verkörpern hat, in Erscheinung treten. Entgeht diesem (oder dieser) aber wegen Scheidung die dauernde leibliche Präsenz, wird das kaum das Wuchern der väterlichen Wünsche drosseln, aber die kindliche Phantasie, kulturindustriell gestützt, zusätzlich anregen. Das Geheimnis macht das Obszöne erst so recht zum Unheimlichen. Das in der Dyade mit der Mutter verbundene Kind bleibt, als Alternative zur manifesten (und gesellschaftlich höchst dysfunktionalen) Psychose, verwiesen auf den Dritten, welch bösartige Null er auch immer darstellen mag, um die Zweieinigkeit in Frage zu stellen und Handlungsmächtigkeit zu erlangen – und so auf die Grundbedingung asymmetrischer Geschlechterverhältnisse. Daß dieser obszöne Andere, immer schon im klassischen Patriarchen enthalten, zugleich die klaren Ordnungen transgrediert, als einer, der selber neue Symbiosen schmiedet, klassisch weibliche Züge trägt, verstärkt nur die Not, den geschlechtlich eindeutigen Panzer zu schmieden, der in den elterlichen Wünschen weiter nachhallt. Aufgeladen mit Aversion war die heterosexuelle Zuneigung schon immer; kein noch so wortgewaltiger Verehrer des schönen Geschlechts hätte selber ‚weibisch‘ wirken mögen. Die einzuhaltende Distanz wird umso größer, je bedrohlicher die Vorstellung wird, das andere Geschlecht könnte zu nahe kommen und dabei offenbaren, dass es so anders nicht ist. Die dämonische Zweideutigkeit zwischen Anziehung und Abwehr wird schließlich aufgelöst, um Platz zu schaffen für den Genuß am gewalttätigen Akt, der allein noch die Differenz zu setzen (und in ihrer ungebrochenen symbolischen Bedeutsamkeit zu bestätigen) vermag: als Identifikation, wer von wem etwas zu erleiden hat. Je brutaler dabei vorgegangen wird, desto mehr bewährt sich in der Rollenverteilung die Kraft der Tradition.
Der Wert und Das-Verhältnis-formerly-known-as-Patriarchat
So wenig, wie die Behauptung einer vollständigen repressiven Gleichheit der Geschlechter überzeugt in einer Welt, in der zwar Frauen Hosen zu tragen sich trauen, nicht aber Männer Röcke, so wenig überzeugt auch die These, die „Herrschaft des Vaters […] wurde durch die Herrschaft des Werts ersetzt.“ (29) Als Schein entpuppt sich die Alternative bereits, wenn andernorts, in „Über Wüstlinge…“, das Patriarchat für die Zeit Beauvoirs um 1950 als existent anerkannt wird: Wie war’s damals wohl um den Wert bestellt? Heute hingegen, so konkretisiert sich die These, habe er seine Vorherrschaft, die jene des Vaters ablöst, angetreten qua „Herrschaft der Gesetze, der Normen und des Leistungsprinzip, an dem ein Jeder sich tagtäglich auf dem Arbeitsmarkt messen lassen muß.“ (30) Jeder, möchte man schüchtern fragen – da es im genannten Abschnitt doch um Kinder in der Familie geht? So versinnbildlichen sich die Jüngsten also das Ensemble verrückter Formen: als Normen, Gesetze und Prinzipien? Auch für die Phantasiebegabtesten bleibt der Wert unsichtbar, nirgends begegnen sie unmittelbar der abstrakten, depersonalisierten Autorität des Kapitals, die schließlich Rekonstruktion des Kritikers ist. Auch im Kindergarten schimpft nicht die Gesellschaft, sondern der Erzieher oder die Erzieherin; auch im Straßenverkehr muß eine Autorität aus Fleisch und Blut die abstrakte der Verkehrsregeln durch- und ersetzen, wenn sie das vors Auto laufende Kind am Schlawittchen packt. Gerade die integrale Durchorganisation des vorschulischen Lebens erfordert ein Mehr, nicht ein Weniger an personaler Herrschaft über die Kinder. Kollektiv statt Vater, Fernsehen statt Vater, großer Bruder statt Vater – alles denkbar. Nur nicht Wert statt Vater. Damit ist freilich nicht das Gegenteil bewiesen, daß der Wert und das phallisch signifizierte Geschlechterverhältnis notwendig und systematisch sich bedingen. Es mag Zufall sein, daß ein bürgerliches Subjekt zu werden bis heute verschränkt ist mit der geschlechtlichen Identifizierung und Differenzierung; doch sprechen mehr als nur die formidabel herrschaftlichen double binds, die vorbildliche Einübung des Opfers dagegen. An der Wertabspaltungs-Theorie von Roswitha Scholz und der ‚Krisis‘ ist manches zu kritisieren, zuvörderst die Rückführung von allem und jedem auf Dichotomien analog der von Mann und Frau, Kultur und Natur, Öffentlichkeit und Privatheit, die weniger erklären denn Phantasmen von Yin und Yang fortschreiben. Und doch ist der Verweis darauf, daß die Ordnung der Geschlechter dahin vordringt, wo andere ideologische Praktiken nicht ankommen, nicht von der Hand zu weisen. Gedacht ist dabei nicht nur an schnöde Handfestes wie die Reproduktion der Arbeiterklasse, sondern auch an die vielen Lücken, die das Kapital, freie Individuen aus sich setzend, offen lassen muß: zwischen Arbeitskraft und Arbeitsvermögen, zwischen Wünschen und Zwängen der Reproduktion, zwischen der Autonomie und der Unterwerfung unter die Gesetze des Kapitals. Die Geschlechtlichkeit und ihr Begehren ist ein Überschuß an Freiheit, den die Notwendigkeit des Werts erheischt, um Notwendigkeit zu sein: die Aneignung der Verhältnisse als die eigenen. Dem Sinnlosen wird Sinn abgerungen, wie beim Arbeiten und Einkaufen um der werten Gattin oder der Kinder willen, und die Existenz in einer Welt geadelt, die zum kalten Unbill einen warmen Gegenpart bereitstellt: zur perversen Selbstbezüglichkeit des Geldes die heterosexuelle, naturgemäße Liebe, zur invarianten Zeit die unendlichen Zyklen der Vorfahren und Nachkommen, zur Allgegenwart der toten Arbeit die lebendige Beziehung; in einem Wort: zur abstrakten Zivilisation die konkrete Idylle. Wie inhaltlich gefüllt die geschlechtliche Morgengabe der Freiheit ist, ist dabei im einzelnen sekundär; entscheidend ist jene Struktur aus Gesetz und Exzeß, der erzwungen ist, nur um unweigerlich wieder zum Gesetz zurückzuführen – und das bleibt das der herrschenden Ordnung. Je sicherer das geschieht, umso besser, nicht nur für den Wert, sondern auch für seine Subjekte, die exzessiv frei sich fühlen und doch von den schwindelerregenden Abgründen der Freiheit befreit, die sich ihnen präsentieren im begehrlichen Schwanken zwischen Mangel und Unmöglichkeit; und nicht die letzte an- und zurücktreibende Aporie ist die kapitale Bewegung, die Geschlechtsidentitäten aufzulösen und zugleich immer wieder neu hervorzubringen. Gut möglich, daß für diese Bewegung die Bezeichnung „Patriarchat“ unzutreffend ist, insofern in ihm Assoziationen von einfacher Männerherrschaft, aber auch ganzer Kerle mitschwingen. Nur herrscht in den Beiträgen der Bahamas die Tendenz, nicht etwa einen besseren Begriff für ein Verhältnis zu suchen, dessen Existenz, im Ganzen zumindest, ja gar nicht bestritten wird, sondern es bei jener Feststellung zu belassen: „‚Strukturell‘ ist also gar nichts und trotzdem erfahren Frauen nur allzuoft aggressive Anmache.“ (34) – Punkt, Absatz, nächstes Thema. Oder, besser noch, eine Ausgabe zuvor, in „Grundprinzip: Wertabspaltung“: „Behauptete man, diese tatsächliche Diskriminierung [der Bezahlung von Frauen in der Produktion] sei Ausdruck eines patriarchalen Verhältnisses, müßte man es auch Sklaverei nennen, wenn Schwarze in den USA im Durchschnitt weniger verdienen und zu höheren Anteilen arbeitslos sind als Weiße.“ (Nr. 33 / S. 50) Nun, manch einer würde im Falle der Schwarzen vielleicht nicht von Sklaverei reden (warum auch?), wohl aber von Rassismus. Und keiner würde sich von der Verwendung dieses Begriffs abbringen lassen durch Verweise, die Ungleichheit sei Effekt repressiver Vergleichung, sei das zombiehafte Weiterleben längst aufgelöster naturhafter Konkurrenz zwischen den Stämmen. Bei dem Versuch, eine gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen zu benennen, soll Gleiches ein Einwand sein; und um es zu sein, müssen die Autoren selber trennen zwischen wahrem und scheinhaftem Patriarchat, bis es ideologisch wird: „Der Mann […] wittert eine Chance darin, in Zeiten der Krise die Neuankömmlinge auf dem Markt auf die alten Plätze zurückzuverweisen. […] Gerade die universelle Gleichheit produziert das, was sie soeben abgeschafft hat, aus sich heraus neu. Die historisch und praktisch überlebten Geschlechtsidentitäten erscheinen, als wären sie taufrisch.“ (38) Mal abgesehen davon, ob das empirisch immer stimmt (für die Zone samt ihrer Tradition der Frauenberufsarbeit, die jetzt gekappt wird, haut’s nicht so gut hin) – wann in Marxens Namen war die Ungleichheit der Geschlechter abgeschafft, um dann wieder eingeführt zu werden? Oder ist das, was erscheinend sich gleich blieb, von einem Moment zum anderen aus der Angemessenheit ins Substanzlose umgeschlagen? Verschwindet in solchem Gedanken nicht allzu sehr, daß es für Herrschaft, so lange sie sich perpetuiert und also zu ihrer eigenen Abschaffung nichts beigetragen hat, mal bessere und mal schlechtere, aber keine guten Gründe geben kann? Wozu das lineare, immer der Rationalisierung verdächtige Geschichtsbild, in das der proletarische Zwang zur Lohnarbeit für beide Geschlechter zu Beginn des 19. Jahrhunderts ebensowenig passen will wie die in den darauffolgenden Jahrzehnten von den Gewerkschaften erkämpfte und ergo durch und durch kapitalistisch subsumierte Innovation des Familienlohns, der Frauen endlich zu Hause Reproduktion betreiben ließ? Wer in unseren Kreisen von Rassismus, von Antisemitismus redet, weiß, daß es sich um vom Kapital konstituierte sekundäre Archaismen handelt, die gerade darum gesellschaftlich substantiell sind, und kennt die Differenz zu ihren vor- und frühmodernen Vorgängern, dem Antijudaismus beispielsweise, ohne diese Differenz absolut zu setzen. Das sollte doch fürs bürgerliche asymmetrische homophob-misogyne-zwangsidentitäre Geschlechterverhältnis auch möglich sein, das treffende Wort vorausgesetzt. Wenn’s „Patriarchat“ nicht ist und „Sexismus“, weil individuelles Verhalten betreffend, genausowenig, dann halt ein anderes. Vorschläge werden dankend entgegengenommen.
Les Madeleines, Dezember 2002