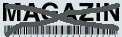Note zum Aufruhr in Hongkong und zu einem Interview mit Anarchisten dieser Stadt
 Direkt zum Interview mit den Anarchisten aus Hongkong
Direkt zum Interview mit den Anarchisten aus Hongkong
Hongkong, dieses Drehkreuz für internationale Konzerne und Banken, wird von einer Welle teils sehr turbulenter Proteste gegen ein neues Auslieferungsgesetz heimgesucht. In deren Verlauf wurde etwa eine Polizeiwache belagert und mit Eiern beworfen oder das allerdings leere Parlament gestürmt und dort medienwirksam die Flagge des untergegangenen britischen Kolonialreiches gehisst. Überhaupt war immer wieder die halbe Stadt auf den Beinen, um gegen die Zumutungen des chinesischen Staats zu protestieren. Die freie Presse ist um diesen Standort besorgt. Dessen „Fundamente“, schreibt die NZZ, „könnten erodieren“, nämlich „wenn die Gewalt nicht bald ein Ende findet, – aber auch, wenn Investoren aus dem Ausland den Eindruck gewinnen, Peking übernehme immer mehr die Kontrolle in Hongkong.“ Ähnlich doppelt argumentiert Joe Kaeser, in seiner Funktion als Anführer von Siemens, aber wie er sagt „auch als deutsche Wirtschaft“. Er insistiert, „dass nochmal gut verstanden wird, dass es für uns ja sehr wichtig ist, dass erstens die Stabilität da wieder da ist, dass fast 700 deutsche Unternehmen dort auch geregelten Geschäftsinteressen nachgehen können. Oft ist Hongkong ja auch der Brückenkopf hinein in das, wie es so schön heißt, mainland china. Deshalb ist das von ganz besondere Bedeutung.“ Trotz dieser Absage an den liberalen Protest bangt auch er um den Sonderstatus dieser aus britischem Besitz in die Klauen Chinas entlassenen Provinz. Aber da er die Kräfteverhältnisse kennt, deutlich verhalten und mit dem Hinweis, Deutschland solle „seine moralischen Werte und Interessenlagen auch immer ganz besonders abwägen“. Wegen der Arbeitsplätze. Trump hat derweil die Proteste öffentlich zu einer inneren Angelegenheit Chinas erklärt, nur sein Kabinett krakeelt ein wenig gegen China.Allen Voran John Bolton, aber der wurde gerade wegen außenpolitischer Differenzen entlassen. Und natürlich krakeelt unsere Bildzeitung, dieses fiktive Organ der alten, liberalen Welt. Soll ja niemand glauben, dass der westliche Imperialismus seine Macht gerne schwinden sieht.
Solche innerimperialistischen Konflikte sollen uns aber einstweilen nicht bekümmern. Interessanter ist die Bewegung selbst. Daher hier eine Übersetzung eines Interviews, geführt vom Netzwerk CrimethInc – das 1999 rund um die Unruhen in Seattle zu einigem Ruhm kam –, mit einigen Anarchisten aus Hongkong. Bei aller Sympathie und einer allgemeinen Lust am Zunder reden diese offen von der den Protest beherrschenden „Idee der Staatsbürgerschaft“ und der „nationalen Gemeinschaft“, die sich etwa darin äußerten, dass die Bürger dieser Stadt nun noch mehr von diesen „Ich bin Hongkonger, nicht Chinese!“-T-Shirts trügen und sich schon durch ihre ererbte westliche Lebensart einbildeten, freie Menschen zu sein, während ihnen doch auch in einem von China befreiten, aber kapitalistischen Hongkong „das Leben durch seelenlose Jobs geraubt“ würde, sie den alltäglichen mit „Klauen und Zähnen geführten Kampf ums Überleben“ bejahten und immer höhere Mieten zahlten. Es komme dabei gar nicht darauf an, ob die Mehrheit in diesem Protestzyklus noch den offiziellen Organisationen des Protests anhänge oder der Protest solchen Organisationen entglitten wäre, vielmehr sei der Inhalt einer solchen Bewegung „per Default populistisch“. Obwohl „ein Großteil unseres Lebens mit Arbeit beschäftigt ist und von ihr verzehrt wird, wagt es niemand, die Verweigerung der Arbeit vorzuschlagen, um sich der Demütigung zu widersetzen, als Produzent-Konsument unter der Herrschaft der Ware behandelt zu werden.“ Die Polizisten werden von den Protestierern angeklagt, „Laufhunde eines bösen totalitären Imperiums zu sein“, nicht aber dafür, „was sie tatsächlich sind: die Fußsoldaten des Eigentumsregimes“. Überhaupt wäre die Bewegung von „Paranoia“ geprägt und über die stets übertrieben dargestellten „tatsächlichen Auswirkungen des neuen Gesetzes“ gäbe es keine klare Meinung. Unsere Hongkonger Anarchisten bleiben daher distanziert und kritisch gegenüber der großen Bewegung. Es bliebe ihnen „als Kollektiv nur übrig, nach Wegen zu suchen, diese Fantasiegebilde zu untergraben, ihre Leere an Form und Inhalt aufzudecken und vorzuführen“. Die Verleugnung der sozialen Brüche durch die große Menge der Protestierer verleihe „der Vorgehensweise, bei aller Radikalität und Dezentralität der neuen Aktionsformen, einen ausgesprochen konservativen, reaktionären Geschmack“. Seltsam sei dabei der Ausfall jeder wirklichen Reflexion. Alle seien sich so „sicher und klar darüber, was sie tun müssen – sich diesem Gesetz mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu widersetzen –, während die Gründe dafür hoffnungslos dunkel bleiben“. Aber das sei vorerst das Los jeder keimenden Bewegung, „in dieser Phase, die auf mehr Handeln und weniger Reden beruht“. Und so rufen sie dazu auf, stets in solchen Scharmützeln mitzutun und „akzeptieren die Turbulenzen und die Misere unserer Zeit und die Notwendigkeit in Umstände einzugreifen, die wir niemals selbst gewählt haben“. Denn so „trostlos die Sache auch erscheinen mag, dieser Kampf bietet eine Chance für neue Begegnungen“. Und das chinesische Regime mögen diese braven Oppositionellen bei all ihrem Misstrauen gegen diese liberal-nationale Bewegung nun wirklich auch nicht.
Als die Übersetzung des Textes fertig war, kursierte schon eine andere Übersetzung desselben Textes. Die ist im Grunde gelungen und die Arbeit war redundant. Hier wird dennoch die neue Übersetzung genommen – und sei es, weil die Mühe nun einmal gemacht war. Sie folgt ein wenig mehr dem Originaltext als die bestehende Übersetzung. So bleiben „protesters“ „Protestierer“ und werden keine „Demonstranten“, „Marches“ bleiben „Märsche“ und werden keine „Demonstrationen“. Kann sein, dass der Lesefluss dadurch manchmal beeinträchtigt wird, da der einheimische Leser diese Worte ungewöhnlich findet. Mag sogar sein, dass Marsch eine Übertreibung ist, wenn man diese Massenspaziergänge in Hongkong sieht, aber das ist eher ein Problem des Originals. Auch wurden schöne Worte wie „chastise“, „scrambling“, „bellicose“, „chuckle“ oder „hustle“ nicht durch willkürliche und oft glättende Substitute übersetzt. Das muss nicht immer stimmen, weil Leo manchmal auch dummes Zeug ausspuckt. „Working stiffs“ wird z.B. hier als „arbeitende Leichen“ übersetzt. Jedenfalls besser als Pendler, wenn auch im Grunde synonym. Auch wurde auf Übersetzung der Grammatik nach Möglichkeit verzichtet und lieber die deutsche Grammatik gespreizt. Ansonsten wurden viele eigene Stilblüten durch die besseren Formulierungen der anderen Übersetzung ersetzt und auf die leidige und pseudointegrative Zerhackung der Subjekte verzichtet, die sich die naive Linke hierzulande angewöhnt hat und die zu allem Überfluss geradezu ihr Markenzeichen geworden ist, indem nun überall und immer die Geschlechter diskriminiert werden, ob es eine Rolle spielt oder nicht. Aber das alles gibt sich nicht viel, da beide Übersetzungen den Inhalt richtig wiedergeben.
Der Übersetzer