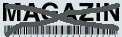Klaus Laermann
Kneipengerede – Zu einigen Verkehrsformen der Berliner „linken“ Subkultur
I
In Westberlin hat sich seit einigen Jahren eine in Europa einmalige »linke« Kneipenkultur entwickelt. Keine der großen europäischen Städte, weder Amsterdam, noch Rom oder London, und auch keine westdeutsche Universitätsstadt, weder München, noch Heidelberg oder Düsseldorf, kennt etwas Vergleichbares.
Das kann seinen Grund nicht allein darin haben, daß die Linke in Berlin zahlenmäßig stärker ist als anderswo, daß hier Läden relativ billig zu mieten sind und daß es keine Polizeistunde gibt. Auch daß man aus Berlin nicht schnell mal raus kann, kein Hinterland als Naherholungsgebiet zur Verfügung hat und also auf Fluchtpunkte in der Stadt angewiesen ist, kann als Begründung für diese Entwicklung nicht ausreichen.
Auffallend ist vielmehr, daß die Ausbreitung der Kneipenkultur einhergeht mit dem Niedergang der Studentenbewegung. Gab es 1968 nur den heute fast legendären »Schotten«, in dem man sich nach den großen Demonstrationen und Teach-ins traf, so ist die Zahl der »linken« Kneipen auch von Kennern der Szene heute kaum mehr zu schätzen. Sie muß weit über Hundert liegen.
Die Kneipe hat seit der Zeit der Studentenbewegung die Verkehrsformen der Berliner Subkultur mindestens so stark geprägt wie die politischen Gruppen und die Wohngemeinschaften. Sie ist zu einer Institution geworden, die (weil sie als solche nicht gilt) ihre normative Kraft unbemerkt entfaltet. In ihr verkehrt das politische Reservoir der vielfach zersplitterten Linken, aber es ist höchst fraglich, ob sie selbst links ist.
Immerhin wird sie von manchen so genannt. Sie reden von »linken Kneipen«, ohne zu sehen, wieviel Unpolitisches oder manifest Reaktionäres sie in eine solche Bezeichnung miteinschließen. Recht aber haben sie zumindest darin, daß die mit der Studentenbewegung entwickelten Verkehrsformen der Neuen Linken, ihre Spontaneität, ihre Freundlichkeit und ihre Toleranz Abweichungen gegenüber, das Verhalten der Leute Kneipen entscheidend bestimmt haben. Mittlerweile in den jedoch ist es schwer zu unterscheiden, wie weit die Linke, die einst diese Mode prägte, nicht selbst zur Mode geworden ist.
II
Wer eine der vielen Kneipen der Berliner Subkultur betritt, ist zunächst irritiert durch eine gewisse Unübersichtlichkeit des Raumes. Denn er kann nicht, wie es in Gaststätten sonst oft möglich ist, von der Eingangstür aus mit einem Blick sehen, wer da ist, sondern er muß, um das festzustellen, erst einmal in die Kneipe hineingehen. Aber er wird für diese leichte Irritation dadurch entschädigt, daß er nicht die bei »bürgerlichen« Lokalen übliche Schwellenangst überwinden muß. Er empfindet nicht das leise Zögern vor dem leeren Raum, den er durchqueren muß, um sich einen Platz zu suchen, während er von allen Seiten angestarrt wird. Er geht entweder rückwärts wieder raus oder er ist gleich mitten drin. Denn es gibt in der Kneipe keinen »leeren« Raum, und wenn es ihn gibt, ist er nicht die scheinbar unüberwindliche Distanz, mit der der Bürger sich in der Öffentlichkeit vor seinesgleichen und dem Rest der Menschheit schützt.
Charakteristisch für die Kneipe ist vielmehr eine gewisse Enge, ein Platzmangel, der es nötig macht, daß immer einige Gäste stehen müssen. Wird diese Enge nicht zumindest stundenweise erreicht, ist eine Kneipe nicht mehr »in«, wirkt langweilig und verödet. Es gibt meist Sitzplätze, aber keine Sitzordnung, die die einzelnen Tische deutlich voneinander trennt.
Wer allein ins Restaurant geht, setzt sich allein an einen Tisch und bleibt allein. Wer dagegen allein in die Kneipe kommt, setzt sich entweder zu anderen, die er kennt beziehungsweise kennenlernen möchte, oder er steht irgendwo herum, bis er jemanden gefunden hat, mit dem er sich eine Weile unterhalten kann.
Wie bei anderen Gaststätten ist die Theke der zentrale Ort innerhalb der Kneipe. Sie nimmt meist ein Viertel des ganzen Raumes ein. Im Unterschied zu anderen Lokalen aber muß, wer in der Kneipe steht, nicht unbedingt an der Theke stehen. Vor ihr bildet sich oft eine zweite und dritte Reihe aus Gästen, die in kleineren Gruppen miteinander reden, sich dann wieder anderen in anderen Teilen des Raumes zuwenden oder sich entfernen. Es herrscht ein so hohes Maß an Mobilität, daß man den Eindruck gewinnt, der ganze Raum der Kneipe sei zur Theke geworden. Kaum jemand von denen, die stehen, hat einen festen Platz, sondern jeder wechselt mehrmals seinen Standort.
Der hohen Mobilität innerhalb der Kneipe entspricht eine große Fluktuation der Gäste. Wenige nur kommen, um bestimmte Leute zu treffen, mit denen sie verabredet sind; die meisten schauen einfach mal rein und wollen eben nur allgemein »Leute« treffen. Passen ihnen die, die da sind, nicht, gehen sie in die nächste Kneipe. Denn ihnen ist es weniger wichtig, daß sie jederzeit kommen können, als daß sie jederzeit wieder gehen können.
Die Zusammensetzung der Gäste variiert zwischen den einzelnen Kneipen. Obwohl sie insgesamt erstaunlich homogen ist, hat jede von ihnen gegenüber jeder anderen leicht veränderte Standards. Sie werden durch das Kneipenpersonal gesetzt. Es entscheidet zwar bei den relativ selten auftretenden Tätlichkeiten über ein Hausverbot für bestimmte Gäste, aber es nimmt seine Selektionsfunktion zumeist wirksamer dadurch wahr, daß es sich mit einigen Gästen, die dann auch häufiger kommen, auf kürzere Gespräche einläßt und mit den übrigen nur das Nötigste redet. Dadurch hat jede Kneipe neben der Laufkundschaft ihre Stammkunden.
Mit dem Altern der »linken« Subkultur haben sich in Westberlin zwei Arten von Kneipen herausgebildet. Es gibt eine billigere für die 18- bis 25jährigen, die in der Regel unverheiratet sind, und eine teurere für die 25- bis 35jährigen, die über gehobenere Ansprüche bzw. mehr Geld verfügen und meist so aussehen, als seien sie bereits geschieden. Oft ist diese zweite Art von Kneipen von Leuten eingerichtet worden, die mit der ersten soviel Geld verdient haben, daß sie es vor dem Finanzamt in Sicherheit bringen mußten. Es sollen, einem Branchengerücht zufolge, unlängst für ein Lokal, das allerdings in erster Linie als Touristenfalle dient, 750 000 DM aufgewendet worden sein.
Am Altern der Subkultur und an der beschriebenen Zweiteilung des Kneipenmilieus läßt sich ein weiteres Charakteristikum der Berliner Szene ablesen. Offenbar ist es wichtig, daß nicht nur die Gäste nach Alter, sozialer Herkunft und finanziellem Status relativ homogen sind, sondern daß auch die Kneipenbesitzer nicht wesentlich älter sind als die Gäste und aus den gleichen Gesellschaftsschichten stammen. Das erleichtert es ihnen, so zu tun, als seien sie im Grunde gar keine Kneipiers, sondern nur Gastgeber. Richtig daran ist, daß sie durchweg keine Profis aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe sind; vielfach handelt es sich bei ihnen um Studienabbrecher oder um Leute, die aus Überdruß ihren Beruf an den Nagel gehängt haben. Aber der Eindruck der Solidarität mit den Gästen, den sie zu erwecken suchen, trügt.
Verlassen kann man sich auf ihn eher bei den »Zappern« und »Schleppern«. Denn die sind zumeist ehemalige Gäste ohne feste Anstellungsverträge, denen oft von einem Tag auf den anderen gekündigt werden kann. Das erhöht ihre Bereitschaft, sich mit den Gästen gegen den Kneipier zu solidarisieren. Gerade dieses Moment der Selbstrekrutierung des Kneipenpersonals aus der Kneipe trägt wesentlich zu dem diffusen Gemeinschaftsgefühl bei, das in ihr herrscht. Es setzt die Kneipe durch eine scheinbar minimale Fiktion gegen die Außenwelt ab und verwischt jeden Gedanken an einen Dienstleistungsbetrieb.
Eine ähnliche Funktion fällt auch dem Mobiliar zu. Fast ausschließlich handelt es sich bei ihm um Trödel oder aufgemöbelten Sperrmüll. Jeder Anschein von Modernität und Glätte der Formen wird vermieden. Alles Funktionale ist streng verpönt. Das ironische Zitat des Omaplüsch, den man insgeheim verachtet, dient dazu, den Raum der Kneipe der Gegenwart zu entziehen, ihn nostalgisch gegen das zu immunisieren, was draußen geschieht.
III
Was treibt Tausende von Leuten Abend für Abend an einen Ort, an dem sie sicher sein können, andere zu treffen, bei denen sie nicht sicher sind, ob sie sie eigentlich treffen wollen? Sie wollen offenbar nicht allein Alkohol trinken, sondern vor allem Alkohol nicht allein trinken. Wichtiger als das Verlangen zu trinken scheint ihnen ein diffuses Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation zu sein oder vielleicht sogar ein bestimmtes Bedürfnis nach diffusem Kontakt und nach diffuser Kommunikation.
Alkohol spielt für dieses Bedürfnis nur insofern eine Rolle, als er es unterstützt und fördert. Wäre Alkoholgenuß das primäre Ziel der Kneipenbesucher, könnten sie ebensogut zuhause trinken. Das aber scheinen sie nicht zu wollen. Ihr ungezieltes Kommunikationsbedürfnis sperrt sich gegen die einsame Sucht eines Bettkantensuffs. In den Kneipen trinken sie eher mäßig, gerade soviel, daß sie einen Teil ihrer sozialen Hemmungen verlieren und in der Lage sind, sich anderen ohne Angst vor Sanktionen zu nähern und sich selbst so darzustellen, wie sie gern gesehen werden möchten.
Die Kneipe ist für sie ein besonderer sozialer Ort. Wie kein anderer bietet sie jedem die Chance, unumwunden und übergangslos mit jedem (und natürlich auch: jeder) ein Gespräch zu beginnen. Wer in die Kneipe geht, will sich unterhalten oder unterhalten lassen. Die Schwelle der Ansprechbarkeit liegt in ihr niedriger als außerhalb. Dort ist zumeist ein Dritter nötig, über den eine gewisse Verbindlichkeit der gegenseitigen Anrede sich herstellen muß, damit ein Gespräch entsteht. In der Kneipe dagegen genügt bereits das Miteinander in dem einen Raum, um eine Unterhaltung mit Fremden zu beginnen.

Typische linke Kneipenszene während des Ausnahmezustands 2020ff
Denn die Kneipe wird als bergender und schützender Raum empfunden. Als solcher hält sie eine schwer bestimmbare Mitte zwischen Gruppe und Einsamkeit. Wer in die Kneipe geht, kann sich einer Gruppe zugehörig fühlen, die sich ad hoc herstellt und nicht näher bestimmt wird, oder er kann sich allein fühlen. Meist aber wird er beides zugleich empfinden. Und gerade dieses Gefühl des Alleinseins in einer undefiniert gehaltenen Gruppe Gleichaltriger scheint die gegenwärtige Attraktion von Kneipen in der Berliner Subkultur auszumachen. Wer sich in ihnen aufhält, befindet sich zugleich in einer Gruppe und außerhalb; er hat das Gefühl, irgendwie dazuzugehören, ohne deswegen behaftbar zu sein. Denn er hat weder der Gruppe noch irgendeinem ihrer Mitglieder gegenüber eine Verpflichtung oder Verantwortung. Im Gegenteil! Er kann gehen, wann es ihm paßt, und er kann zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederkommen, ohne den Fortbestand der Gruppe zu gefährden. Sie wird weiter für ihn da sein, wenn nicht hier und mit diesen Leuten, dann eben anderswo und in anderer Zusammensetzung. Also kann er sich einbilden, daß in der Kneipe endlich einmal nicht die Gruppe über ihn, sondern daß er über die Gruppe verfügt.
Der Schein dieser negativen Freiheit, die darin besteht, sich einer Gruppe jederzeit entziehen zu können, findet sein Gegenstück in dem Schein einer positiven Zusammengehörigkeit der Kneipenbesucher. Er verleiht den meisten Kneipen etwas Männerbündisches. Frauen, die allein kommen, sind in ihnen anders als in manchen »bürgerlichen« Lokalen zwar prinzipiell zugelassen, aber die Gäste verhalten sich ihnen gegenüber kaum anders als die Bürger.
Der Schein männerbündischer Zusammengehörigkeit verstärkt die Empfindung der Kneipe als eines bergenden und schützenden Raumes und hebt sie kaum merklich aus dem Alltag hervor. Sie gleicht darin dem Raum eines Festes, bei dem man sich, weil eben alle zugleich Anwesenden als Gäste geladen sind, in dem sicheren Gefühl bewegt, an jeden das Wort richten zu dürfen, ohne eine Zurückweisung zu erfahren.
Hat der Kneipenbesuch in dieser Beziehung etwas von einem Fest, so wird in der Subkultur umgekehrt das Fest der Kneipe immer ähnlicher. Längst kommen zu Berliner Parties nicht mehr nur die Freunde derer, die man eingeladen hat (während die Eingeladenen häufig genug, ohne abzusagen, gar nicht erscheinen), es kommen vielmehr überwiegend Leute, die weder die Gastbeger noch irgendeinen der Gäste kennen und von der betreffenden Party bloß jemanden haben reden hören. Auf solchen Parties reicht die Kneipe unmittelbar in die Wohnung hinein. An ihnen zeigt sich ihre normative Kraft. Denn fast könnte es scheinen, als gebe es in den geselligen Verkehrsformen der »linken« Berliner Subkultur kein Mittleres mehr zwischen ihr und der Isoliertheit der Pärchen und Einzelnen. Die Kneipe scheint die Party überholt zu haben.
Betuchtere Gastgeber der Westberliner Schickeria, die die Angleichung der Party an die Kneipe zu spüren scheinen und es leid sind, den Unterschied beider beim Aufräumen am Morgen nach einer Party an ihrer Wohnung mühsam wieder deutlich werden zu lassen, ziehen daraus die Konsequenz. Sie verlegen ihre Parties in Kneipen, die sie gegen Garantie eines Mindestumsatzes für einen Abend mieten.
Diese Form der Flucht aus der Wohnung in die Kneipe stellt ein Extrem des normalen Kneipenbesuchs dar. Denn auch der hat fast stets etwas von einer Flucht. Wer als Intellektueller in die Kneipe geht, tut das nur selten in dem Gefühl, sein Tagewerk getan zu haben und sich vor der wohlverdienten Ruhe einen Schluck genehmigen zu dürfen. Er flieht vielmehr in der Regel vor Ansprüchen, die er meint, nicht erfüllt zu haben oder erfüllen zu können; er sieht sich einem Leistungsdruck ausgesetzt, dem er sich in dem Gefühl entzieht, daß ohnehin keine Leistung ihn von diesem Druck würde befreien können. Die langen Handlungsketten intellektueller Arbeit erfordern einen Befriedigungsaufschub, dem er sich nicht gewachsen fühlt. Schier unabschließbar scheint da jedes Vorhaben. Der zwanghafte Arbeitswille, der dazu nötig ist, es abzuschließen, läßt keine Unterbrechung der Arbeitszeit zu. Doch gerade darum wird sie immer häufiger unterbrochen. Während es vielen unmöglich scheint, sich zu einem Spaziergang oder zu einer Einladung Tage vorher zu verabreden, weil sie meinen, auch und gerade dann arbeiten zu müssen, macht es ihnen nichts aus, abends stundenlang in der Kneipe zu hocken. Gegen den Zwang zum Aufschub von Befriedigungen, der durch die vermeintliche Unabschließbarkeit intellektueller Arbeit ständig verstärkt wird, setzt sich bei ihnen unabweisbar und in immer kürzeren Abständen ein spontanes Bedürfnis nach Wärme und Anerkennung durch. Es will nicht mehr die eine, durch den Abschluß einer einsam vorangetriebenen Arbeit bestimmte Befriedigung, sondern eine unbestimmte Befriedigung durch diffusen Kontakt und zufällige Kommunikation. Wer es verspürt, will mit anderen nicht auf Festen zusammentreffen, zu denen umfangreiche Vorbereitungen erforderlich wären, sondern umweglos und direkt. Der zwanghaften Ritualisierung seiner intellektuellen Arbeit will er in einer weitgehend entritualisierten Freizeit entgehen.
Die Kneipe kommt ihm in dieser Erwartung entgegen. Denn sie erscheint ihm als eine Art Dauerparty.
IV
Der einzige Unterschied zwischen Party und Kneipe, der sich erhalten hat, besteht darin, daß in den Kneipen nicht getanzt wird. Die Beziehungen zwischen den Geschlechtern aber sind bei beiden ähnlich. Auch wer in die Kneipe geht, möchte jemanden kennenlernen, ist immer irgendwie auf der Suche, möchte verführt werden oder verführen.
Bezeichnend für die Verkehrsformen der Kneipe ist indes, wie diese Wünsche zum Ausdruck gebracht werden. Werden sie, was zuweilen vorkommt, offen artikuliert, ist die Antwort stets ablehnend; sie bleiben also uneingestanden und werden oft nur verdeckt, oder sogar durch ihr Gegenteil ausgedrückt. Symptomatisch ist das folgende Gespräch, bei dem sich ein Mann mit einer Frau unterhielt, auf die er es abgesehen hatte:
Frau: Du, ich hab das nicht drauf, du, ich bring das einfach nicht, ich bring das echt nicht mehr, diese ganze Beziehungsscheiße. Ich flippe da aus.
Mann: Du, ich meine, das kann ich ja verstehen. Aber obwohl mir das alles nicht so wichtig ist, gibt's Momente, da sind mir die Knie echt weich geworden. Auch jetzt noch.
Frau: Quatsch, Mensch! Entweder ist das nur Bumsen, reine Mechanik, oder die Typen verkrampfen sich gleich und meinen, es sei große Liebe und so. Aber so'n Mittelding ...
Mann: Ja, so'n einfaches Zusammensein wäre dufte, ohne diese ganzen blöden Ansprüche.
Frau: Du, das glaube ich auch, du, aber wo gibt's das schon. Ich kenne nur Männer, die ficken, ficken und immer nur ficken und immer stupider dabei werden.
Mann: Klar, und ich kenne fast nur Frauen, wo ich durchweg sagen kann, alles Scheiße, wo ich's leid bin, offen zu sprechen.
Frau: Du, das mußt du lernen, damit zurecht zu kommen, das ist nun mal so.
Mann: Weißt du, da hab ich keinen Bock zu. -
Die Chance, mit fast jeder Frau in einer Kneipe ein Gespräch beginnen zu können, bringt den Mann in eine schwierige Lage. Er ist zwar an der Frau interessiert, aber er kann nicht offen um sie werben. Dabei würde er Gefahr laufen, sich lächerlich zu machen. Er kann sie, streng genommen, nicht einmal ansprechen; denn was er ihr sagt, betrifft ja nicht eigentlich sie, sondern bleibt allgemein. Er scheitert an der Chance der Nähe, die sich ihm bietet; denn diese Nähe verkehrt sich ihm in Distanz.
Aber auch die Frau ist in einer schwierigen Lage. Sie weiß, daß sie in der Kneipe von allen möglichen Leuten angesprochen wird, die was von ihr wollen und die ihr gleichgültig sind. In diesem Fall ist sie ihrer Sache nicht sicher. Daher testet sie die Situation. Sie tut das, indem sie sich einem Anspruch entzieht, der noch gar nicht formuliert ist. Sie entwertet, was der Mann nicht gesagt hat, aber ihrer Meinung nach sagen müßte, wenn sie ihm nicht zuvorkommt. Sie redet, um ihn zunächst von sich fernzuhalten, von einer Nähe, die er selbst noch in weiter Ferne sieht. Sie unterläuft gleichsam die Nähe, die die Kneipe bietet und aus der sich ein Gespräch entwickeln könnte, indem sie diese Nähe abwertend als Intimität definiert und zurückweist. Damit läßt sie dem Mann nur die Wahl, sich deutlicher um sie zu bemühen oder ihrer generellen Abwertung von Liebesbeziehungen zuzustimmen. In beiden Fällen hält sie sich also die Möglichkeit offen, das Gespräch abzubrechen.
Charakteristisch für die Geschlechterspannung in der Kommunikationsstruktur der Kneipen ist nun aber, daß sie das weder tut noch tun will. Denn sie ist ja an diesem Mann durchaus nicht uninteressiert. Nur kann sie ihm das sowenig sagen wie er ihr, ohne sich ihrerseits der Gefahr auszusetzen, lächerlich gemacht zu werden oder unglaubhaft zu wirken. Sie muß also dem entgegenhandeln, was sie sagt. Das tut sie, indem sie das Gespräch fortsetzt. Allein damit gibt sie dem Mann zu verstehen, daß er ihr nicht gleichgültig ist. Mit ihren nächsten Worten entwertet sie diese Andeutung jedoch bereits wieder. Denn sie stellt ihn, der mit dem Eingeständnis, daß ihm manchmal die Knie zittern, fast schon zu weit gegangen ist, vor eine Alternative. Er kann sich, so legt sie ihm nahe, entweder für eine bloß sinnliche oder für eine rein zärtliche Liebe entscheiden. Beides aber verwirft sie. Damit macht sie ihm die Entscheidung unmöglich, vor die sie ihn gestellt hat. Sie läßt ihm jedoch eine dritte Möglichkeit, die er ergreift und als einfaches Zusammensein definiert. Sobald er sich indessen darauf eingelassen hat, sie zu befürworten, entwertet sie sie ebenfalls.
An diesem Punkt nimmt das Gespräch eine andere Wendung. Die Frau geht dazu über, ihre Ablehnung sexueller Sinnlichkeit scheinbar unumwunden zu äußern. Ihre rüde Sprache aber täuscht über das hinweg, was sie sagen will. Denn sie möchte den Mann endlich dazu bringen, zu ihr und von sich zu sprechen. Sie will ihn zu einer Äußerung provozieren, aus der hervorgeht, was er von ihr will. Sie erwartet eine wie immer geartete Liebeserklärung, aber sie flüchtet in die allgemeine Darstellung des Gegenteils. Sie meint, ihm dadurch den Weg zu verlegen und ihn in die von ihr gewünschte Richtung zu drängen. Aber gerade wegen ihrer drastischen Ausdrucksweise weigert er sich, ihre Beziehung zueinander versuchsweise zu definieren. Er wiederholt vielmehr nur symmetrisch ihre Äußerung. Das kann sie nun zwar als eine Zustimmung zu dem auffassen, was sie gesagt hat, nicht jedoch als Zustimmung zu dem, was sie gewollt hat. Die Beziehung zwischen beiden bleibt vollkommen ungeklärt, und das Gespräch bricht daraufhin ab.
V
Die es geführt haben, sind einem Schema gefolgt, das für die Kommunikation in Kneipen charakteristisch ist. Ohne es zu wissen oder zu wollen, haben sie sich den Bedingungen der Gesprächsführung unterworfen, die unabhängig von ihnen die in den Kneipen mögliche Kommunikation strukturieren. Gerade weil die vorgängige Festlegung von Kommunikationsmustern an diesem Gespräch besonders kraß zutage tritt, lassen sich manche seiner Strukturelemente verallgemeinern. Auffällig ist allgemein zunächst eine gewisse Vertraulichkeit zwischen den Kneipenbesuchern. Ihren deutlichsten Ausdruck findet sie darin, daß man sich duzt, ohne sich zu kennen. Würde einer darauf bestehen, mit »Sie« angesprochen zu werden, würde er sich »unmöglich« machen. Man fände das »bürgerlich«. Nun ist aber der unterschiedslose Gebrauch des »Du« allen gegenüber nicht ohne weiteres das Gegenteil. Denn die Art, in der Arbeiter es untereinander verwenden, unterscheidet sich vom Sprachgebrauch der »linken« Subkultur, die die Arbeiter nachahmt. Zwar lebt auch das »Du« in der Arbeitersprache vom Gegensatz zum »Sie«, das »denen da oben« vorbehalten bleibt, aber ihm fehlt das Moment von veranstalteter Vertraulichkeit, das in der Subkultur mit ihm evoziert wird. Wenn Arbeiter sich duzen, verbinden sie damit keinen emotionalen Anspruch, sondern bringen ihre objektive Lage zum Ausdruck, die sie zu enger Kooperation und Solidarität zwingt. In der Sprache der »linken« Subkultur aber scheint ein diffuses Zärtlichkeitsbedürfnis für den Gebrauch des »Du« verantwortlich zu sein. Ihm haften weit eher als bei den Arbeitern regressive Züge an. Sie werden vor allem an seiner häufigen Wiederholung deutlich. »Du, weißt du, ich bring das nicht, du, ich bring das echt nicht mehr.« Die wiederholte Verwendung des Personalpronomens als Vokativ erheischt immer erneute Aufmerksamkeit und Zuwendung seitens des Angesprochenen. Das läßt darauf schließen, daß das global gebrauchte »Du« der Intimität keineswegs sicher ist, die es herstellen möchte und behauptet. Denn die diffuse Zärtlichkeit, die sich in ihm ausdrückt, nutzt sich durch seinen gleichförmigen Gebrauch allen gegenüber ab. »Du« ist eben jeder und keiner.
Das aber hat Folgen für die Kommunikationsformen der Subkultur. Denn das »Du« erschwert die Möglichkeit, den anderen als einen bestimmten anderen anzuerkennen. Charakteristisch ist, daß es häufig einen Namen ersetzt, den man entweder nicht weiß oder sich nicht hat merken können. Es schafft jene vertrauliche Anonymität, die der diffusen Zärtlichkeit entspricht, und errichtet damit zugleich eine dem ersten Blick kaum erkennbare Distanzschranke. Als gleichförmig allen zugesprochenes Personalpronomen verdeckt es die Namen der Gesprächsteilnehmer und täuscht sie darüber hinweg, daß sie sich gegenseitig im Dialog nicht identifizieren. Es scheint, als sei es ihnen genug, wechselseitig füreinander »Du« zu sein, ohne sich gegenseitig als ein bestimmtes »Du« anerkennen oder ablehnen zu müssen.
An dem zitierten Gespräch tritt gerade dieser Aspekt mit besonderer Deutlichkeit hervor. Die beiden, die sich da unterhalten, sprechen zwar zueinander, aber nicht eigentlich miteinander. Obwohl sie sich duzen, werden sie nicht »persönlich«. Sie vermeiden Sätze, die (performativ) ihre Beziehung verbalisieren, während sie (in Sätzen propositionalen Gehalts) ständig über mögliche Formen von Beziehungen reden (vgl. zu dieser Unterscheidung: J. Habermas »Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz« in: J. Habermas, N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt 1971, S. 104 f.). Man könnte nun einwenden, sie seien eben einfach verklemmt. Das wäre gewiß richtig, wenn nicht der eigentümliche Zwang der Situation eines Kneipengesprächs für die besondere Form ihrer Kommunikation zumindest mitverantwortlich wäre.
Inwiefern aber handelt es sich um einen Zwang? In der Kneipe, so scheint es doch, kann man alles sagen. Viele halten sie für einen Ort, an dem man ungezwungen und frei reden kann. Manchem gar mag sie als Vorwegnahme einer »idealen Sprechsituation« erscheinen. Denn in ihr ergibt sich augenscheinlich eine zwanglose »Kommunikationsstruktur«, aufgrund derer »für alle möglichen Beteiligten eine symmetrische Verteilung der Chancen, Sprechakte zu wählen und auszuüben, gegeben ist. « Es besteht in ihr »nicht nur prinzipielle Austauschbarkeit der Dialogrollen, sondern eine effektive Gleichheit der Chancen bei der Wahrnehmung von Dialogrollen« (Habermas, a.a.O., S. 137). In der Kneipe kann also potentiell nicht nur jeder mit jedem (und jeder) reden, sondern es gibt in ihr keine Statusunterschiede, die es etwa einzelnen oder einer Gruppe von Gästen erlauben würden, andere zu fragen oder etwas zu behaupten, ohne selbst nach dem gefragt werden zu können, was sie behaupten. In ihr ließe sich das schöne Modell einer herrschaftsfreien Diskussion noch am ehesten für realisierbar halten, wenn sie nicht gerade in einem entscheidenden Punkt dessen Karikatur wäre.
In der Kneipe findet nämlich keineswegs eine freie Diskussion statt, sondern in gewissem Sinn eine Befreiung von der Diskussion. Es gilt in ihr nicht der »zwanglose Zwang des besseren Argumentes« (a.a.O., S. 137), sondern gerade der Verzicht auf einen Argumentationszwang.
Denn die sich abends in den Kneipen versammeln, machen tagtäglich die Erfahrung, daß Argumentationen auch im scheinbar zwanglosen Diskurs von Seminaren oder politischen Gruppen trotz des Ziels der Wahrheitsfindung, dem sie dienen, in ihrem Ergebnis nicht zu trennen sind von Chancen des Statuserwerbs und Prestiges. Der Argumentationszwang, dem alle vernünftige Diskussion sich unterwirft, impliziert die Notwendigkeit, in den jeweiligen Gruppen Position zu beziehen. Und das empfinden sie als ungemein belastend. Unabhängig von jeder Sachhaltigkeit ist eine Diskussion für sie ein Kampf um Anerkennung. – »Das ist mein Problem, deshalb habe ich auch jetzt noch Artikulationsschwierigkeiten und kann mich überhaupt nicht ausdrücken, weil ich schon Angst habe, wenn ich den Mund aufmache, lachen gleich alle« (Louise in: »Die Sache der Frauen«, Kursbuch 35, S. 91). – Auch der »zwanglose Zwang des besseren Argumentes« erzeugt den Zwang, besser zu argumentieren. Nur trieb- und geschlechtslose, angstfreie und gutsituierte transzendentale Schattenwesen würden ihn als solchen nicht empfinden. Und worüber sollten die eigentlich noch reden?
Für den, der in die Kneipe geht, ist die Sprache weniger ein Mittel der Wahrheitsfindung als der gegenseitigen Anerkennung. Tagsüber leidet darunter, daß unterm Zwang der Diskursivität die Wahrheit jeweils er nur einer auszusprechen scheint, während die anderen schweigend dasitzen. Gut, er kann zustimmen oder widersprechen, aber von einer bestimmten Größe der jeweiligen Gruppe an hat er dazu eine immer geringer werdende Chance. In der Kneipe dagegen kommt er jederzeit zu Wort; denn dort reden beinahe alle gleichzeitig. Der diskursive Argumentationszwang ist in ihr zwar nicht vollkommen beseitigt, aber er ist zugunsten eines allgemeinen Bedürfnisses nach Anerkennung weitgehend neutralisiert. In der Kneipe verbindet sich weit weniger Statusunsicherheit mit der Geltung von Argumenten als außerhalb. Denn das Kneipengespräch ist von Interaktionszwängen entlastet, die eine bestimmte Rollenverteilung in einer Gruppe erforderlich machen. Es ermöglicht damit jene prinzipielle und gleichzeitige Anerkennung aller Beteiligten, die als Ursache der diffusen Wärme und Vertraulichkeit anzusehen ist, die in den Kneipen herrscht.
Der Preis dieser Anerkennung indes ist hoch. Sie wird bezahlt mit einer spezifischen Einschränkung der Kommunikation, die aus der Globalisierung der Anerkennung selbst sich entwickelt. Es müssen nämlich, um sie aufrechtzuerhalten, bestimmte schwer wahrnehmbare Distanzschranken zwischen den Gesprächsteilnehmern errichtet werden. So darf man, um einige zu nennen, zwar ausgiebig von sich selbst erzählen, aber nicht anderen gegenüber »persönlich werden«. Man darf ihnen weder etwas befehlen, noch darf man ihnen allzuviel Fragen stellen. Man darf die Kompetenz eines jeden, sich über praktisch alles zu äußern, nur ironisch, nicht aber kategorisch in Zweifel ziehen. Allzu heftigen Widerspruch muß man vermeiden, denn er stellt die insgeheim erwartete Tendenz zur Übereinstimmung aller am Gespräch Beteiligten in Frage und löst, wie jede nachhaltige Verletzung der Distanzschranken, Aggressionen aus. Vor allem aber kann man keine Gesprächsstrategie wählen, die ein gemeinsames Handeln außerhalb der Kneipe zum Ziel hat. Zwar ist es möglich, mit Leuten, die man kaum kennt, über allgemeine Handlungsnormen zu reden, nicht aber über etwas, das man in einem bestimmten, zeitlich fixierbaren Handlungshorizont gemeinsam auszuführen plant. Man ist meist eher befremdet, jemanden, den man in der Kneipe gesprochen hat, anderen Tags wiederzutreffen. Selten wird er einen grüßen, noch seltener wird er einen einladen, ihn zuhause zu besuchen. Denn die Wohnung bleibt von der Kneipe kategorisch getrennt.
Daß gegenseitige Anerkennung, Vertraulichkeit und Wärme gerade durch Distanzierung gewährleistet werden, macht das zentrale Paradox der Kneipengespräche aus. Die Nähe, die sich in ihnen herstellen läßt, ermöglicht, wie das zitierte Gespräch gezeigt hat, nicht ohne weiteres eine Annäherung, sondern kann sie gerade erschweren. Je niedriger die Distanzschranken in der Kommunikation sind, desto mehr muß an ihnen festgehalten werden, um die handlungsferne Solidarität gegenseitiger Anerkennung nicht zu gefährden.
Gefährdet erscheint sie offenbar durch jede über den Rahmen der Kneipe hinausgehende Verbindlichkeit, die sich zwischen den Gästen herstellt; denn idiosynkratisch verteidigen sie die Folgenlosigkeit ihrer Gespräche. Niemand darf eine gewisse Schwelle der Ernsthaftigkeit überschreiten, ohne Gefahr zu laufen, von jemandem unterbrochen zu werden, der zuvor an dem Gespräch nicht teilgenommen hat.
Nichts wäre in der Kneipe verpönter als eine terminologische Rede. Sie wird sofort mit Sanktionen belegt; denn sie reklamiert innerhalb der Kneipe eine Fachkompetenz, die nur außerhalb gelten darf, weil sie das egalitäre System wechselseitiger Anerkennung sprengen würde. Zudem verfügen viele Kneipenbesucher über die Erfahrung, daß die terminologisch überfrachtete Sprache auch der »linken« Wissenschaften ihnen nicht weiterhilft, weil sie selbst in dieser Sprache nicht vorkommen. Sie verbannen sie daher aus der Kneipe und verwenden allenfalls einzelne plakativ eingesetzte Modebegriffe.
Manche bilden eine regelrechte Zweisprachigkeit aus. Während sie in politischen Gruppen, im Studium oder Beruf terminologisch leidlich differenziert argumentieren, verwenden sie nebenher und unabhängig davon zur Formulierung ihrer vorwissenschaftlichen Alltagserfahrung eine vollständig andere Sprache. Sie steht unter einem emotionalen Überdruck und ist von Stereotypen durchsetzt. Es ist eine Wegwerfsprache, in der individuelle Erfahrung sowenig zu Wort kommt wie in der terminologischen. Die sie verwenden, nennen sich gegenseitig »dufte (oder miese) Typen« und die Mädchen, nach denen sie unentwegt suchen, »Bräute« oder »Tanten«, Sie unterliegen einem Zwang, jede Aussage mit einer gesteigerten Bewertung zu versehen, und finden fast alles entweder »Scheiße« oder »Schau«. Der emotionale Überdruck, der in dem Bewertungszwang zutagetritt, zeigt an, wie sehr diese Sprache der bloßen Entlastung dient. Als unterminologische, emotional aufgeladene Sprache eines Teils der Subkultur besitzt sie hohen Identifikationswert. Denn sie entlastet vom Argumentationszwang der Hochsprache und der versachlichten Fachsprachen. Auch die Wegwerfsprache ist in erster Linie Medium gegenseitiger Anerkennung.
VI
Was nun ist »links« an den Kneipen der Berliner Subkultur? Eigentlich nichts, so will es erscheinen, außer daß sie gelegentlich noch so genannt werden. Nach manchen der bisher gegebenen Bestimmungen sind von kleinbürgerlichen Gaststätten schwer zu unterscheiden. Und doch wäre es falsch, einfach zu behaupten, die von Beginn an kleinbürgerliche Studentenrevolte habe in Berlin mit der Ausbreitung der Kneipen zu sich selbst gefunden.
Offenbar hat mit dem Prozeß der Fraktionierung und Dogmatisierung großer Teile der Linken, der nach dem Ende der Studentenbewegung eingesetzt hat, ein Bedürfnis keine Befriedigung mehr gefunden, das die Studentenbewegung, wo sie reale Bewegung war, geweckt und befriedigt hat. Es ist das Bedürfnis nach freier sprachlicher Selbstdarstellung der vielen zuvor stummen Einzelnen, das sich gegen den Zwang einer autoritätsgelenkten Diskussion der Wenigen durchsetzte. Jeder machte damals die Erfahrung, nicht mehr nur Stimmvieh zu sein, sondern etwas zu sagen zu haben. Für viele war die Studentenbewegung eine Flucht aus der Sprachlosigkeit. Sie erfuhren an sich selbst, daß sie, ohne Sanktionen befürchten oder verhängen zu müssen, mit anderen sprechen konnten.
In den Kneipen der Berliner Subkultur überlebt (in freilich verkümmerter Form) ein Rest dieser Erfahrung. In ihnen werden nach wie vor Kommunikations- und Kontaktbedürfnisse deutlich, die viele politisch arbeitende Gruppen nicht wahrnehmen. Denn die Kneipe ist zwieschlächtig in ihrer Erscheinungsweise und Wirkung. Wie andere Institutionen der Subkultur vereinigt sie regressive mit emanzipatorischen Momenten. Gewiß, sie ist der soziale Ort des Geredes. Aber sich über das Gerede zu erheben, ist von der platonischen Ablehnung der »doxa« bis zu Heideggers Theorie des Man Kennzeichen elitärer Arroganz. Obwohl politische Gespräche in der Kneipe selten geworden sind, trägt sie auf eine schwer zu bestimmende Weise zur Politisierung mancher vielleicht mehr bei als politische Gespräche. Die nämlich werden außerhalb der Kneipe oft nur mit vor Wut zitternder Stimme geführt, als gelte es, jemanden für persönlich begangenes Unrecht zur Rede zu stellen. Die Kneipe dagegen läßt jedem die Chance, ohne Angst vor Sanktionen zu Wort zu kommen. Sie befreit ihn von dem bei vielen öffentlichen Diskussionen erworbenen Gefühl, sich ohne ein komplett möbliertes sozialistisches Bewußtsein mit Zentralheizung und Warmwasser zu nichts äußern zu können. Das allein muß nicht unbedingt, aber es kann politisierend wirken. Denn es gibt ihm die Möglichkeit, versuchsweise Positionen einzunehmen, die von der eigenen Erfahrung nicht allzuweit entfernt sind. Und mit der hat es jede gelingende Politisierung zu tun.
Auch jeder Gang in die Kneipe ist eine Flucht aus der Sprachlosigkeit. Insofern hat die Kneipe den minimalen Wiedererkennungswert einer verblaßten Utopie.