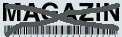Rambo – Last Blood
Keine Welt für Helden
Manche Filme sind starke Dokumente ihrer Zeit, ohne sich dessen im Ernst auch nur ansatzweise bewußt zu sein. Sie können einfach nicht anders, weil ihre Zeit sie zum Realismus beziehungsweise zur Darstellung der eben gesellschaftlich vorausgesetzten Selbstverständlichkeiten drängt. Zum Beispiel ‚Theo gegen den Rest der Welt‘ von 1980. Was damals ein lustiges Spiel der Revolte, des Aufbegehrens, des Unangepaßtseins sein sollte, in dem sich Marius Müller-Westernhagen in der Titelrolle eines kleinkriminellen, arbeitsunwilligen LKW-Fahrers den gesellschaftlichen Konventionen auf kreative Weise verweigert und privat nicht mit macht, ist von heute aus ziemlich genau das, aber auch noch mehr, nämlich, ganz en passant, ein Loblied auf die späten 70er Jahre und die Möglichkeit des ‚dolce far niente‘, was heute halt nicht mehr und nirgendwo drin ist. Insofern zeigt der Film – ganz neben seiner Intention – nicht die Beschränkungen, Restriktionen, Repressionen der 1970er Jahre in Westeuropa, sondern eine Gesellschaft, bei deren Betrachtung der Zuschauer von heute aus dem Wundern gar nicht rauskommt, wie leicht es den Leuten von damals gemacht worden ist, mit Faulenzen, Gaunereien und Quatsch über die Runden zu kommen – materiell und ‚motorisch‘, denn Theo bewegt sich so unbehelligt quer durch Europa, daß man sich fragt, was die ganzen EU-Fuzzis sich immer auf ihre angebliche Grenz- und Bewegungsfreiheit zugute halten. Die Zeiten haben sich eben geändert, und heutzutage wird ein Film über Kleinkriminelle, die durch halb Europa gondeln, notwendigerweise ein bedenkenträgerischer Film über irgendwelche elenden Flüchtlinge oder andere Menschen mit dem notorischen Migrationshintergrund. Und dazu muß man gar nicht mit der soziologisch-sozialdemokratischen Manie wie der Pädagoge Michael Haneke rangehen. Ein ähnlicher Fall liegt mit ‚Rambo – Last Blood‘ vor, ein anderer Film über das Leben eines Taugenichts, in dem Fall aber kein fröhlicher mehr, sondern ein trister und (ver-)zweifelnder. Theo wie Rambo weisen beide ein ähnliches Maß an sozialer Assoziationslosigkeit auf, Theo jedoch findet dabei immer wieder pragmatisch Gleichgesinnte, Rambo hingegen, 2019, bleibt alleine.
Kurz die krude Handlung, ohne auf die offensichtlichen Fehler und Sackgassen in der Story gesondert einzugehen: Rambo lebt, faktisch offenbar pensioniert und hauptsächlich zwecklos reitend, auf einer viel zu großen Ranch zusammen mit einer mexikanischen Haushälterin, die ein wenig Mutterersatz ist. Dann gibt es noch ein junges Mädchen, Gabrielle, die Enkelin der Haushälterin, die ihrerseits für Rambo eine Art Ersatztochter darstellt. Gabrielle steht vor dem Eintritt in den ‚Ernst des Lebens‘: Sie soll aufs College, wovon ihr Rambo aber abrät und meint, sie könne doch besser mit ihm auf der Farm und bei den Pferden bleiben. Das Mädchen macht weder das eine noch das andere, sondern kommt offenbar zwanghaft auf die Idee, sie müsse jetzt unbedingt ihren leiblichen Vater treffen, der Jahre zuvor irgendwo in Mexiko untergetaucht ist. Also schnappt sie sich heimlich das Auto und fährt südwärts. Der Vater will von ihr nichts wissen und raunzt nur, sie solle sich zum Teufel scheren, erwartungsgemäß. Die eine, durchaus dubiose Freundin, die sie in der mexikanischen Stadt hat, schleppt sie zum Trost in eine Disco, dort schüttet ihr der Beauftragte eines kriminellen Bande – geleitet von den Gebrüdern Martinez – KO-Tropfen in den Drink, sie wird entführt und zur Prostitution gezwungen. Zuhause entschließt sich Rambo, auf eigene Faust die Suche nach Gabrielle aufzunehmen, findet sie auch, nachdem er seinerseits zwischendurch von den Gangstern schwer verprügelt wird, aber auch ein halbes Dutzend Bandenmitglieder killt. Mit der schon schwer mitgenommenen und von den Gangstern rauschgiftabhängig gemachten Tochter fährt er zurück Richtung USA, sie stirbt ihm aber auf dem Beifahrersitz. Das kann Rambo natürlich nicht auf sich sitzen lassen und fährt gleich nochmal nach Mexiko, um dort vor allem exemplarisch brutal den einen der beiden Martinez-Brüder zu töten, damit der andere sich zur Vendetta entschliesst. Das tut der auch wunschgemäß und fährt mit der ganzen Gang zur Ranch von Rambo, der dort allerdings bestens vorbereitet auf sie wartet und in einer rabiaten halben Stunde einen nach dem anderen aus der Bande tötet – in der Hauptsache durch zahlreiche handgefertigte Waffensysteme in dem umfangreichen Tunnelsystem unter der Farm, das er über die einsamen Jahre angelegt hat und wo er sich am wohlsten fühlt.
Wie gesagt, recht krude. Aber: Rambo gerät den Filmemachern dabei nicht zum heroischen Kämpfer für die gute Sache, sondern unter anderem zur Personifizierung der Aufgabe jeder Objektivität. Gesellschaft kommt nicht vor. Außer dem für die dürftige Handlung unabdingbaren Mädchen Gabrielle, die allerdings auch mexikanischer Herkunft ist, gibt es außer John Rambo selbst keinen einzigen Amerikaner in dem Film (mit einer bemerkenswerten Ausnahme: Rambo schlägt Gabrielle vor, sie solle doch mal alle ihre Schulkumpel auf die Ranch einladen und ihnen die Tunnel zeigen. Die modenen, jungen, aufstrebenden Leute kommen auch, veranstalten eine sehr langweilige Party in dem Tunnelsystem – und Rambo schaut sich das Ganze aus der Ferne von der Veranda der Farm an; ins Haus kommen die Jungs und Mädels ihm nicht. Man könnte vermuten, er hat die Einladung in seine private Unterwelt nur vorgeschlagen, damit seine Tochter in ihrem Freundeskreis als der gleiche Freak wie er selbst gilt und so gezwungen wird, der Gesellschaft frühzeitig den Rücken zu kehren…). Nicht nur Gesellschaft existiert allerdings bei Rambo nicht (mehr) – außer irgendwo im feindlichen Draußen –, auch Familienbande lehnt er offensichtlich vehement ab und rät Gabrielle dringend, sich auf keinem Fall um ihren Vater zu scheren. Die einzigen, die praktisch was auf Blutsverwandtschaft zu geben scheinen, sind die Martinez-Brüder – und die sind zum einen alles andere als sympathisch, zum anderen ist auch völlig klar, daß sie sich gegenseitig hassen und maximal ‚brothers in crime‘ sind. Desweiteren ist von Patriotismus bei Rambo nicht die geringste Spur zu finden. Nur einmal ist eine US-Fahne zu sehen: auf dem uralten Briefkasten am Tor des Zauns der Ranch, der zum einen wohl eh schon ewig nicht mehr genutzt wird – Rambo ist wirklich niemand, der Briefe schreibt oder empfängt (nebenbei, und das muß 2019 als auffällig gelten, gibt es in dem Film kein einziges der modernen Gadgets – Handy, GPS, Social Networks – alles Fehlanzeige) –, zum anderen wird als Inhaber auf dem Briefkasten ‚R. Rambo‘ angegeben; da der Protagonist des Films aber John mit Vornamen heißt, wird der Briefkasten wohl ein Relikt aus der Zeit des Vaters sein, der bei noch sinnhaltigeren oder einsichtigeren Schlachten wie dem 2. Weltkrieg mitgewirkt hat. Darüber ist John weit hinaus. Sein ‚Erweckungserlebnis‘ ist, wie wir aus Teil 1 wissen, der Vietnamkrieg (und seine inneramerikanischen Folgen). Das Mexiko wiederum, das im Film vorkommt, ist nicht mal eine rassistische oder wie auch immer geartete Projektion. Einmal antwortet Rambo auf den Vorschlag, die mexikanische Polizei einzuschalten, um das verschwundene Mädchen wiederzufinden: ‚They don’t do that down there‘ – das ist nicht gegen die Mexikaner gemünzt (die näherliegende Idee, die amerikanischen Behörden einzuschalten, kommt in dem Film ohnehin niemand in den Sinn) –, sondern eine realistische Einschätzung eines erfahrenen Outlaws wider Willen, der seinerseits die staatlichen Verfolgungsbehörden hüben wie drüben gut kennt. Und ganz richtig wird dann auch gezeigt, daß die Gangsterbande, die ihren Prostitutionsring aus recht wahllos entführten Mädchen unterhält, den lokalen Polizisten einen Sondertarif einräumt: Die dürfen nämlich die kellerähnlichen, kargen und schmutzigen Räume, in denen die Mädchen eingesperrt sind, als Horde stürmen und über die Beute mit Freifahrtschein herfallen. Auch über die mexikanische Gesellschaft erfährt man so im Sinne historisch-materialistischer Analyse oder Kritik fast nix. Wenn überhaupt, ließe sich vermuten, daß der Film, indem er Mexikaner überhaupt vorkommen läßt, den Mittelamerikanern noch eine kleine Chance gibt auf eine halbwegs humane Gesellschaft irgendwann in einer fernen Zukunft, wohingegen die USA, deren Bewohner und Gesellschaft, wie erwähnt, quasi abwesend sind, ohnehin schon als eine Art ‚failed state and society‘ abgeschrieben scheinen. Als ob Rambo in so einer Welt nur noch eine Mission hat: Wenigstens das junge Mädchen Gabrielle von ihrem Vater, dem College, der ‚normalen‘ Welt fernzuhalten und ihm – am Ende frustrierend erfolglos – eine grundsätzliche Integrationsverweigerung einzupauken, nach dem Motto: ‚Draußen ist die Hölle. Sieh doch, was es aus mir gemacht hat.‘
Objektiv ist der Film allerdings auch in anderer Sicht ganz und gar nicht, nämlich – vielleicht etwas unerwartet, weil man sich bei Stallone vorstellt, es ginge hier um die Darstellung eines gerechten Rachefeldzugs – in Fragen der Moral. Die hat und vertritt Rambo nämlich gar nicht, weder objektiv, noch wenigstens subjektiv. „Aber Menschen können sich doch ändern! Du bist ein Beispiel dafür!“, sagt das Mädchen einmal flehend zu Rambo. Er, kurz: „Du täuschst Dich. Ich bin immer noch der Gleiche [ein zwanghafter Killer ohne interne wie externe Kontrollen, wie der Film bald darauf zeigen wird]. Ich halte nur den Deckel drauf.“ Und der Deckel wird eben später abgenommen, und heraus springt, wie das Kasperle, eine perfide menschliche Mordmaschine, die sich nur – und dies aber recht erfindungsreich und engagiert – auf die Vorbereitung einer möglichst großen Anzahl von Varianten, seine Mitmenschen um die Ecke zu bringen, besinnen kann. Glücklicher macht dies Rambo aber am Ende auch nicht, obwohl er sogar für seine Verhältnisse in ein gewisses Extrem geht, indem er seinem – recht täppischen – Kontrahenten, Martinez II, am Ende des Films bei lebendigem Leib das Herz herausreißt. Das macht er zwar frei von Gewissensbissen, dann schaut er aber doch etwas unverwandt auf das noch pochende Herz in seiner Hand und verzieht sich schlapp auf die Veranda der außer ihm nun gänzlich verlassenen Ranch, um sich – wie vormals, erfahren wir, sein Papa – in den Schaukelstuhl niederzulassen. „Jetzt bin ich nur noch einsamer“, mag der Killer von der traurigen Gestalt sich vielleicht denken, nachdem er gerade in Windeseile geschätzte 50 Gegner erledigt hat – in seiner neuerlichen Verlassenheit scheint ihm das nun beinahe leid zu tun. Ganz genau wird man das wohl nie erfahren: Es soll ja der letzte Teil der Reihe gewesen sein – und Rambo, einer der zentralen mythischen Helden der jüngeren US-Geschichte, kann wohl wirklich nichts mehr über diese Welt erzählen, in der er schon als junger Mann bruchgelandet ist. Sollte es doch noch ein Sequel geben, müßte dieses wohl eine Art ‚Warten auf Godot‘ werden – allerdings mit nur einem Darsteller. Wie man’s ja für Stallones Gesichtsausdruck immer schon konstatiert hat: Alles ist offenbar recht trist. Und nun weiß er wirklich nicht mehr, warum oder wo noch Hoffnung wäre. (Selbst das Sprechen ist ihm eine immer größere Mühe. ‚Ohne Worte‘ hieß es bei vielen Bilderwitzen früher. So wird’s auch hier gemeint sein. Nur nicht als Witz.) Folglich ist Stallone/Rambo auf seine Weise deutlich radikaler als Trump: Während der immerhin aus den Staatsgeschäften ein für sein Selbstwertgefühl lukratives Privatvergnügen jenseits der etablierten Parteien und zu deren Ärger veranstaltet und dabei überzeugt ist, einem Gemeinwohl zu dienen, akzeptiert Stallone in seinem erfahrungsgesättigtem Weltschmerz nicht mal mehr ein solches Lustversprechen; selbst karriereorientierter Zynismus ist für ihn keine Option. Oder, wie Stallone es selbst in einem Interview ausdrückt: ‚Rambo war immer atheistisch und apolitisch.‘