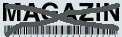Allerlei Aphorismen
Eine der verschiedenen angemeldeten oder spontanen Demonstrationen ist direkt auf der Reeperbahn zum Stehen gekommen. Die Demonstration ist eingekesselt – das heißt, dreißig Polizisten, die in einer Reihe auf der Straße stehen, halten etwa 800 Leute davon ab ,die Reeperbahn zu verlassen. Also steht man wartend und ratlos herum; die Reeperbahn-Besucher, die in den Fressbuden sitzen, glotzen auf die Demonstration, ansonsten geht hier alles sein übliches Treiben. Auf einmal ist ein lautes, tiefes, undefinierbares Geräusch vom unteren Ende des Demonstrationszugs her zu hören. Ein seltsames Knattern und Heulen. Schließlich gibt die Menge den Blick auf einen Rocker mit seiner Maschine frei, der langsam durch die Demonstrationsreihen fährt. Dabei lässt er immer wieder mit einem unglaublichen Lärm den Motor der Chopper aufheulen. Die Demonstranten gehen verschämt zur Seite, trauen sich nichts zu sagen. Aber der Rocker will gar keinen Ärger machen, sondern macht sich eine kindische Freude daraus, dass er und seine Maschine etwas Aufmerksamkeit bekommen. Jedesmal wenn der Motor aufheult, gehen im Takt seine Augenbrauen nach oben, die von einem Stahlhelm eingerahmt sind. Schließlich hat er das andere Ende des stehenden Demonstrationszugs erreicht, lenkt seine Maschine um 45 Grad und steht jetzt genau seitlich an der Bullenreihe, sodass seine Schultern fast die Polizeimonturen berühren. Er winkt lächelnd in Richtung der Demonstranten und lässt mit einem mal einen ohrenbetäubenden Knall aus der Karre raus. Ich habe noch nie so eingeschüchterte Bullen gesehen – diese guckten mit schlotternden Knien einfach an dem Rocker vorbei, als ob er nicht da wäre. In der Verletzten-Statistik der Bullen dürften ein paar Trommelfelle dabei gewesen sein.
Pause in einer alten Hamburger Bar. Zwei Schwestern geben Alster aus und beklagen sich darüber, dass der G20 in Hamburg alles durcheinander würfelt. Trump solle die Operntreppe herunterfallen, die Politiker sich auf eine Insel trollen. Typisches Ressentiment, aber durchaus sympathisch. Während des Gesprächs sieht man draußen fünf junge Vermummte, wohl eine dieser Bezugsgruppen. Sie besprechen irgendetwas und gehen. Die Bardame findet es witzig, und da alle gut gelaunt und freundlich sind, gesteht sie am Ende, dass der G20 eigentlich doch ganz gut ist, wegen all der netten Gespräche. Anwesend war auch noch ein schwarzer Arzt, der sich uns später anschließt und zugibt, dass er jetzt lieber kein Arzt wäre, da er schon bei geringen juristischen Streitigkeiten um seinen Ruf bange. Er wäre eigentlich lieber ein Mitglied des schwarzen Blocks, wenigstens ein bisschen. Beim anschließenden Schanzenfest ist er dann lieber nicht dabei.
Da wir alle vorher arbeiten mussten, kam unsere vierköpfige Bezugsgruppe erst am frühen Freitagabend in Hamburg an. Die Blockaden hatten wir also gerade verpasst. Als ersten Anlaufpunkt hatten wir uns die Demo „G20 entern – Kapitalismus versenken“ ausgesucht, die für 20 Uhr auf der Reeperbahn angekündigt war. Aufgrund der vielen Polizeisperren brauchten wir recht lange, bis wir uns zum Startpunkt der Demo durchgeschlagen hatten. Auf der Reeperbahn war eine bunte Menge versammelt, auf einer großen Bühne spielte eine linke Band. Wir erfuhren von irgendwem, dass die Demo abgesagt worden sei. Stattdessen begann ein Trupp dieser Musikclowns trommelnd über den Platz zu laufen. Er zog einen Rattenschwanz von Leuten hinter sich her, die begannen, Parolen zu rufen. Wir schlossen uns an in der Hoffnung, dass sich daraus vielleicht etwas entwickeln könnte – ein Ausbruchsversuch aus dem von Bullen umstellten Platz, eine Spontandemo? Leider passierte nichts dergleichen, der Pulk zog nur weiter seine Runden über die Reeperbahn. Irgendwann begann die Menge, direkt vor einem Wasserwerfer zur Musik aus einem Soundsystem zu tanzen. Die Bullen spielten mit und lieferten die Discobeleuchtung, indem sie die Lichter des Wasserwerfers im Takt blinken ließen.
Gegen Mitternacht beschlossen wir, diese traurige Party zu verlassen, und machten uns auf den langen Fußmarsch zurück zu unserem Hostel. Dort angekommen, staunten wir nicht schlecht, als wir auf einem großen Bildschirm im Foyer die Bilder aus dem Schanzenviertel sahen. Wir hatten unseren Abend auf einer Pseudofete verbracht und die wirkliche Feier nicht mitbekommen, obwohl diese kaum zwei Kilometer entfernt war! Ich fühlte mich ein bisschen wie der Situationist Raoul Vaneigem, der den Mai ’68 in Paris verpasst hatte, weil er vorher in Urlaub gefahren war und dann aufgrund des Generalstreiks nicht rechtzeitig von der Mittelmeerküste zurückkommen konnte. Mit fiel ein, dass E. aus unserer Bezugsgruppe irgendwann vorher am Abend sogar vorgeschlagen hatte, dass wir in die Schanze gehen sollten. „Wenn irgendwo in Hamburg was passiert, dann dort.“ hatte sie gemeint. Das war aber untergegangen. Als ich im Hostel daran erinnerte, erwiderte E. trocken: „Tja, wenn ich einen Bart hätte, hätte man auf mich gehört.“
Während am Eingang zum Schulterblatt schon der Straßenkampf in vollem Gange ist, der später zur strategischen Öffnung der Schanze führen wird, hat sich auf der Rasenfläche am Neuen Pferdemarkt eine recht große Menschenmenge gesammelt. Es ist wie eine Fortsetzung des „Hard Cornerns“ der letzten Tage, dementsprechend gemischt ist das Publikum. Während auf der Kreuzung schon eine kleine Barrikade brennt und die Bullen immer wieder mit Glasflaschen eingedeckt werden, gibt es auf der Wiese ein Offenes Mikrofon. Ein Hippie hat sich das Mikro genommen, zeigt mit der Hand auf das Scharmützel an der Kreuzung und sagt: „Wenn wir wirklich für eine neue Gesellschaft einstehen wollen und dabei etwas anders machen wollen, dann machen wir uns unglaubwürdig, wenn wir selbst Gewalt anwenden.“ Zögerlicher Beifall. Im nächsten Moment fährt ein Wasserwerfer an der Kundgebung vorbei und sprüht im Vorbeifahren die Open-Mic-Menge ohne jede Vorwarnung mit Wasser ein. Die Worte des Hippies gehen in empörtem Gezeter unter.
Am Schulterblatt brennen zwei Barrikaden. Es ist ein emsiges Treiben, wie die Autonomen brennbares Material zusammensammeln, um damit das Feuer zu verstärken. Die Flammen gehen inzwischen sechs, sieben Meter in die Höhe, als sich plötzlich direkt auf der Höhe der Barrikade in den oberen Etagen des anliegenden Hauses ein Fenster öffnet. Ich denke erst, es will sich ein Schanzenviertel-Bewohner darüber beschweren, dass das Feuer direkt unter seinem Fenster brennt, doch nichts dergleichen: Jemand stellt eine große Box ins Fenster und auf der ganzen Straße erklingt „What a wonderful world“ von Louis Armstrong. Mit einem mal ändert sich die ganze Atmosphäre des Geschehens – die harten Geräusche, das Knallen, Knistern und Schreien fügen sich auf einmal in ein warmes Ambiente ein, es ist, als hätte jemand einen weichen Filter über alles gelegt. Es ist, als ob nun alles in Zeitlupe geschähe, als ob keine Gefahr mehr da wäre, wie in der Abschlussszene eines Films, in dem sich nach langer Strapaze endlich eine glückliche Wendung ergeben hat. What a wonderful world.
Vorne ist die Straße schon dicht. Ein großes Feuer und das berühmte Gerüst versperren der Polizei den Weg. Die kommt über eine Seitenstraße, muss aber unter dem Gejohle der Blut leckenden, vermummten Menge zurückweichen. Hinten ist auch ein Feuer, die Anspannung beginnt sich zu lösen, die Angst weicht dem Gefühl einer kurzzeitigen, relativen Sicherheit. Neben mir fängt sich ein spontan, aber gut vermummter Jungarbeiter an, sich zu freuen: „Da vorne ist ein Kollege von mir. Hey M., du auch hier? Geil, was!“
Da wir als Journalisten das Geschehen begleiten, halten wir uns sehr zurück. Wir versuchen vorsichtig zu sein, um nicht in eine gefährliche Situation hineinzugeraten. Bei der Welcome-to-Hell-Demonstration hatten wir Glück gehabt, es war brenzlig gewesen, wir sind gerade noch einmal rechtzeitig weggekommen. Es kitzelt uns aber doch. Als wir das Geschehen im Schulterblatt beobachten und klar wird, dass die Bullen hier für längere Zeit kein Land gewinnen werden, sagt einer von uns: „Aber heute werfen wir einen Stein. Nur einen, ja?“ Bevor wir dazu kommen, über den veränderten Aktionskonsens zu diskutieren, macht sich auf Höhe der brennenden Barrikaden eine Panik breit. Die Leute rennen panisch aus Richtung des Eingangs des Schulterblatts in Richtung Rote Flora. Wir rennen natürlich mit, weil wir vermuten, dass die Bullen die Barrikaden stürmen, aber nach einiger Zeit wird klar, dass keine Bullen da waren und die Menge bewegt sich langsam zurück zu den Barrikaden. Solche Panik-Wellen haben sich dann etwa im 10-Minuten-Takt wiederholt. Das Problem bestand darin, dass die Barrikaden so hoch brannten, dass das Feuer und der Rauch die Sicht auf die Kreuzung zum Neuen Pferdemarkt versperrt haben. Alle Leute, die sich in den mittleren und hinteren Reihen befanden, hatten somit überhaupt keinen Eindruck davon, wie sich die Lage auf der Kreuzung darstellt. Jede Bewegung in den vorderen Reihen löste somit eine Panik in den hinteren Reihen aus, die dann in der Massenbewegung eine irrationale Fluchtbewegung nach sich zog. Nachdem sich dieses Geschehen zwei, drei Male wiederholt hat, ist das Problem durchschaut. Jedes mal wenn nun eine neue Panik-Bewegung anrollt, gehen wir langsam mit erhobenen Armen auf die wegrennenden Leute zu und rufen: „Ruhig bleiben“, „nicht rennen“, „keine Panik“ und „zusammen bleiben!“ Unserem Vorbild schließen sich dann etliche Andere in den hinteren Reihen an – bis am Ende so viel Selbstvertrauen gewonnen ist, dass die Panik-Bewegungen ausbleiben. So haben wir zwar keinen Stein geworfen, aber als teilnehmende Beobachter eine unnötige und gefährliche Panik im Schanzenviertel verhindert.
Nie so eine plötzliche, autonome Geschäftigkeit gesehen. Schilder werden aus der Verankerung gerissen, Feuer verstärkt, neue Barrikaden errichtet. Die Polizei war für den Augenblick des Platzes verwiesen. Junge Frauen schieben Einkaufswägen mit Steinen durch die Gegend, eine Punkerin hat eine Spielzeugzwille. Neben mir zerkleinert eine Autonome große Steine und entschuldigt sich, da sie mich beim Trinken stört. Ich antworte: „Keine Ursache“ und rücke ein wenig beiseite, da ich sie beim Zerkleinern störe. Die Medien haben sie auch gesehen, die munteren Frauen in der Straßenschlacht, und im REWE wurden sie beim Klauen gefilmt. Die Sache war natürlich statistisch von Männern dominiert, aber an den Geschlechtsunterschied wurde in diesem Moment kaum gedacht; er spielte im schwarzen Block für den Augenblick keine Rolle. Es war ja eine Verbrüderung. Erst später die Pseudokommunisten: „Viel zu dicke Eier“. „Vermummte Männerhorden“ und ihre „maskulinen Allmachtsphantasien“. Auch eine Art zu sagen, dass man die Revolution hasst wie die Pest, wenn man schon die ersten Scharmützel verabscheut.
Die Polizei hat mittlerweile offenbar beschlossen, das Treiben im Schanzenviertel eine Weile zu gewähren. In einer recht leeren Bar gucken einige die permanenten Nachrichten. Eine Barrikade brennt. Ich drehe mich um und sehe, dass es eben die Barrikade ist, vor der ich stehe. Und das Kamerateam direkt daneben. Willkommen in der Postmoderne.
Aus Casseurs werden sofort Enteigner, wenn man ihnen die Zeit lässt. Eine Gruppe der hier geborenen Jugendlichen mit – wie man sagt – migrantischem Hintergrund ist außer sich, da sie beobachtet, wie junge Franzosen den Budni aufmachen. „Hey Digger, die machen den Budni auf! Die machen echt den Budni auf!“ Einige Minuten später prosten wir uns zu. Überall gibt’s nun Süßigkeiten und Alkohol. Wir haben sogar Champagner bekommen.
Am Altar
Mehr und mehr stellte sich am Freitagabend Erstaunen darüber ein, die Bullen zwar im Angesicht zu haben, aber von ihnen nicht weiter behelligt zu werden. Ewig nur in ihre Richtung zu werfen, wird dann auch fad, wenn die andere Seite keine Anstalten macht. Also wurden Erkundungstouren gemacht und siehe da: nicht nur Rewe war im Angebot. Ein I-Store war bereit seine Toren zu öffnen, so denn man über die Schwelle tritt. Doch diese Schwelle bot Halt. Wie Geschäfte allgemein im Verhältnis zum Altar stehen, so die Hallen von Apple zum Vatikan – der Fetisch macht vor der Plünderung nicht Halt. Nach den ersten Steinschlägen dehnte sich das Geschehen aus; so vital man noch vor kurzem jeden Stein aufhob, um ihn gegen die Reihen der Staatsbüttel zu werfen – jetzt setze Zögern ein. Zaudern könnte man unterstellen, zaudern vor den Hallen der Starware, die ihre Tore nicht beim ersten Schlag öffnen. Oder Zweifel darüber, was man mit diesem Mist – samt tracking device – überhaupt anstellen solle? Dazu kam ein Passant bei dem der Glauben noch viel höher im Kurs stand: Mutig, würde er es wohl nennen, schrie er die Gruppen an und kriegte prompt seine Quittung ausgestellt. Ob der Tritt gegen die Rippen hätte sein müssen oder nicht der Faustschlag gereicht hätte, war schnell geklärt. Glaube vereint die unterschiedlichsten Gestalten; und doch kam nun auch wieder Fahrt in die Angelegenheit und man versuchte sich endlich mit Gerät Zutritt zu verschaffen. Schließlich gelang es und die Andacht nahm ihr Ende – oder doch nicht? Sicherheitsglas oder theologische Mucken – oder doch nur metaphysische Spitzfindigkeiten?
Tautologie des Spektakels
Besonders niederträchtig gelten gemeinhin die Täter, die sich bei ihrer Tat inszenieren, in Szene setzen. Dabei sind sie in die Lehre gegangen. Sie, Kids aus der City und der Umgebung, die sich abwechselnd filmten – wie sie Steine auf die Polizei warfen. Nicht ohne Grund feuerten sie sich an, ließen ihre Smartphones reihum ums Feuer gehen und setzten jeden der ihren ins rechte Licht. Sie wissen: Was erscheint, ist gut, was gut ist, erscheint.
Etwas beleibter Mann in guten Jahren am Feuer. Strahlt: „Das ist meine Schanze. Da vorne brennt das Feuer vier Meter hoch. Überall italienische Anarchisten.“ Ich erzähle von der französischen Ahu-Fraktion, die ihren Siegestanz aufgeführt hatte, nachdem die Straße erfolgreich mit einem Baugerüst gesichert worden war. An dieser Stelle einmal ein Dankeschön an die zugereisten Ausländer. Ohne die hätte es anders ausgesehen.
Spruchversuch. „Ich war, ich bin, ich werde sein! Die Revolution wird die Menschheit befrei’n!“ Klare Anspielung auf die gute Rosa Luxemburg. Eine Gruppe Anarchisten schaut böse und ruft was anderes. Eine Gruppe irgendwann zugezogener, türkischer Kommunisten reckt die Faust.
Abend in der Stadt
Während der Mob der Kooperationsmächte Deutschland und Österreich zum Sturm auf die Schanze ansetzte, setzte sich der erste Teil der Diffusen ab: ab in die offenen Straßen – in Richtung der Messe. Darauf folgte Verwunderung an der Sternschanze – einem Ort der zwei Tage später noch zu trauriger Prominenz avancierte, als tausende Neurotiker ihren Wahn offen auslebten. Sturm und Drang nämlich waren die geparkten Wannen nicht, ihre Besatzung lediglich aus Fahrern, staunte nicht schlecht. Staunen auch auf Seiten der Diffusen: „Konnte es sein, dass die hier schlicht rumstehen und wir freien Lauf haben?“ Der Schrecken wurde nach kurzem durch die ersten Steine gelöst und der Mob bewegte sich weiter. Weiter doch nicht in Richtung der Messe, es gab besseres zu tun. Besseres versprach der Rewe, der Zweite. Davor versprachen Barrikaden aus Beton und haufenweise Säcke mit Holzkohle eine ausgelassene Zeit und einen warmen Empfang. Kurze Aufregung unterbrach die Bauarbeiten: ein Krankenwagen näherte sich. Einige Vermummte rannten heran, schoben die Betonsockel kurz zur Seite. Applaus der Menge – auf ihrer Seite. Entschlossenheit vs. Starrheit. Darauf Entspannung, Ruhepause mit Bier und Tabak – Smoothies für die Gesundheit.
Einige zogen weiter, auf der Suche nach neuen Zielen. Andere fanden ihr Ziel bei Rewe und machten sich mit Pralinen, Schnaps, Tabak und Blumen auf den Weg nachhause. Über allem Schall und Rauch.
Das Schanzenfest ist vorbei. Wir trinken das letzte Sixpack, dass uns einer der Plünderer freundlich überlassen hat und suchen dann ein Taxi. Ein Hamburger mit Geld bietet uns freundlich an, uns das Taxi zu bezahlen und schimpft auf die Autonomen von der Flora. Die hätten durch ihr Fest ihr Ansehen auf zehn Jahre zerstört, sogar das SEK hätte einmaschieren müssen. Davon hörten wir zum ersten Mal. Wir hatten uns wohl gefühlt und wegen uns hätte man die Sondertruppen nicht schicken müssen. Zum Glück fährt er dann doch alleine davon.
Nach längerer Suche finden wir ein Taxi. Statt Navi gibt’s schon den neuesten Riotporn. kannten wir auch alles noch nicht. Brennende Autos am Morgen, eine scheppernde Ikeafiliale. Da haben wir noch geschlafen wie ordentliche Bürger. Wir kommen vom Schanzenfest und warten erst mal ab, bis der Taxifahrer sich über den bunten Rauch einer Rauchbombe freut, wegen dem guten Sichtschutz. Er findet alles gut, stört sich nicht mal an der Ikeafiliale. So muss das Volk sein, wenn die Revolution eine Chance haben will.
Am Morgen nach dem Krawall am Freitag ging ich zum nahe gelegenen Supermarkt. Leider wieder im Alltagstrott angekommen, hieß es somit, in einer Schlange anstehen, die Waren mit dem allgemeinen Äquivalent Geld erhalten (ich gestehe, dass ich kein Vollzeitrevolutionär bin und nicht vom Ladendiebstahl meine Grundbedürfnisse und Begierden befriedige) und ein atomisiertes Dasein in dieser Gesellschaft zu fristen. Was jedoch amüsierte, waren die Gespräche rund um den Knall vom Vortag. Das Thema führte zu einer allgemeinen Kommunikation wie sonst nur beim Wetter üblich. Von kopfschüttelnder, lautstarker Empörung bis zu schelmisch stiller Freude war alles dabei. Allzu enthusiastische Bejahung des Ganzen verhinderte wohl die herrschende Moral. Ich besorgte mir die besonders stark bebilderten Tageszeitungen und erhoffte mir ein weiteres Mal die Erklärung des schwarzen Blocks und Kreativität in der Erzählung. Beides wurde bestens erfüllt! Die ganze Aufregung über die Militanz ließ eine Tageszeitung die wenigen Sitzblockaden als tolles Erlebnis darstellen. Wären die Krawalle ausgeblieben und es wäre beim inszenierten Protest geblieben – diese Form der Proteste wäre vermutlich das Fressen der Medien gewesen. Beim Lesen an der frischen Luft kamen immer wieder Leute vorbei gezogen, schauten auf die Bilder brennender Barrikaden, grinsten, steckten heimlich Däumchen in die Luft und freuten sich scheinbar diebisch. Gesten böser Leidenschaften. Schön.
Die beiden Hippies mit Hase und Hund, die uns während der Tage aufgenommen hatten, wurden am Samstag aus einem Park gezerrt. 150 amphetamingepuschte BFE-Truppen hatten sie in zwei Kreisen umstellt und Razzia gespielt. Da sie passiven Widerstand leisteten, wurden sie buchstäblich an den Haaren herausgezogen und gefilzt. Da in einem Rucksack ein Schraubenzieher drin war, gerieten sie sogar in Verdacht Übeltäter zu sein, dabei wollten sie kiffen. Ansonsten haben die Schweine eher nach Franzosen und Italienern gesucht. Die Nachwirkungen der Fete im Schanzenviertel.
Verena, 72, ist eine Altachtundsechzigerin. Am Sonntag nach dem Gipfel erzählt sie mir, dass sie die Situation an Grohnde erinnert. Damals war ihr Mann für etwas verurteilt worden, das er nicht gemacht hatte. Ihre Zeuginnenaussage fand keine Beachtung, weil ein Erste-Hilfe-Set in ihrer Tasche war. „Jetzt wird es Scheinprozesse geben, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen“, meint sie zu mir. Auf dem Weg zu ihr, einem Ruhesitz alter Menschen, sehe ich ein halb verbranntes Auto. Auf der noch vorhandenen Hälfte steht „Pflege“. Verenas Schwester, 80, sieht darin ihre Abneigung gegen die Protestierenden bestätigt. Sie würde sie gerne aus der Stadt vertrieben sehen. Verena wirft sie vor, sich blind auf die Seite „der Krawallos“ zu stellen. Bis sie am Sonntag in die Kirche geht. Auf dem Programm steht ein Text von der Weltkirchenkonferenz 1948. Ein klares Nein soll es zu jedem System geben, das Menschen wie ein Stück Ware behandelt. Und dann steht da noch viel über Gott und wie sehr er auf der Seite der Unterdrückten ist, ohne das in dieser Welt zu zeigen. Verena ist glücklich, dass ihre Schwester und sie eine Vermittlung gefunden haben. Ich laufe von ihr weg, wie von einer anderen Zeit. In den darauf folgenden Wochen werde ich erstaunt feststellen, dass es einen politisch anders Denkenden in meinem Bekanntenkreis gibt, der von dem Auftreten des autoritären Staates bestürzt ist. Weil er mit eigenen Augen gesehen hatte, was passiert ist. Für alle Anderen ändert sich nur die Heftigkeit ihrer Meinung.
Dem Spiegel kann man entnehmen, dass einige Hundertschaften der Polizei den Befehl verweigert hatten, in die Schanze einzurücken. An dieser Stelle also auch mal ein Dank an die Polizei. Das darf Schule machen. Man muss es wirklich nicht tun.
Ein Gespräch mit einer Freundin, die auch im Glanz der Feuer gefeiert hat. Gut, dass wir nochmal reden. Die Propaganda hatte sich gerade eine Woche lang bemüht, uns das Fest madig zu machen. Es wären fürchterliche Dinge in der Schanze passiert. Gemeint war nicht, dass die Polizei wahllos auf Leute gedroschen hat, als alles vorbei war, oder die Spezialeinheiten, die mit ihren Laserzielvorrichtungen auf die Anwohner geblinkt oder ihnen die Türen eingetreten haben. Gemeint war unser Fest. Es braucht eine Weile, das zu verarbeiten.
Leider wollte sie keinen Aphorismus über die Situation in ihrem Camp schreiben, wo die Hubschrauber die ganze Zeit mit sonorem Brummen präsent waren und das nach einigem falschem Alarm dann doch von der Polizei angegriffen wurde. Der Alltag hätte sie wieder im Griff.
Ein junger Autonomer will auch etwas beitragen. Einen kleinen Text über die Angst bei der Zerschlagung der Höllendemo und die Abwesenheit derselben beim Schanzenfest… Hat ihn aber nicht geschrieben.
Kneipe eine Woche danach. Mein epischer Bericht vom Schanzenfest lockt einen Gast an. Ihr wart in Hamburg? Er war nicht da, strahlt aber über beide Backen: „Ein historischer Sieg“. Oh Youtube, du großer Multiplikator.
Lange nach dem Hamburger Spektakel. Ein alter Freund. Marxist. Er bekommt sofort leuchtende Augen, als es um das Schanzenfest und überhaupt die chaotischen Elemente dieser Tage geht. Er, der eigentlich dem aufständischen Anarchismus sehr fern ist, kommt immer wieder auf einen brennenden Polo zu sprechen. Das sei genau das richtige gewesen, gerade die Wahllosigkeit dieses größeren Klingelstreichs faszinierte ihn. Während die politischen Linken sich von der Polizei bei rituellen Sitzblockaden krankenhausreif schlagen lassen haben, gehen diese Leute woanders hin und zünden ein Auto an und alle schreien. Ihm gefällt das große Fragezeichen dieser Verwüstungszüge.
Er selbst hätte es dann zum Freitag auch noch nach Hamburg geschafft, hat seine Portion Bier an den Feuern der Schanze getrunken, sich selig amüsiert und am Ende im Späti beobachtet, wie – die Autonomen hatten sich längst zurückgezogen – die Polizei sich an den betrunkenen Prols schadlos hielt. Einmal die Straße duchkämmt und auf alles eingedroschen, was sich noch bewegt, eine Parole ruft oder gar eine Flasche schmeißt. Er schildert die Gewalt der oft vermummten Staatsmonster in bunten Farben, kann aber nicht anders, als die ganze Zeit zu lachen. Er hatte verspürt, für was diese Proleten bestraft wurden, hat das zügellose Fest gefeiert, dass ihm einige Autonome ermöglicht hatten.
Jeder – stimmt heute auch gar nicht mehr (‚Des is ja des‘, sagt Ruth in schlechtem Bayrisch) – hält Rimbaud für einen revolutionären Dichter.
Er selbst hat mit einundzwanzig sich entschlossen, nicht mehr literarisch zu schreiben. Sein Gedanke dabei war: Was ich will, läßt sich nicht erfüllen durch solche Protestationen, die ich zu eben diesem Zwecke in ihren Grenzen gänzlich ausgeschöpft habe.
Sofern über den erheblichen Rest des Lebens von Rimbaud bemerkt wird, gilt er als Sklaven- oder Waffenhändler.
Das wurde schon immer wenig zur Kenntnis genommen.
Er selbst hat sich über dieses oder das andere nicht beklagt und fortan mit Kanalbau und dergleichen befaßt.