Broschüre erschienen
Die Helden sind Leise von Ivan Tuw
100 Jahre Novemberrevolution, 50 Jahre antiautoritäre Revolte und 30 Jahre Zerfall des Ostblocks. Es gibt einiges zu feiern, zu bedauern und zu reflektieren. Letzteres insbesondere in Ostdeutschland. Mit selbigen Parolen vergangener Jahrzehnte wird ein faschistisches Programm unterstützt und im Parlament scheinen jene Untertanen stärkste Kraft zu werden. Es geht auffällig alt zu. Viel Aufmerksamkeit all jenen, die einer Post-DDR Generation fehlt. Hier sammelt sich noch am ehesten Mut und Hoffnung, wenngleich die staatlichen Schikanen ungleich höher sind. Die (radikale) Linke verliert sich dabei in bequemer Distinktion und Moral. Der Blick nach Westen könnte Neues ermöglichen. Frankreich ist seit wenigen Jahren Kristallisationspunkt sozialer Kämpfe auf der Höhe der Zeit. Man agiert radikal und abseits des Milieus. Stets bemüht, die Kritik im Handgemenge Wirklichkeit werden zu lassen und der Trostlosigkeit würdevoll zu trotzen. – Klappentext
Fragen, Kritik & Waffen: ivan.tuw(at)protonmail.com
Inhalt
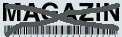
 Broschüre als PDF
Broschüre als PDF