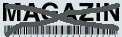Reflexion über eine Berliner Gruppe, die keine sein wollte: Der „Club für sich“ (2006 – 2011)
Vor einigen Jahren versuchte eine mittlerweile längst untergegangene Berliner Kleinstgruppe eine etwas langweilige, bürokratische Theorie über die kapitalistische Gesellschaft im Allgemeinen und ihre spezifische Herrschaftsform im Besonderen unters linksradikale Kleingruppengeflecht zu bringen. Allumfassend sollte die Theorie sein, weshalb man sich etwas Soziologisches mit drei Dimensionen und noch mehr Bereichen ausgedacht hatte. Andere Kleinstgruppen und Einzelpersonen, die im Engeren zur Berliner Theorielinken gezählt werden können, wurden zur öffentlichen Kritikrunde eingeladen. Zwar fiel die Theorie komplett durch, aber die Veranstaltungsreihe war ein voller Erfolg: Zumindest der Theorieflügel der in viele Splitter zerfallenen radikalen Linken kam hier zusammen, regte sich gemeinsam über die Borniertheit und Langeweile der gegebenen Veranstaltung auf und trank danach bei großem Palaver bis in den Morgen alkoholische Getränke. Den Gedanken dieser Gruppe aufnehmend, dass das sterile Gegeneinander der Sekten zu überwinden sei und aus der Erfahrung heraus, dass diese Veranstaltungsreihe die Langeweile mitnichten für sich gepachtet hatte, kam die Idee auf, einen Ort zu schaffen, an dem ein Zueinanderfinden sich realisieren könne. Ein Club, der das Post-Veranstaltungspalaver zur Hauptsache erklärt, an dem ein Kennenlernen möglich werden sollte. Hier sollte jenseits fester, oft einengend erlebter Organisationsstrukturen, eine freiere Kooperation möglich gemacht werden und zu Diskussionen über den bornierten Kreis der immer Gleichen hinaus führen. Dies baut auf der Erkenntnis auf, dass Diskussionen freier und offener geführt werden können, wenn ein gewisses Vertrauen in das Gegenüber vorhanden ist, dass sich im informellen Kreise schneller gewinnen lässt, als auf Veranstaltungen, in denen es eine gewisse Härte gegen sich und die Anderen braucht, um den Anfeindungen der Versammlung gewachsen zu sein und sich in dieser behaupten zu können.
Dies alles gelang nur bedingt. Zwar waren die Abende im ersten Jahr oft recht großartig mit ihren bis in die Nacht hineingehenden Gelagen. Aber schon der Umzug in einen weniger attraktiven Ort machte diesem ein Ende. Als irgendwann nur noch die Veranstalter sich dort miteinander langweilten, musste eine Veränderung her: Der Raum wurde renoviert, jedoch nur, um von den Autonomen oder Postautonomen, bei denen man sich eingenistet hatte, im nächsten Moment wieder in seinen Urzustand zurückversetzt zu werden. Um ja nicht in den Verdacht zu kommen, zu den Gentrifizierern zu gehören, wurde die Hässlichkeit zum Programm erhoben. (Allerdings ist nicht auszuschließen, dass ihnen die ihnen eigene Ästhetik der Politplakate und der eigentümlichen großformatigen Utopiekunst in Verbindung mit einem gewissen Grad an Herunterkommensein – auch einfach gefällt. Immerhin bauten sie eine Bar ein, und damit mochte man wenigstens einen Raum einigermaßen gerne betreten.)
Wie schon die Open-Space-Bewegung hatte auch der „club für sich“ damit zu kämpfen, dass außer den hartgesottenen, meist männlichen Politniks, die auch noch nach vier Bier und um fünf Uhr morgens über das Wertgesetz diskutieren können, in so einem Veranstaltungsort ohne Veranstaltung doch eher der Privatkram, von Beziehung bis Beruf, besprochen wurde und somit der politische Inhalt fehlte. Dies liegt jedoch nicht allein an der Unfähigkeit der Leute, sondern auch an der Vergeblichkeit, die der politischen Diskussion zurzeit innewohnt. Nun mag sich dies in revolutionären Zeiten ändern, aktuell hat jede Diskussion über weltliche Themen, wenn sie von Revolutionären geführt wird, immer den Beigeschmack des Vergeblichen und der Ersatzhandlung: Antideutsche oder Antiimperialisten, die sich in der Phantasie zu Kriegsherren aufspielen, auf welcher Seite sie sich auch gerade befinden, und somit eine ähnliche Figur abgeben wie der Fußballfan, der in den eigenen Augen der bessere Trainer sein würde. Der Klassenkämpfer oder wahlweise auch Bewegungslinke, der sich immer freut, wenn irgendwo eine Streikbewegung mehr Lohn fordert oder ein 3. Welt-Land seinen Präsidenten durch einen anderen ersetzen möchte, und hier großzügig über die theoretischen und politischen Unterschiede hinweggeht, ganz im Gegensatz zu revolutionären Schriften aus den eigenen Reihen, wo schon viel geringere Unterschiede als unzumutbar gelten. So passiert im vergangenen „Aufstandsjahr“, wo oft dieselben Leute, die den Autoren des Büchleins „der kommenden Aufstand“ vorwarfen, dass sie keinen Begriff von Gesellschaft und das marx’sche Wertgesetz nicht verstanden hätten, nahezu euphorisch auf Ägypten und Tunesien schauten, wo die Protagonisten im besseren Fall Demokratieidealisten, im schlechteren Islamisten waren, und sie in Ägypten die Einrichtung einer Militärdiktatur als demokratischer Erfolg feierten.
Auch diejenigen, die ihre eigene Ohnmacht schon vorwegnehmen, indem sie die aktuelle Verstelltheit der Praxis zum politischen Projekt erheben und sich auf Theorie als Praxis beschränken, können kaum mit Leidenschaft an dieser arbeiten. Denn wenn mit diesem Wissen doch nichts anzufangen ist, dann kann man es nur brauchen, um im linken Konkurrenzkampf zu bestehen, oder sich über andere zu stellen, was man dann Agitieren nennen mag. Von der Praxis entkoppelt wird Theorie zum Pflichtprogramm, und man freut sich, schnell wieder zum Privatteil übergehen zu können. Der fehlende Nexus der Theorie zum oftmals komplett gegenläufigen eigenen Leben führt notwendigerweise zur Depression.
Wenn also lieber über Beruf und Beziehung geredet wird als über die allgemeine Verfasstheit der Welt, so deshalb, weil einen ersteres unmittelbar betrifft. Doch ist auch dieser Privatteil, und dass ist Erkenntnis des Feminismus, politisch. Das heißt, wie man lebt und wie das eigene Sein beschaffen ist, ist vollkommen strukturiert durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Deshalb kann, wenn es in diesem Sinne behandelt wird, jedes Thema ein politisches werden. Weshalb also dann nicht Veranstaltungen zu den Themen machen, die die Leute ohnehin beschäftigen – sie quasi da abholen wo sie stehen – nämlich über die Art und Weise wie sie ihre Existenz sichern, und wie man sich in dieser Gesellschaft reproduziert.
So machte der „club für sich“ Veranstaltungen zur Berufstätigkeit. Das Bedürfnis danach war groß. Jeder und jede wollte gerne erzählen, wie es ihm und ihr auf der Arbeit so erginge. Nun waren die meisten von uns nicht dem klassischen Proletariat zugehörig, am ehesten noch die Informatiker. Der Rest war mehrheitlich im verstaatlichen Bereich der Reproduktionsarbeit beschäftigt, also als Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Psychologinnen oder Krankenpfleger tätig. Hier konnte man nun darüber reflektieren, wie in diesen Bereichen die gesellschaftliche Befriedung und Disziplinierung der Staatsbürger vorangetrieben wird, wie aber als disziplinierendes Individuen da hineinzuwirken sei, wurde nicht so ganz klar. Sicher, in den Siebzigern war das Thema gewesen, und einige von uns arbeiteten auch heute noch in solchen Residuen der Macht. Aber auch wenn hier teilweise bessere Arbeitsbedingungen herrschen, so sind diese Bereich doch längst wieder integriert. Nicht nur sind auch hier alle dem Arbeitsfetisch aufgesessen, sondern im Gegensatz zu den legendären Siebzigern kifft und trinkt auch niemand mehr mit den jungen Menschen, oder stößt, wie noch in den Achtzigern, auf den Tod von Herrhausen an.
Die Schizophrenie zwischen der politischen Agitation und der Lohnarbeit war bei den meisten offensichtlich und kaum zu überwinden. Konsequenzen ergaben sich nicht, außer dass es Arbeitsvermittlungen gab. Etwas boshaft oder auch liebevoll spöttisch wurden die Abende auch „Beruferaten“ genannt. So war man eigentlich wieder am Ausgangspunkt: alle Diskussion blieben folgenlos. Jetzt gab es zwar Veranstaltungen, die einen Bezug zum eigenen Alltag herstellten, aber als Ort der politischen Intervention wurde die Arbeit nicht angesehen. Zwar versuchten wir dann mühsam, Leute aus dem Umfeld heranzukarren, die bei klassischen Arbeitskämpfen beteiligt gewesen waren, doch wiesen diese kaum über die Verhältnisse hinaus. Wenn die Arbeit in bisheriger Form abgeschafft, und ihr Inhalt sich als komplett anderer erweisen soll, scheint es etwas müßig, sich im Betriebsrat rumzuärgern. Für diejenigen, die mit Menschen arbeiteten, ergab der linkskommunistische Spruch vom „Kampf in der Arbeit gegen die Arbeit“ oftmals auch kaum Sinn, denn dies ging dann doch nur auf Kosten des Klientels und interessierte sonst niemanden, denn Maschinen zum Stillstellen hat da ja niemand, nicht mal eine S-Bahn, die dann niemanden mehr zur Arbeit bringt.
So besannen wir uns wieder darauf zurück, wo wir denn wirklich politisch tätig waren, und im Gegensatz zur Arbeiterbewegung, bevor sie vom Nationalsozialismus platt gemacht worden war, hatten wir alle unsere Freizeit politisiert. Die meisten von uns hatten sich in ihrer Jugend in westdeutschen Provinzstädtchen in Autonomen Zentren engagiert, einige waren in der Antifa gewesen oder hatten versucht, Uni-Politik zweckzuentfremden, es gab welche, die in parteiunabhängigen Jugendverbänden gewesen waren oder sogar in einer trotzkistischen Partei.
Viele hatten den Eindruck, dass es mal eine Zeit in ihren politischen Leben gab, in der das Sektenwesen nicht ganz so ausgeprägt gewesen war wie heute. Sie wollten von dieser Vergangenheit in den fernen Neunzigern erzählen, als die jeweiligen Abspaltungen der Linken noch miteinander streiten konnten und nicht zu irrelevanten Schulen der reinen Lehre verkümmert waren.
Die Öffentlichkeit nahm diesen Bogen zurück in die eigene Biographie als endgültig ins Privatleben zurückdriftend war. Der „club“ galt als reines Privatvergnügen. Dies gerade zudem Zeitpunkt, wo er sich mit der eigenen politischen Geschichte beschäftigte. Dies zeigt wahrscheinlich eher als das wirkliche Unpolitischsein der Abende, dass die eigene politische Geschichte nicht ernst genommen wird. Mag das auch oft nur verständlich sein bei der Erfolglosigkeit der eigenen Praxis, so ist eine Reflexion auf die eigene Geschichte doch eine Möglichkeit, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, oder sich sogar Anregungen zu holen von längst verschollenen Formen der Zusammenarbeit.
Wenn davon auszugehen ist, dass die aktuelle Linke in ihrer jetzigen Form dem Untergang geweiht sein muss, wenn sie als kommunistisch-anarchistische Bewegung neu entstehen will, dann bedarf es neuer Experimente und Formen des Zusammenschlusses und einer Suche nach neuen Inhalten. Der „club für sich“ bot dies in einem begrenzten Rahmen. Einzelne lernten sich tatsächlich besser kennen; es gab viele Stammgäste. Aber auch wenn die verschiedenen Fraktionen breit vertreten waren, saßen sie oft an verschiedenen Tischen und suchten nur bedingt den Kontakt. Einige Kooperationen kamen zustande, da wurde ein Vortrag organisiert, hier gemeinsam Texte herausgegeben, man lud sich gegenseitig auf Partys und zum Essen ein, und besuchte die jeweiligen Veranstaltungen der Anderen. Andere Kooperationen wurden abgelehnt, was die Fragilität der Gemeinsamkeit zeigte. Denn mehr als die schon vorher bekannten unterschiedlichen Ansichten zu diesem oder jenen, wurde deutlich, dass der „club“ mit seiner Auffassung, das Sektenwesen überwinden zu wollen, doch recht allein dastand. Jedoch hatte man mittlerweile auch das Nötige getan, um alle zu verschrecken: In der Hoffnung, die verschiedenen Fraktion, die aktuell in Form von verschieden Kleinstgruppen erscheint, wieder zusammenzubringen, luden wir sie ein, damit sie uns erzählen, was sie politisch umtreibt und wie sie dieses in die Tat umsetzen. Vor allem wollten wir wissen, ob sie in Inhalt und Praxis ihr eigenes Leben miteinbeziehen oder das aus ihrer Analyse und im Umgang miteinander kein Thema ist. Meisten traten wir oder auch die Gäste an diesen Abenden dann recht hemmungslos auf ihre Schwächen herum. Die abstrakten Politniks wurden gefragt, ob sie sich denn halbwegs aufgehoben fühlen in ihrer Gruppe, wie die Machtstrukturen in ihrer Gruppe wären und ob sie sich manchmal ausgebrannt fühlten. Die Arbeiterfreunde wurden darauf festgenagelt, wie sie denn die Arbeiter ansprechen, ohne sich ihnen anzubiedern und wie sie auf rassistische oder antisemitische Arbeiter reagieren.
Viele wollten auch gar nicht erst kommen, weil sie den Verfassungsschutz witterten und deshalb nicht darüber reden wollten, ob es wirklich nötig ist, dass auf Demos und am besten auch auf Partys Carhatt-Hosen und Northface -Windjacken zu schwarzen Sonnenbrillen das einzig mögliche Outfit sind. Also ob abgeklärte Coolheit + Spektakel in Form von Hochglanzwerbeplakaten und Kampagnenpolitik + Bündnispolitik das Non-plus-ultra sind.
Schließlich wurde der „club“ selber realiter ein solcher Splitter, wie er es nicht hatte sein wollen. Mit vielen verkracht, unfähig die eigenen Konflikte zu klären, und hier die Unterschiede auszuhalten, hatte man sich am Schluss von vielen Genossen entfremdet. Und um die Ironie der Geschichte komplett zu machen, ging, trotz der Reflexion aufs Private, das Ende des „clubs“ mit einem Streit einher, der noch als halbwegs politischer begonnen hatte, aber irgendwann im privaten Kleinkrieg endete, den dann wirklich niemand mehr verstand.