Es ist nicht so kompliziert!
Gegen eine Revolution der Beziehungsweisen
Auf dem Tresen im Januar 2019 verteiltes Flugblatt. Auf demselben Tresen wurde noch zwei Flugblätter über Rosa Luxemburg verteilt. Eines für Adorniten sowie eines für Praktiker.(Ursprüngliche Eintrag mit Minikommentar hier.)

Jakob und Max – als Dank und Versprechen.
1. Den Stand einer Wissenschaft liest man an ihren avanciertesten Vertretern ab. In der Philosophie dürften das Alain Badiou und Quentin Meillassoux sein. Bereits der Umstand, dass Badiou über eine eigene Ontologie verfügt, also eine Lehre von den fundamentalen Strukturen der Wirklichkeit, weitgehend in seiner eigenen Sprache formuliert, macht ihn zur Ausnahme unter gegenwärtigen Philosophen. Und auch wenn diese Ontologie auf der Mathematik basiert, versteht sie sich als eine Verteidigung der Philosophie, dem Denken des Denkens, gegen den postmodernen Angriff auf dasselbe. Auch Meillassoux leitet die Stellung seines spekulativen Realismus aus dem ab, was man Relativismus nennen könnte: die weit verbreitete Überzeugung, dass das Denken eine objektive Wahrheit nie zu Gesicht bekommt, da es immer nur mit Erscheinungen zu tun hat, die relativ zu ihm selbst sind. Aus der Philosophie Kants ist uns der Gedanke, von dem Meillassoux annimmt, dass er derzeit hegemonial ist, bekannt: das Ding an sich, - so wie es ist, wenn wir nicht da sind - erreichen wir nie, sondern immer nur eine subjektive Manipulation, eben eine Relation. Aus Badiou und Meillassoux spricht die Unzufriedenheit des Geistes mit der philosophischen Flachheit unserer Gegenwart. Nähme man ihre beiden Vorschläge als ein Anzeichen dafür, dass von der Philosophie wieder substanzielle Antworten verlangt werden und man sähe in ihnen, was Hegel einmal die »Sehnsucht nach einem Inhalt« genannt hat. Adorno wusste dasselbe noch an Heidegger zu loben: dass es hier um etwas geht. Dieses Interesse nach Philosophie im emphatischen Sinne würde dann das als die Negation der immer noch vorherrschenden, quasi unbesiegbar wirkenden Anti-Metaphysik gelten, die in all ihren Varianten die Universitäten beherrscht.
In diesem Feld positioniert sich Bini Adamczak als Queerfeministin auf der Seite der Dekonstruktion, also als skeptische Transzendentalphilosophin: sie zweifelt die Substantialität der Geschlechter an und fragt nach ihren Möglichkeitsbedingungen. Gleichzeitig aber formuliert sie diesen Queerfeminismus in der Tradition des Marxismus, an dessen Horizont und Sprache sie festhält, insbesondere was ihr Interesse an der Revolution angeht. Der Marxismus aber verstand sich als Realisiererin der Philosophie, als die Vernunft in der Geschichte - eine Vorstellung, die dem an einer Vernunftkritik orientierten Queerfeminismus fremd bleibt. An diesem Widerspruch laboriert Adamczak; er ist die allgemeinste Formel für den Gegenstand ihres Buch.
Das zentrale Konzept, das sie vorschlägt ist die Beziehungsweise, die den marxistischen Begriff der Produktionsweise beerben soll. Was sie stattdessen vorschlägt, verrät der Titel ihres Buches: die Beziehungsweise, um die es geht, ist die Revolution. »Beziehungsweise Revolution« bedeutet, dass sich eine Revolution nicht begrifflich fixieren lässt, sondern in unendlich verwickelten Beziehungsweisen zergliedert, nicht auf die Veränderung der Produktionsverhältnisse reduziert werden darf. Neben der Erweiterung des materialistischen Produktionsparadigmas geht es Adamczak also um die Kritik des idealistischen Begriffs, weil dieser den Phänomenen nicht gerecht wird; die beiden Gedanken sind eigentlich gleichbedeutend. Damit ist auch eine politisch-praktische Position verbunden, nämlich die Kritik an der leninistischen Staatsfixiertheit, von der man zu Recht behaupten kann, dass sie aus dem marxistisch-hegelischen Einheitsgedanken der Dialektik folgt. Beziehungsweise Revolution ist also Ökonomiekritik, Begriffskritik und Staatskritik in einem. Denn: »Tatsächlich besteht der komplexe und breite Prozess der Revolution, in dessen Gefolge die Bolschewiki ermächtigt wurden, in viel mehr als der Übernahme des Staates: in Streikbewegungen, Rätebildungen, Straßendiskussionen, Wohnungsaneignungen, Bandengründungen, vor allem aber in Desertionen und wilden Ladenenteignungen«.
In der Analyse heißt das also, dass dem Begriff der Revolution »eine gewisse Leere wie Größe« zugestanden wird. Praktisch bedeutet es, dezentrale »Mikrorevolutionen« der zentralen Aktion der Bolschewiki gegenüber zu bevorzugen. Das Sollen entspricht daher dem Sein: weil die Revolution sowieso die Vielfältigkeit der individuellen Perspektiven ist, sollen wir als Revolutionäre auch nichts anderes machen, als diese wilde Menge von vielfältigen Interaktionen zu befördern. Von der singulären Situation auszugehen ist also ein Missverständnis, aber in der Umdeutung dieses Missverständnisses erhält man den gewünschten Zustand: die Revolution ist das vergnügte Scheitern aller Anstrengungen, die Revolution in den Griff zu bekommen. »Die Freiheit der Revolution ist somit auch eine Freiheit, sich misszuverstehen«, denn zu großes Einverständnis, ein universeller Konsens, wäre das Gegenteil von Verschiedenheit. Die Revolution ist also der gemeinschaftliche Versuch, die Verschiedenen zu vereinen, ohne sie in dieser Vereinigung zu verneinen. Entsprechend lässt sich der Begriff der Utopie reformulieren. »Als Ensemble von Beziehungsweisen sollte sich das Utopische so rekonzeptualisieren lassen, dass es zugleich Stabilität wie Beweglichkeit transportiert und die utopische Gesellschaft ebensowenig zum Maßstab der Subjekte macht wie andersrum die gegenwärtigen Subjekte zur absoluten Begrenzung der utopischen Gesellschaft«.
Indem sie den engen Begriff der Produktionsweise durch den weiten Begriff der Beziehungsweise ersetzt, gelingt es Adamczak, dem anarchistischen Anspruch – sie bezieht sich auf Gustav Landauer - zu entsprechen, die Utopie in die Revolution zu holen und die Revolution aus der Zukunft in die Gegenwart. Denn: »Missverständlichkeit ist kein alleinstellendes Merkmal der Revolution, das sie von allen anderen Situationen sozialen Handelns unterschiede, die als soziale ebenfalls beständig Anlass für Missverständnisse liefern«. Wir befinden uns folglich immer schon in der revolutionären Phase, deren heiße Periode der Machtergreifung, auf die sich die Leninisten fetischistisch konzentriert haben, nur eine Zuspitzung im fluiden Prozess darstellt; damit aber auch immer schon in der Utopie, an der wir folglich unser Handeln in der Gegenwart messen lassen müssen. Hieraus folgt direkt der adamczaksche Begriff einer positiven Revolution: »Er fokussiert weniger darauf, wie die alte Welt zerschlagen wird, als darauf, wie eine neue aus den Bestandteilen der alten erschaffen werden kann«. Der Gedanke der Beziehungsweise schließt sich zusammen im Symbol der Synapse, welche für die kommunikative Interaktion der Menschen einsteht, aus der Neues entsteht, obwohl nur Altes zur Verfügung stand: »Revolution bedeutet dann radikale Rekombination prä-existierender Elemente, die durch eine neue Verbindung eine neue Essenz erhalten. Relationale Revolution. Weder die Zelle noch das Atom, sondern die Synapse ist Vorbild dieser revolutionären Stiftung anderer Beziehungsweisen«.
2. Mit dem ontologischen Begriff der Beziehungsweise als Seziermesser tritt sie nun an den historischen Block der russischen Revolution heran und zerlegt die sexuellen Utopie dieses Ereignisses, angefangen bei deren Hauptexponenten. Dabei wundert es niemanden, wenn ein knallharter Leninist wie Lenin eine biedere Sexualmoral vertrat, aber dass selbst als progressiv geltende Sexualtheoretikerinnen wie Kollontai einem Kultus der Männlichkeit unterlagen – das könnte doch verwundern. Aber genau dies fördert Adamczak zu Tage: eine strukturelle Blindheit selbst des fortgeschrittenen Marxismus auf dem Gebiet der Sexualität, da auch die progressivsten Genossinnen eine Stufenfolge propagierten, nach der »Männlichkeit als das unhinterfragte Ideal der Emanzipation« galt. Die harten Revolutionäre dienten der gesamten Gesellschaft als Vorbild und vor diesem Paradigma der Durchsetzungsfähigkeit ist es nur verständlich, dass die Sowjetunion kahlrasierte Frauen mit Gewehren akzeptierte, aber keine Genossen in Tutu-Kleid. Die Kritik an der Oktoberrevolution formuliert sich also als Kritik einer Einseitigkeit: Die Tragödie des Weiblichen, also die private Ordnung der Familie, wurde abgewertet, nicht aber zugleich die Komödie des Männlichen, d.i. die öffentliche Ordnung der Politik. »Die Abwertung der »Weibertragödie« ist nämlich nicht universell konzipiert, insofern nur von »Weibern« verlangt wird, solche Tragödien nicht mehr zu produzieren, nicht aber andersrum von »Kerlen«, tragischer zu werden«. Adamczak fordert daher eine vollständige Revolution, die auch Leninisten als drama queens enthielte: »Unter der Bedingung heterosexueller Beziehungsweisen braucht es somit eine Veränderung beider Seiten, um das System im Ganzen zu transformieren...[, also] die Sphären selbst in ihrer Spaltung zu überwinden (Queerfeminismus)«.
3. Hier beginnen die Probleme. Adamczak bringt für diese Gegenrichtung zur bolschewistischen Einheitlichkeit den Differenzbegriff des Revolutionsversuchs von 1968 ins Spiel, der auch historisch Wegbereiter des Queerfeminismus war. In dem, was sie für einen genuin feministischen Revolutionsversuch hält, sieht sie das fehlende Puzzleteil zur Revolution von 1917. Diese Korrektur mag auf den ersten Blick sympathisch wirken und entsprach sicherlich auch dem Selbstverständnis einiger Revolutionäre von 1968. In wenig Punkten bestand – und besteht bis heute - so sehr Einigkeit wie in der Ablehnung des Stalinismus, verstanden als die konsequenteste Durchsetzung des leninistischen Parteibegriffs. Durch das Symbol 1968 lädt sich der Begriff der Revolution also mit anarchistischen Ideen auf: Cohn-Bendit schreibt selbstbewusst und nicht beschämt ein Buch über seine linksradikale Kinderkrankheit und auch Dutschke, ein viel orthodoxerer Marxist, widmet sich einer Kritik am Leninismus. Allerdings unterschlägt Adamczak, dass diese Abwendung von der Sowjetunion keineswegs eine Abwendung von Marx war, der trotzdem in ihrem Buch als der Ursprung autoritären linken Denkens und Handelns ausgemacht wird, aus dem Lenin quasi konsequent folgte. Was sie nicht sieht: es gab Teile von 968, die ein konsequentes 1917 sein wollten. Die Fehleinschätzung von 1968, die das Ereignis diversifiziert und vom Anspruch, das Allgemeine zu verändern, wenig übrig lässt, wäre philologisch-historisch zu verkraften. Nur Pedanten würden sich dafür interessieren, was 1968 wirklich gewesen ist. Problematisch ist, dass mit der »Peripherisierung« (Adamczak) der Revolution, für die 1968 einstehen muss, systematisch der Begriff der gesellschaftlichen Totalität getilgt wird, um den es heute mehr denn je zu tun wäre. Nicht der Umstand, dass sie es falsch versteht, sondern wie sie es falsch verstehen will, führt zu den Ärgernissen ihrer Philosophie.
Vielleicht müsste man das so erklären: Der wahre historische Ort der utopischen Ontologie von Adamczak dürfte der Tunix-Kongress von 1978 sein. Nach dem Scheitern der Offensive 77 im deutschen Herbst, in dessen Folge etliche linke Gruppen einer heftigen Repression durch den Staat ausgesetzt waren, Privatpersonen observiert wurden, harmlose Zeitungsbastler in U-Haft saßen und die Linke in eine generelle Depression zu verfallen drohte, zog der Tunix-Kongress, ungewollt-gewollt, einen Schlussstrich unter das, was man später das rote Jahrzehnt nannte, also die Phase seit 1968. Der Kongress war eine Zusammenkunft aller denkbaren Initiativen, die irgendwie subkulturell waren: Kneipen, Öko-Bauern und Zeitungen, auch die Taz-Gründer erhielten hier viel Zuspruch und so den finalen Anschub, ihr Projekt zu realisieren. Wenn das positiv eine Wende hin zu Lebensreform und Alternativbewegungen war, dann negativ eine Abkehr von den Parteiorganisierungsversuchen: man hatte die nervigen K-Gruppen satt (eine Partei- und Staatsskepsis, die die Gründung der grünen Partei aus dem Geist von Tunix nicht verhinderte...). Philosophisch bedeutete diese Wende eine Abkehr vom Marxismus und eine Orientierung in Richtung Frankreich: statt dem Kapital wollte man Deleuze/Guattari und Foucault lesen, die auf dem Kongress auch anwesend waren und halfen, den Aufruf ins Französische zu übersetzen. Das einigende Band all derer, die an dem Riesentreffen teilnahmen – obwohl die Vorlaufzeit nur wenige Wochen betrug, versammelten sich an dem Wochenende 25000 Menschen in Berlin – war der Wunsch nach einer Utopie, die nicht am Allgemeinen ausgerichtet war. Von der kritischen Theorie, an die das erinnern mag, unterschied man sich aber, lautete die Parole doch: »Es gibt ein richtiges Leben im Falschen!«.
Adamczaks Queerfeminismus bringt diese Idee gut zusammen: ein positiver Begriff der Utopie, der sich von allem Planerischen löst, vor allem dem Fokus auf Partei und Machtergreifung, aber damit auch vom Begriff der Gesellschaft, deren Wesen jetzt nicht mehr theoretisch erfasst werden muss, da die Praxis der unmittelbaren Beziehungen, die die Veränderungen durchführen, an Interesse gewinnt. Die beziehungsweise Revolution ist das antiautoritäre Ereignis der antiautoritären Bewegung, ein 68 von 68 und entsprechend definiert Adamczak ihren Queerfeminismus im Anschluss an Michel Foucault als die Kunst »nicht so sehr indentifiziert zu werden«. Dass diese Kunst eine unendliche ist, lässt sich an der Kritik der Geschlechtsnorm ablesen: Einerseits ist es ihr Anliegen die bürgerliche Kleinfamilie zu verabschieden, also die Frauen vom Herd in Richtung der Kneipe zu bewegen, um die Tragödie des Privaten durch Komödie der Öffentlichkeit zu ersetzen. Andererseits aber kritisiert Adamczak die damit verbundene »Abschaffung von Weiblichkeit« und besinnt sich auf das Private. Der queerfeministische Antitotalitarismus kann es nicht ertragen, die Aufforderung an die Frauen zu richten, Heim und Haus zu verlassen – denn wer legitimiert das Recht, eine solche normative Forderung aufzustellen? Adamczak schwankt also zwischen der Forderung, diejenige Sphäre, mit der Frauen die längste Zeit der Geschichte identifiziert wurden, zu denunzieren, aus dem Grund, dass der Haushalt eine Zumutung für Mann und Frau ist und der Reaffirmation derselben Sphäre, denn aus ihr heraus übt der Begriff der weichen Beziehungsweise Kritik an der harten Politik der Bolschewiki. Dabei ist unklar, ob die Bolschewisten kritisiert werden, weil sie das Emotionale unterdrücken (und das Emotionale an sich wertvoll ist), oder ob das Emotionale nur ein strategischer Kampfbegriff gegen die Bolschewisten ist. Die Einführung des Beziehungsbegriffs jedenfalls führt zur Rückkehr der Revolution aus der öffentlichen Produktionsweise an den Herd des Privaten.
Dieser Prozess ist umso paradoxer, als der Queerfeminismus sich offenbar den Anachronismus erlaubt, Familie, Emotion und alles, was in den Augen der harten Revolution weich erscheint, mit dem Weiblichen gleichzusetzen und die Gewalt überhaupt mit dem Mann. Nun ist es zwar durchaus legitim, historisch die Gewalt der Männer anzuprangern, logisch kann es aber keinen anderen als polemischen Sinn haben, Gewalt an sich mit Männlichkeit, also dem Prinzip Mann, gleichzusetzen, wie Adamczak es durchweg tut, zumal wenn man behauptet, dass ontologisch keine Geschlechter existieren. Der Queerfeminismus hat hier ein ontologisches Problem mit der Gewalt. Man kann das auch so formulieren: wenn Gewalt männlich ist, dann ist es richtig, dass Männer Gewalt ausüben, da das ihrem Begriff entspricht und dann gehören Frauen an den Herd; falls aber Frauen dort nicht eingesperrt werden sollen, ist die Gewalt des Staates keine »androzentrische Matrix« (Adamczak). Dieses Problem vertieft sich für Adamczak, da sie die Gewalt der Revolution als selbsterklärte Revolutionärin schließlich auch affirmieren muss, dann wäre die Frage, ob eine weibliche Revolution überhaupt möglich ist. Entweder geht es ihr um eine Erweiterung der Oktoberrevolution um Fragen des Geschlechts, dann aber visiert sie eine Gesellschaft, die noch umfassender wäre als die der Bolschewiki und ihrer Theorie ist totaler als deren Totalitarismus. Oder aber sie propagiert gegen den Bolschewismus einfach den Rückzug aus der Öffentlichkeit - dann aber bleibt von der Revolution so wenig übrig wie vom Feminismus.
4. Man könnte diese begriffliche Weichheit Adamczaks auf ihren romantischen Anarchismus zurückführen. Sie folgte dann eher der Linie Schelling – Bakunin – Foucault, als der Linie Hegel – Marx – Adorno. Es lässt sich aber noch weiter präzisieren: ihre selbstbewusste Absage an den philosophischen Begriff und damit an die gesellschaftliche Totalität folgt direkt aus der kommunikationstheoretischen Wende der kritischen Theorie, die Jürgen Habermas in den 1980er-Jahren ankündigte und deren bahnbrechender Erfolg – Habermas ist wohl mit Abstand der berühmteste lebende Philosoph Deutschlands – philosophiegeschichtlich noch zu deuten wäre. Denn es ist Jürgen Habermas, der das Praxologische des jungen Marx – Weltveränderung, keine Interpretation! - als Prinzip seiner Philosophie verwendet: sein fundamentalster Begriff ist schließlich das kommunikative Handeln respektive höherstufig: die Lebenswelt, in deren Rahmen Wahrheit zwischen interagierenden Subjekten hergestellt wird, während auf diesen Rahmen selbst ein theoretischer Begriff der Wahrheit nicht angewendet werden darf. Diesem Praxisvorrang oder Theorieverzicht ist Adamczak verpflichtet, ihr Begriff der Beziehungsweise nur ein anderes Wort für Intersubjektivität. Schon Axel Honneth hatte darauf hingewiesen, dass man die Interaktion von Menschen – denn mehr meint der Begriff kommunikatives Handeln eigentlich nicht – auch im Sinne der Auseinandersetzung verstehen kann, als Kampf um Anerkennung; Rahel Jaeggi setzt dieses, sich für antagonistisch haltende, Programm fort und formuliert eine Art Metatheorie der sozialen Bewegungen, in welcher die intersubjektive Auseinandersetzung als Kampf sozialer Gruppen gedacht wird, als Kritik von Lebensformen. Auch hier herrscht freilich das Axiom des Habermas-Paradigmas: die Lebensform an sich lässt sich nicht begreifen, sie ist ein Hintergrund, der sich uns entzieht - mit Wittgenstein: eine Gewissheit, auf der unsere alltäglichen Wahrheiten ruhen oder der blinde Fleck unserer Weltkonstitution. Bringt Honneth den Streit in die Habermas- Gesellschaft und Jaeggi die sozialen Bewegungen, dann Adamczak den Streit in die sozialen Bewegungen.
Jüngst hat Christoph Menke diesen Begriff der praxologischen Befreiung reformuliert: »In dem Nein der Befreiung wirkt nicht die normative Kraft des guten oder besseren Grundes, sondern die Kraft der Negativität, mit der sich der Geist aus der und gegen die Natur hervorbringt; die Befreiung etabliert keine normative Differenz, sondern die Differenz des Normativen«. Das soll bedeuten, dass die soziale Bewegung in ihrem Akt der Negation ein Moment der Nichtartikulierbarkeit mit sich führen muss. Wenn sie ihre Ablehnung gegenüber der alten Welt vollständig in der Begrifflichkeit derselben auszudrücken vermag, handelt es sich nicht um eine Revolution, sondern um eine Reform: »Die Befreiung erkämpft nicht eine Position – den gleichen Status – innerhalb des Sozialen; sie erkämpft das Soziale«. Genau in diesem Sinne konzipiert Bini Adamczaks ihre Revolution, und man könnte diese Indeterminiertheit als eine Version des Bilderverbots der negativen Dialektik begreifen. Aber im Gegensatz zu Adamczak – und wohl auch im Gegensatz zu Menke - hält negative Dialektik fest am Begriff der bestimmten Negation, der auf Gesellschaft angewendet bedeutet, dass diese nicht bloß einen Hintergrund X abgibt, sondern selbst veränderbaren Gesetzen unterliegt, von denen einige fundamentaler sind als andere. Darin besteht ihrer bornierte Treue zur Hegelschen Tradition. Die Dialektik der Befreiung im umfassendsten Sinne stellt die Behauptung auf – denn es lässt sich eben erst in der Zukunft beweisen -, dass die freie Indeterminiertheit der Zukunft abhängig davon ist, wie sie im Rückblick ihre alte Welt hinterlässt; die maximale Abstraktheit im positiven Sinne, die man der postrevolutionären Gesellschaft quasi- anarchistisch zukommen lassen möchte, sei abhängig von ihrem Gegenteil: maximaler Bestimmtheit bei der Negation dessen, was dieser Freiheit als falsche Welt zugrunde lag. Abstraktheit, die alle Türen öffnen will, stutze der Befreiung in Wahrheit die Flügel.
Die gewollte Unterbestimmtheit macht das revolutionär Politische verfügbar für alles Mögliche. Indem nicht mehr von einer bestimmten Revolution die Rede ist, sondern von den Revolutionen im Plural, macht man sich den Begriff der gesellschaftlichen Veränderungen für die Gegenwart nutzbar: »Geschlechtliche Befreiung ließ sich nicht mehr auf ein hypothetisches Morgen vertagen«, zitiert sie zustimmend Dalla Costa und gibt damit das Muster jeden sozialdemokratsichen Verrats ab: das morgige Gute wird für ein weniger schlechtes heute verkauft. Einem solchen Wunsch auf praktische Verbesserungen im Hier und Jetzt, so plausibel er erscheinen mag, steht kritische Theorie unversöhnlich gegenüber, denn der Blick ins Jetzt ist der Blick des Pragmatisten, der, »indem er zum Kriterium von Erkenntnis deren praktische Verwertbarkeit erklärt, sie auf bestehende Verhältnisse vereidige« (Adorno). Niemand kann etwas gegen Verbesserungen sagen, dennoch sind sie theoretisch falsch. Deshalb gilt: » Wird aber am Ende Theorie, der es ums Ganze geht, wenn sie nicht vergeblich sein soll, auf ihren Nutzeffekt jetzt und hier festgenagelt, so widerfährt ihr dasselbe, trotz des Glaubens, sie entrinne der Systemimmanenz« (Adorno).
5. Der gesamten Bewegung akademischer kritischer Theorie, welche sich nach ihrer Deradikalisierung nach dem Tode Adornos, zu reradikalisieren scheint und deren sozialer Anspruch, wenigstens bei Jaeggi und Adamczak nicht in Frage steht, ist ein grundsätzlicher Mangel vorzuhalten: die Begriffsverweigerung oder der Unwille, Gesellschaft als Totalität zu denken. Die einfache Wahrheit, dass diese Gesellschaft eine Unwahrheit ist, scheint den Akademikerinnen zu naiv. Seit Habermas gilt es als avancierter, wenn die Dinge problematisiert werden, womit der selbsternannte Kritiker der Postmoderne einer postmodernen Doktrin folgt. Der Marxismus beispielsweise sei eine einzige Reduktion der Gesellschaft auf einen Hauptwiderspruch, eine Vereinfachung der komplexen Realität. Das ist freilich ein selbst reduktives Urteil über Marx, das allein schon deshalb falsch ist, weil bei Marx vom Hauptwiderspruch nie die Rede ist, sondern bei Mao. Dass man den maoistischen, d.h. politischen Kampfbegriff des Hauptwiderspruchs, der in etwa so etwas meint wie Lenins Begriff vom schwächsten Kettenglied, direkt für die Essenz des Marxismus hält, spricht wiederum vom Praxismus der Habermas-Schule. Nichts liegt dieser Strömung ferner, als den Marxismus oder die kritische Theorie als eine Metaphysik zu begreifen, die von einem Unterschied zwischen der erscheinenden Gesellschaft und ihrem Wesen ausgeht. Philosophie ist dieser Schule nicht mehr als der abstrakte Nachvollzug der Kampflinien, die man mit bloßem Auge auch erkennen kann. So ist der konsequente Habermasianismus der Adamczak, für den alles eine Relation ist, ein Nominalismus, etwa wenn sie schreibt, »dass es so viele Geschlechter wie Menschen gibt«: jeder ist sein eigenes Exemplar. Eine wohlwollende Lektüre sähe darin den Widerspruch zwischen empirischem und transzendentalem Subjekt, denn irgendwas müssen die vielen Individuen ja gemeinsam haben. Aber darum geht es der neueren kritischen Theorie nicht, man flieht dem Allgemeinen, und erklärt das Individuelle zum Prinzip: Politik der ersten Person.
6. So sehr Adamczak sich durch ihren positiven Bezug auf die Revolution und damit auf Lenin, den Schüler Hegels, auch der Objektivität annähert, entgeht ihr Queerfeminismus nicht den Problemen, die diese Theorieanlage bereits bei Judith Butler mit sich führt. Seine Fragerichtung ist philosophisch irreführend, da es ihm ihm nicht um das Sein der Dinge geht, sondern um die Subjekte; ein konstitutives Manko jeder sogenannten Sozialphilosophie. Das Soziale ist bei Butler, sie beerbt hier Habermas, nicht mehr als der Hintergrund vor dem sich die Subjektwerdung abspielt. Da das Telos ihrer Philosophie das Subjekt ist, folgt schlüssig, dass sie das Soziale, im Gegensatz zur kritischen Theorie, affirmiert. Das Normative muss gut sein, denn es »bietet einen Rahmen für den Schauplatz der Anerkennung« (Butler). Aus dieser Perspektive folgt der Revisionismus: während kritische Theorie Einsicht in das Gesellschaftliche erzwingen will, um es abzuschaffen, findet sich der anti-objektive Standpunkt Butlers mit derselben ab und begründet das damit, dass es »immer einen Bezug zu solchen Normen gibt« (Butler). Weil man Normativität nicht wegdenken kann, auch nicht die der falschen Gesellschaft. Hieraus folgt der Opportunismus. Die Frage lautet nicht mehr: Was könnte die Welt sein? Sondern: »Was kann ich angesichts der gegenwärtigen Ordnung des Seins werden?« (Butler). Wer an die Karrieren der Revolutionäre von 1968 denkt, wird sich seinen Teil denken; der Queerfeminismus ordnet sich hier ein: in Wahrheit ist er eine Philosophie der Aufsteiger, oder vielmehr die Philosophie derjenigen, die sich nicht verziehen haben, dass sie den Aufstieg noch nicht (ausreichend) geschafft haben, d.i. eine Philosophie des gekränkten Narzissmus.
Das wirkt sich negativ auf Adamczaks ehrenwertes Ziel einer Revolution aus. Will sie die Nachfolgerin des Leninismus sein, muss sie sich die Frage stellen lassen, welcher Gesellschaftsanalyse sie sich als Revolutionstheorie anbietet. Lenin jedenfalls sah sich als das Nebengebäude oder Folgeprodukt von Marx. Welchen Begriff von der Wirklichkeit aber hat Adamczak? Es ist zu befürchten, dass dies der blinde Fleck ihrer Philosophie ist. Maximal weist sie dann als eine fortschrittliche Leninistin darauf hin, dass dem Ziel der Revolution nicht alles unterzuordnen ist, sondern die Mittelwahl auf den Zweck zurückwirkt, also das Zwischenmenschliche der Organisation mehr als ein Werkzeug für die Machtergreifung ist, nämlich das eigentliche Ziel der Revolution. Aber gerade dieser Gedanke müsste sie zur Objektivität führen, durch die alles Zwischenmenschliche vermittelt ist. Weil das nicht geschieht, ist zu befürchten, dass der Butlerfall eintritt und sie sich hauptsächlich für die »in der ethischen Frage eingenommene Perspektive der ersten Person sowie die direkte Anrede an ein ›Du‹« (Butler) begeistert. Dann landete sie bei den Problemen des Kampfes um Anerkennung, den die Franzosen fälschlicherweise für das Herzstück der Hegelschen Philosophie halten und die universitäre Philosophie so gerne diskutiert, weil seine Dialektik so allgemeinverständlich wie dramatisch ist und es in keinem Fall eine zufriedenstellende Lösung gibt. Dann ginge es der Beziehungsweise Adamczaks um »die Andere in ihrer Andersheit« (Butler), dann würde die empirische »Frage, wie ich einen anderen behandeln soll« (Butler) philosophisch aufgebauscht zum Mystikum der »Alterität« (Butler) und Adamczak zur Erbin der schwülstigen Butler, bei der aus der anthropologischen Frage Wer bin ich? Und was ist der Mensch? die gequälte, passiv-aggressive Frage nach dem Wesen des Du-Seins wird: »Wer bist du?«. Kein vernünftiger Mensch kann so eine Philosophie wollen. Aber Großstadtbewohnern mag sie helfen, ihre Beziehungskrisen für das Thema der Weltweisheit zu halten oder sich auf MDMA tief in die vollmondartigen Augen zu schauen und sich darüber zu freuen, dass sie - »dialektisch« - im Anderen bei sich sind (und doch wieder nicht).
7. Aber bei Adamczak lässt sich eine Tendenz zum Vernünftigen und nicht bloß Verständigen feststellen, nicht nur in ihren theoretischen Referenzpunkten, sondern auch in ihrem phasenweise dialektischen Vokabular. Dieser Drang zur Systematisierung kämpft gegen die philosophische Weigerung, Gesellschaft als Totalität zu denken oder politisch konkret zu werden. Das Überplausible und das Nichtssagende gehen hier Hand in Hand. Polemisch könnte man fragen, ob nicht das gerade gegen die Revolution der Beziehungsweise spricht: dass niemand ihr wirklich widersprechen kann, weil sich jeder in ihr wiedererkennt. Da die Revolution nichts sei, was erst noch kommen müsste, sondern immer bereits vorhanden, wäre es wohlverstanden gar nicht möglich, gegen die Revolution zu sein, außer man verließe die Gesellschaft. So wird die Wahrheit der Revolution zum Allgemeinplatz. Sie gilt überzeitlich und für alle Menschen zugleich – ein antikes Konzept von Wahrheit, das Adamczaks materialistischer Intention, den Kommunismus gerade nicht als Idee, also als Überzeitliches zu verstehen, widersprechen muss. Die explizite Ideenlehre des Hegelleninismus, die bereit ist, die Zeitlichkeit seiner Überzeitlichkeit zu denken, dürfte diesem Ansatz, dem das Theorem der Überzeitlichkeit eigentlich extern ist, überlegen sein. Ihrzufolge realisiert sich die Wahrheit immer in einer bestimmten Partei, ist also nicht für alle gleichzeitig gültig und auch nicht für alle Zeiten dieselbe. Außerdem ist sie exklusiv: nicht jeder gehört zu ihr, es ist möglich außerhalb der Wahrheit zu leben, etwa wenn man die falsche Partei ergreift. Gegen Adamczaks Revolutionsbegriff spricht auch, dass sie kaum Fronten ziehen kann.
Dass es trotzdem eine Revolution ohne Feinde nicht geben kann, ahnt auch Adamczak: Obwohl sie keinen Begriff der Partei hat, weil dieser sie auf ein Universal verpflichten würde, ist Adamczak parteilich, und zwar für alles, was sie für weiblich hält, also für schwach, und gegen alles, was stark ist, also männlich. Im Ansatz erkennt man an dieser Willkür, wozu der Queerfeminismus in der Lage ist, wenn er das Gefühl moralischer Überlegenheit an einen notorisch unterbestimmten Feind koppelt: das Männliche. Bei Adamczak selbst bleibt es bei der Empörung über die Anmaßung der Bolschewiki. Aber die Monster, die der Schlummer der Vernunft heraufbeschwören kann, lassen sich auch in ihr ganz gut erahnen.
7. Die Anlage zum Wahn folgt aus der Subjektperspektive der Queerfeministinnen, deren logische Inkonsequenz das fortlaufende Thema der Hegelschen Philosophie ist. Erkenntnistheoretisch etwa kritisiert Hegel Subjektphilosophie, da diese, weil ihr nichts unabhängig vom individuellen Standpunkt ist, zu keiner Wahrheit gelangt. Hierin zeigt sich, inwiefern die gegenwärtigste Philosophie mindestens Quentin Meillassouxs auch eine Reaktion auf die Logik des Queerfeminismus ist. Von ihm stammt der für unsere Gegenwart absolut gültige Satz, dass die Abwesenheit des Absoluten den Raum für den Fanatismus schafft. Dieser Gedanke stammt von Hegel. Weltlos ist das Subjekt, das sich für das Maß aller Dinge hält. Die schöne Seele, die in der Phänomenologie präsentiert wird, kommt nie zu einer Handlung, da keine einzelne Tat ihr würdig genug erscheint, den ganzen Reichtum ihrer Subjektivität auszudrücken. In jeder Konkretisierung droht die Gefahr, auf diese Handlung reduziert zu werden, womit das Subjekt seine individuelle Allgemeinheit - die mit der transzendentalen verwoben ist, aber nicht unmittelbar für dieselbe gehalten werden darf – verloren gäbe, welche die Würde seine Wesens ausmacht, weshalb das Risiko einer Handlung zu groß ist. (1) Hegel zielt mit dieser Stilisierung auf Kant: keine Handlung wird dem Sittengesetz jemals gerecht, da dieses zu allgemein ist, was die Subjekte eigentlich zu Handlungslosigkeit verdammen müsste oder aber, falls sie trotzdem handelten, zu Sittenwidrigkeit. Aus der paradoxen Struktur erwächst eine ungeheure Macht: einmal eingesehen, dass es kein geheimes Gesetz gibt, weil dieses inkonsistent ist, kann praktisch jede Handlung vollzogen oder, da keine Handlung jemals gut genug ist, alle Handlungen der anderen kritisiert werden; wahlweise kritisiert man dann, dass Frauen zu Hause bleiben müssen oder im Gegenteil: dass sie aufgefordert werden, das Haus zu verlassen. Eine teufliche Mischung aus unmoralischer Willkür und Hyper-Moral.
Die hegelsche Antwort darauf ist, den subjektiven Standpunkt aufzugeben, der sich nicht durchhalten lässt, da sich kein Subjekt, nicht einmal die schöne Seele, der vorgängigen Allgemeinheit entziehen kann, in die es empirisch hineingeboren wird und in der es sich logisch auch dann befindet, wenn es überhaupt nichts tut. Man kann dem Allgemeinen nicht entgehen. Nicht viel mehr meint der Begriff der Totalität: es gibt eine Allgemeinheit, in der alle Handlungen zusammenkommen, in der alle subjektiven Maximen daher wertlos werden und Staat ist der gesellschaftliche Name für diese Form der Allgemeinheit. Der Staat als Form bedeutet: selbst wenn man für einen absterbenden Staat einsteht, affirmiert man einen logischen Punkt, der im Jenseits der horizontalen Beziehungsweisen dieselben (auch in Disharmonie) harmonisiert. Selbst wenn man den Staat abschaffen will, denkt man den Staat - man sagt es nur nicht.
Marx Begriff der Arbeit könnte verstanden werden als der materialistische Nachfolger des Hegelschen Staatsbegriff, weil er eine höchste Einheit zu denken in der Lage ist, die noch dazu über die bestehenden Produktionsverhältnisse hinausgeht. Weil Zweck und Mittel in der gesellschaftlichen Arbeit ihre Einheit finden, kann Marx behaupten, der Materialismus sei die Verwirklichung der Philosophie. Was das bedeutet zeigt sich gut an der bürgerlichen Moral. Der Marxismus kann sich ohne Weiteres als die Verwirklichung der Wahrheit verstehen, die im kantischen Sittengesetz abstrakt enthalten war. Wenn Kant schreibt, man solle den Mensch jederzeit zugleich als Zweck, nie bloß als Mittel behandeln, ist der Begriff der Arbeit dazu in der Lage, dem ansonsten abstrakten Prinzip eine Basis in der Wirklichkeit zu geben, einfach dadurch, dass er es beim Wort nimmt. Dieses Emporheben meinte das Sprengen der Produktionsverhältnisse im Sozialismus: plötzlich ist da, bedingt durch eine Reflexion, mehr als eigentlich vorhanden ist. Wer das für einen Reduktionismus hält, weil alles scheinbar ökonomisiert wird, verwechselt die Ebene: der Begriff der Arbeit ist der Gegenbegriff zum maximal ausgeweiteten Begriff des Bedürfnisses, Nachfolger des Gedankens Hegels und damit noch allgemeiner als dieser gefasst: es gibt nichts, was ihm gedanklich entginge.
8. Einem solchen Begriff von Totalität kann man sich gar nicht widersetzen und erst recht nicht widersetzen wollen. Das zeigt sich auch in Adamczaks Buch: hier widersetzt sich die Sprache der nur gemeinten antitotalitären Intention der Autorin. Abzulesen ist das an den Passagen, in denen sie vom Geschlecht als Reichtum spricht, also in der politökonomischen Terminologie der Bolschewisten, die sie eigentlich ablehnen müsste. Da ist die Rede vom »Ensemble an habituellen, affektiven, kognitiven, praktischen, epistemischen usw. Ressourcen, die von einer sich befreienden Menschheit angeeignet werden können«. In der Tradition der marxschen Frühschriften wird hier also der vermeintliche Gegenbereich zur Gesellschaft, das Private, in einer Sprache der Allgemeinheit gefasst. Pointiert: der Sexus wird als Teil der Wirtschaft begriffen, sodass »geschlechtliche Beziehungen unmittelbar aus einem Wechselspiel von physiologischen Bedürfnis und wirtschaftlicher Basis« (Adamczak) begriffen werden. Folgte sie vollständig dem queerfeministischen Paradigma einer Butler, müsste sie »den Gestus der Aneignung« strikt verwerfen, weil sein »Stil der des Imperialismus ist« (Butler): Aber als Philosophin übt Adamczak Verrat am vom Queerfeminismus auferlegten Verbot des Allgemeinen. Im verräterischen Gedanken des Zwischenmenschlichen als Produktionsfaktor steckt, auch wenn es für manche Ohren grässlich klingen mag, die Aufhebung des falschen Gegensatzes von Privatem und Allgemeinem; die Idee einer Versöhnung, die, weil nur es das Private gewährleisten kann, auch in der Sphäre des Allgemeinen stattfinden muss oder aufhört Versöhnung zu sein. Logisch ist jede Philosophie Leninismus. Queerfeministische Kritiker mögen das für einen Rückfall in die Härte der Bolschewiki halten, weil das Polymorphe des Privaten gedanklich dem Kalkül unterworfen wird. Aber der spekulative Gedanke steckt darin, die Utopie momenthaft als eine Planwirtschaft zu begreifen, in der das Zärtliche ein zu verarbeitender Rohstoff ist wie Baumwolle.
9. Zöge man diesen durchaus im positiven Sinne totalitären Gedanken, entwickelte man eine Revolutionstheorie, die auf ihre Zeit reagiert und ihr etwas entgegensetzt. Der Queerfeminismus weiß zwar inzwischen auch, dass er ganz gut zum neoliberalen Hochlebenlassen des Individuums passt, aber zieht daraus, da ihm Stringenz kein Ideal ist, keine Konsequenzen. »Die Verbindung queerer Theorie mit Momenten neoliberaler Subjektivierung wird dem Queerfeminismus vorgeworfen«, weiß Adamczak, aber das Problem ist hierbei nicht, dass der Queerfeminismus das Subjekt fördert, wie Neoliberalismus, aber auch der Kommunismus, sondern dass er die revolutionäre Position nicht an den Produktionsverhältnissen entwickelt, allemal den historischen. Ihre Position ist pseudohistorisch, was sich auch daran zeigt, dass sie den Bezug zu Habermas nachmetaphysischem Denken, in dessen Namen Adamczak gegen einen »falschen Universalismus« (Adamczak) kämpft und Gesellschaft durch intersubjektive Normen ersetzt, nicht deklariert. Ihre eigene Gegenwartsdiagnose einer »Feminisierung der gesellschaftlichen Institutionen«, der an der Oberfläche der postindustriellen Gesellschaft wohl etwas trifft, hat daher keine Folgen für ihre Theorie. Oder als Gedankenexperiment: Wenn es 1968 richtig war gegen die männliche Gesellschaft durch Weiblichkeit aufzubegehren, müsste heute gegen die weibliche ein neuer Maskulinismus ins Feld ziehen. Denn: »Sexarbeiterinnen, Hausfrauen, Mütter sind die Prototypen dieser neuen Arbeitsverhältnisse. Ihre Affektivität, flexible Zeitlichkeit und Identifikation sind das Ideal der veränderten Ausbeutungsverhältnisse«. Demgegenüber wäre also männliche Härte subversiv: »Unter den neuen Arbeitsbedingungen erscheint gerade eine Arbeiterin, die nach der Stechuhr zu arbeiten versucht, die sich keine Zeit nimmt für die Befindlichkeiten und Macken der Kundin, die jedes Problem nur nach Vorschrift und abstrakten Regel zu lösen versucht, als mackenhaft, als irrational«. Solche Schlüsse sind zwar Fehlschlüsse, aber es sind die aussagekräftigen Fehlschlüsse des Queerfeminismus.
»Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat«, sagt Rosa Luxemburg und erklärt damit auch, warum die viel gescholtene Praxisferne der kritischen Theorie vielleicht revolutionärer ist, als die Tatkraft der praktischen Partei, die viel von Veränderung und wenig über das zu Verändernde redet. Begriffliche Härte ist eine revolutionäre Tugend. Heute mehr denn je wäre zu fragen, ob Einheit und Allgemeinheit nicht Kampfbegriffe revolutionärer Philosophie sein müssten. Denn auch wenn Adamczak ihre Beobachtungen über die Postindustrie vergeschlechtlicht, bleibt ja zutreffend, dass der Begriff der verwalteten Welt, um den herum die kritische Theorie entworfen wurde, weniger zutrifft als noch vor 60 Jahren; dagegen muss nicht als Mann revoltiert werden, wie aus Adamczak folgen würde, sondern als Philosophie. Der Kapitalismus hat die Künstlerkritik aufgenommen, das weiß jeder im ersten Semester: die Soziologen sprechen davon, dass die Logik des Allgemeinen von einer »Logik des Besonderen« (Reckwitz) abgelöst wurde. Die wahre Bedeutung des Geistes von Tunix wäre erst dann verstanden, wenn man diesen Kongress, der eine einzige Party war, in eine Beziehung brächte zur Allgegenwart des Festivals in der heutigen Populärkultur. Das hieße, Phänomene wie die Fusion nicht als Revolten zu begreifen, sondern als Momente der Systemintegration. Der Vorschlag lautet daher, mit anderen Begriffen und Aktionen für das Nichtidentische einzutreten – ein anderer Begriff von Identitätspolitik ist möglich.
Philosophie ist nie die bloße Analyse des Seins, sondern wählt zu ihrer Darstellung auch die herrschenden Formen des Bewusstseins, in denen sie sich bewegt, um Inkonsequenzen aufzudecken oder Fronten zu ziehen: ein wirkliche Verwirklichung des Besonderen würde eine Veränderung des Allgemeinen verlangen, die noch nicht stattgefunden hat, daher ist jede reckwitzsche Soziologie, die das Besondere an der Macht sieht, eine Unwahrheit. Aber in solcher Unwahrheit die uneingelöste Wahrheit der Ideologie zu sehen, und nicht die blanke Lüge, ist eine Technik der kritischen Theorie, der man ihre bisherige Funktionalität nicht absprechen kann. Wenn Adorno in diesem Sinne von der Verwirklichung des hegelschen Systems im Kapitalismus sprach und später gegen den identitären Geist der logischen Positivisten seinen Begriff des Nichtidentischen formte, der über das Bestehende zu einer Synthese der Versöhnung hinaus wollte, in der die Differenz wirklich wäre - können wir heute dann nicht versuchen zu sagen: Adorno hat sich verwirklicht? Das Nichtidentische, die Abweichung wäre dann zum Prinzip des Identischen geworden, deswegen triebe es die Spekulation wieder in Richtung des Identischen.
Nichts wäre dann unwahrer als nachmetaphysisches Denken. Adorno wusste, dass in Gesten die Kraft des Gedankens liegt: er selbst nannte Marx einen Metaphysiker, um ihn gegen die Starrköpfe in West und Ost zu verteidigen. Solche Schritte gilt es zu wiederholen. Philosophisch bedeutet das, sich der Paradoxie nicht zu schämen, die Habermas für den wunden Punkt der kritischen Theorie hält, dass es nämlich der Gedanke ist, der auch in ihr, die zum Nichtidentischen will, das letzte Wort behält. Die utopische Gedankenlosigkeit der kritischen Theorie ist ein denkerisches Programm. Hoch lebe also der Gedanke! Selbst der Versuch, kohärente Philosophie, etwa in Form unverdächtiger Wissenschaftstheorie, zu betreiben, wird auf Voraussetzungen basieren, die letztlich metaphysisch sind. Die Reinheit des Gedankens, die der Queerfeminismus anstrebt ist mit solch ideologischem Kohärenzdenken verwandt. Der Unterschied bestünde dann darin, dass kritische Theorie die Unmöglichkeit, eine voraussetzungslose Position zu vertreten, akzeptiert und selbstbewusst Metaphysik betreibt, d.h. der Fähigkeit des Gedankens vertraut, in seinem Verlauf, die eigenen Voraussetzungen zu setzen.
Der Widerspruch bleibt, dass nur die Gewalt, zu der die Metaphysik für ihre Feinde zählt, aus dem Zwangszusammenhang hinausführt; dass nur die reflexive Wiederholung einen Ausweg aus der Wiederkehr des Immergleichen bietet, dem der Ausbruch stets verhaftet bleibt. Eine Revolution, welcher Strenge keine Tugend ist, wird keine Revolution sein, weshalb die Beziehungsweise nicht unsere Revolution sein kann, auch wenn ein Lenin im Kleid ab jetzt zu ihrer Ikonographie gehört. Aber ein leninistischer Lenin, denn nur das konzentrierte Sichzusammenziehen des Geistes erreicht den Boden desjenigen Reiches der unbeschränkten Entfaltung, welches solcher Kraftakte nicht mehr bedürfte, und welches wir daher Utopie nennen. Mehr denn je ist daher an die kämpferische frühe kritische Theorie zu erinnern:
»In der Organisation und Gemeinschaft
der Kämpfenden erscheint trotz aller Disziplin,
die in der Notwendigkeit, sich durchzusetzen,
begründet ist, etwas von der Freiheit und
Spontaneität der Zukunft.«
(1) Etwas von der Überwindung dieser Angst steckt in jedem Sozialisationsprozess.
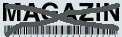
 Es ist nicht so kompliziert!
Es ist nicht so kompliziert!