Vortrag der Antifa c
Wozu Phallus in dürftiger Zeit?
Vortrag auf dem kommunistischen Tresen am 20.12.2019. Schon dessen hier dokumentierten Ankündigungen hatte zur vorläufigen Abkehr einiger Szenelinker vom kommunistischen Tresen geführt. Später kam es noch zu diesem Flugblatt, diesem knappen amtslinken Blablabla und diesem länglichem amtslinken Blablabla. Der Vortrag leitete ferner zu zwei hervoragenden Abschlußtresen über und damit pünktlich vor der Königsgrippe zum Zusammenbruch dieses Tresens.
Im Flur einer US-amerikanischen Universität unterhalten sich zwei Mädchen. Die eine berichtet begeistert von einer „feministischen Intervention“ in einem Seminar, das sie besucht: eine Teilnehmerin sei in der ersten Sitzung aufgestanden und habe verkündet, hier würden sich nur Männer am eigenen Jargon erigieren und dem wolle sie nicht beiwohnen, dann sei sie gegangen. Das andere Mädchen im Flur fragt daraufhin: „Aber warum wollte die Frau denn nicht einfach auch erigieren?“, worauf das erste nur verwirrt-empört dreinschauen kann. Wir hegen natürlich Sympathien für das zweite Mädchen. Denn jeder weiß, dass niemand ein Problem hat mit Frauen, die abspritzen, und statt des hilfs- und begriffslosen passiven Rückzugs, der abstrakten Negation dessen, für das man eigentlich nur zu schwach ist und das folglich unangegriffen bleibt, befürwortet sie dessen konkrete Affirmation: Angriff ist die beste Verteidigung. Die Begeisterung des ersten Mädchens und deren Gegenstand hingegen sind in etwa das, wofür der Feminismus heute steht, euphorische Selbstviktimisierung, die Weinerlichkeit als politisches Mittel bedeutet. Nun könnte einem das relativ egal sein, wenn es bei diesem Rückzug bliebe, aber: der Tat folgt die Theoretisierung dieser Tat und so ist man überall mit den entsprechenden Ergüssen konfrontiert.
Zuletzt beispielsweise in der Rede vom Femizid. 116 Frauen wurden im vergangenen Jahr von Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Dass es sich dabei um brutale Verbrechen handelt, ist keine Frage, und auch nicht, dass die Täter gerichtlich verurteilt gehören. Diese Verbrechen aber einfach qua des beliebten Gender-Filters zu erklären, funktioniert nicht. Morde an (Ex-) Partnerinnen sollten begriffen werden als motiviert aus gekränktem Narzissmus und charakterlicher Schwäche, die einen zivilisierten Umgang mit dieser Kränkung verhindert. Femizid bedeutet Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind und impliziert so ein systematisches Vorgehen, er ließe sich also vielleicht in Fällen von Ehrenmorden oder selektiver Abtreibung rechtfertigen, obgleich auch hier offensichtlich treffendere Begriffe existieren und Spezifizierungen nötig sind. In Deutschland vom Femizid zu sprechen, um häusliche Gewalt an Frauen zu beschreiben ist jedoch schlicht wahnhaft und relativiert die zuvor genannten Gewaltakte. Wie bei so vielen genderpolitischen Trends stammt auch dieser Begriff aus dem anglophonen Raum, wo er im 19. Jahrhundert als Gegenbegriff zu „homicide“ benutzt und in den 1970er Jahren wiederentdeckt wurde, um den systematischen Aspekt von Gewalt gegen Frauen zu betonen. Er bewegt sich damit mitunter auf der Ebene sprachpolitischer Spielchen à la „herstory“ statt „history“ zu verwenden. Häusliche Gewalt ist jedoch keine diskurspolitische Problematik, sondern eine Reale: Im konkreten Einzelfall kann sie nur durch Geld oder Waffen gelöst werden. Gesamtgesellschaftlich muss Frauen beigebracht werden, sich auf bestimmte Beziehungen gar nicht erst einzulassen und sich in anderen Beziehungen zu behaupten und Arschlöcher zu verlassen. Das ist kein sogenanntes „Victim-Blaming“, sondern die Forderung einer Erziehung zur Mündigkeit und zu Ich-Stärke. Zugleich muss für finanzielle Unterstützung im Zweifelsfall gesorgt sein. Auch hat eine Gesellschaft dafür zu sorgen, dass ihre Mitglieder sich zivilisiert verhalten und das bedeutet, dass bestimmte Handlungen verboten und bestraft werden, und Männern ein respektvoller Umgang mit Frauen, und ein erwachsener mit Kränkungen beigebracht wird.
Diese Rede vom Femizid wird gängiger Weise erklärt durch den Verweis auf patriarchale Strukturen. Dieser Verweis ist jedoch ebenso wahnhaft, wie die Rede vom Femizid selbst. Will man sie sich erklären, vergegenwärtigt man sich am besten, dass der Vorteil der Paranoia für die Paranoiden darin besteht, dass sie ein Kategoriennetz bietet, dass die Anstrengung des selbstständigen Denkens erspart. Ob „Patriarchat“, „patriarchale Strukturen“ oder fancy und wertkritisch „warenproduzierendes Patriarchat“: diese Begriffe gehen in westlichen Gesellschaften fehl, weil sie eine gesellschaftliche Institutionalisierung der Unterdrückung von Frauen suggerieren, die so nicht mehr gegeben ist. Auch beliebte Gegenbeispiele, wie dass Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 Straftatbestand ist, oder die Versuche von der Reetablierung von Abtreibungsverboten helfen hier nicht weiter. Solche Fälle sind als Aufklärungsdefizite und Atavismen zu begreifen. Das bedeutet im zweiten Fall auch, ihn in seiner Komplexität zu analysieren und das heißt: sowohl die Dimension der weiblichen Selbstbestimmung als auch die biologische und philosophische Frage nach dem Beginn des Lebens ernst zu nehmen, was wiederum heißt: rationale und ideologische Positionen in beiden Fällen unterscheiden zu können. Einfacher ist es jedoch, den Vorgaben des Schemas Patriarchat alle Alltäglichkeiten und politischen Probleme einzuspeisen, dabei einen übermächtigen Aggressor zu schaffen und sich dann auf die Schutzbedürftigkeit vor diesem zu berufen. Mit Quentin Tarantino ist dem zu entgegnen: „I don’t accept your premises.“
Der Feminismus war nie wieder so würdevoll wie in seinen Anfängen. Im Jahre 1910 konnte und musste Clara Zetkin noch fordern: „Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“, eine Forderung, die strotzt von Dynamik, Kraft und Selbstbewusstsein. Mit der zunehmenden Realisierung dieser Forderung ist dem westlichen Feminismus nach und nach der unmittelbare Gegner abhandengekommen, den Individuen nicht aber das Bedürfnis sich qua Thematisierung des eigenen Andersseins als Subjekte zu konstituieren: Sonderrechte zu fordern. Dieses Bedürfnis ist sogar in umgekehrter Proportionalität gewachsen und entspricht heute dem allgemeinen Zeitgeist. Getrost kann mit Simone de Beauvoir eine der letzten Größen aus dem politischen Spektrum des Feminismus benannt werden, die um ein unaufgeregtes und unmoralisches Schreiben tatsächlich bemüht war. Denn schon die Parole „Das Persönliche ist politisch“ der zweiten Welle des Feminismus ist Ausdruck der Abkehr von der gesellschaftlichen Objektivität. Die Etablierung von Frauenzentren und anderen Schutzeinrichtungen in den 1970er Jahren war dabei jedoch immerhin noch ein – absolut notwendiger – Schritt zurück in diese: die Öffentlichkeit wurde aktiv umgestaltet, die Änderung von Gesetzestexten erkämpft, eine Basis für die Eroberung der Allgemeinheit geschaffen. Auch heute noch sind solche Kämpfe zu kämpfen, ginge es den Feministen tatsächlich um Gewalt an Frauen, statt um ihre eigene Identität, organisierten sie sich gegen Genitalverstümmelungen, statt die Klitoris zu verleugnen oder gegen Hexenverfolgungen, statt Hexe zu spielen.
Doch dieses Projekt einer Eroberung der Allgemeinheit, das sich der Ökonomie hätte zuwenden müssen, wurde naturgemäß nicht verfolgt und der jüngere Feminismus übte sich lieber im Mantra der Schutzbedürftigkeit von „Frauen*“. Diese wird jedoch nicht zur gesellschaftlichen Frage gemacht, weil sie nicht mehr dazu gemacht werden kann – auch wenn eben dies mit dem Patriarchatsbegriff versucht wird –, sondern zur individuellen. So werden weibliche Subjekte geprägt, die lernen Schuld zuzuweisen, anstatt Angriffe abzuwehren, zu fühlen, statt zu denken, und so letztlich alte sexistische Klischées zu erfüllen. Paradoxerweise ist das aber eben Resultat des Feminismus und weiblicher Selbstviktimisierung: Erziehung zur Weinerlichkeit. Diese Weinerlichkeit wiederum steht jeder Form von selbstbewussten Entwürfen wie dem Clara Zetkins entgegen. Und der Blick zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts verhöhnt den gegenwärtigen Feminismus geradezu: Der Erfolg von Frauen wie Rosa Luxemburg oder Virginia Woolf schon damals nimmt dem Gejammer über die gegenwärtigen „patriarchalen Zustände“ und deren Zwänge jede Glaubwürdigkeit, stützt aber unsere These: Sobald ein bestimmter Zivilisationsgrad erreicht ist, muss sich die Frau selbst aufrichten; wer dominantes und tätiges Subjekt sein will, muss wie eines handeln, anstatt eine entsprechende Behandlung einzuklagen und sich durch diese Klage zur Passivität zu verdammen. Es waren immer solche Frauen, die die allgemeine wie die Frauenemanzipation, die selbstverständlich verschwistert sind, vorangetrieben haben. Eine Anerkennung nur aufgrund ihrer Weiblichkeit wäre eine Beleidigung für sie, so wie es heute eine Beleidigung für Frauen ist, sie sprechen zu lassen, nur weil sie Frauen sind und so das Augenmerk wegzulenken von dem was sie sagen. Kaum mehr anderes bleibt dem jüngeren Feminismus, weil es eben natürlich gesellschaftliche Bereiche gibt, die ein Einschreiten erfordern würden. Das sind aber die Bereiche, die der auf die Reinheit politischer Korrektheit bedachte Feminismus lieber meidet, wie etwa die mitunter brutale Unterdrückung von Frauen im Islam, oder Bereiche, für die der zeitgenössische Feminismus als neoliberale Mittelklassebewegung blind ist, etwa die Unterbezahlung von weiblichen Arbeitskräften in vielen Berufen. Stattdessen ergeht er sich akademischen Sprachspielen und pubertärem und selbst-inszenatorischem Netzaktivismus oder versteckt sich zur Self-Care in den jeweiligen Schutzräumen. In allen diesen Fällen handelt es sich um einen Rückzug aus der Welt, Selbstverdammung zur Passivität.
Der neoliberale Charakter und der Rückzug aufs Subjektive des gegenwärtigen Feminismus lässt sich an der beliebten Thematisierung „emotionaler Arbeit“ illustrieren, die letztlich das Bedürfnis zum Ausdruck bringt, auch das letzte Quantum unquantifizierbarer menschlicher Regung zu quantifizieren, also: das dem Markt dem Begriff nach Entzogene zunehmend in ihn zu integrieren. „Emotional work“ war zunächst der zentrale Begriff der Soziologin Arlie Hochschild für das Management der eigenen Gefühle, das Flugbegleiter und Fahrkartenkontrolleure im Arbeitsalltag zu leisten hatten, um dem Gegenüber ein positives Gefühl zu vermitteln. In der Fabrik blieb die Interaktion mit anderen Menschen auf die Pausen beschränkt, und der Arbeitsgegenstand ließ beinahe jede Laune zu, in Dienstleistungsjobs tritt ein zwischenmenschlicher Faktor hinzu. Mit dem Anschwellen des Servicesektors seit der Veröffentlichung der Studie 1983 dürften sich die darin beschriebenen Phänomene, mitunter die Belastung, die solche Arbeit für die Individuen bedeuten kann, wesentlich verbreitet haben. Jüngere feministische Versuche thematisieren aber nicht dies, sondern den Faktor „emotionaler Arbeit“ in privaten zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch hier wiederholt sich also der Rückzug des Feminismus in den intersubjektiven Bereich; ganz einfach deswegen, weil in der Arbeitswelt das Phänomen nicht entsprechend identitätspolitisch behandelt werden kann, denn hier sind alle von den entsprechenden Anforderungen und Belastungen betroffen. Stattdesswen werden zwischenmenschliche Aufmerksamkeit und Freundschaft deswegen zur Dienstleistung, für die die Frauen* entlohnt werden wollen – obgleich sie sich letztlich doch ganz freiwillig aufopfern, denn sie könnten es ja auch einfach lassen, wenn es denn eine solche Zumutung für sie darstellt, sich um andere zu kümmern.
Wo die Rede vom nicht-Subsumierbaren ist, drängen sich die Gedanken Horkheimers und Adornos aus der Dialektik der Aufklärung auf. Adorno und Horkheimer zeigen „wie die Unterwerfung alles Natürlichen unter das selbstherrliche Subjekt zuletzt gerade in der Herrschaft des blind Objektiven, Natürlichen gipfelt.“ Bemerkenswert häufig charakterisieren sie diese blinde, naturhafte Herrschaft als männliche. Doch die Dialektik lehrt uns nicht nur, wie diese Herrschaft wieder in Natur umschlägt, sondern auch, dass dieser zweiten Natur nur entronnen werden kann durch eine avanciertere Form von Herrschaft: eine, die ihrer selbst inne ist. Die Dialektik der Aufklärung selbst illustriert das, ist sie doch selbst ein Stück Aufklärung, ein Stück begrifflicher Gewalt, das jedoch in der Lage ist, über sich hinauszuweisen. „Nur Begriffe können vollbringen, was der Begriff verhindert.“, heißt es entsprechend in der Negativen Dialektik. Alle Kritik an Härte und Kälte, die auf inhaltlicher Ebene als wesentlich für die Dialektik der Aufklärung erscheinen mag, wird von deren Form widerlegt. Das bedeutet jedoch auch, dass alle heute real existierende Härte und Gewalt hinter diesem Begriff selbstbewusster Herrschaft, einer gesamtgesellschaftlichen Männlichkeit, die mit ihrer eigenen und der äußeren Natur so gut es eben geht zurechtkommt, zurückbleibt. Denn wir sehen hier den Schlüssel zur gesellschaftlichen Emanzipation, die Philosophie, die Axt der Vernunft, von der Walter Benjamin sprach, im zarten Schoss der kritischen Theorie liegen: „Das Subjekt ist die Lüge, weil es um der Unbedingtheit der eigenen Herrschaft willen die objektiven Bestimmungen seiner selbst verleugnet; Subjekt wäre erst, was solcher Lüge sich entschlagen, was aus der eigenen Kraft, die der Identität sich verdankt, deren Verschalung von sich abgeworfen hätte.“
Der Queerfeminismus entpuppt sich als weitere Degenerationsstufe der skizzierten Entwicklung des Feminismus, und gibt einmal mehr Anlass zu begrifflicher Härte. Er kehrt sich nicht nur von der zweiten Natur, der gesellschaftlichen Objektivität ab, sondern auch von der ersten. Doch bereits Kate Millet, Protagonistin der zweiten feministischen Welle, versuchte 1970 in Sexus und Herrschaft Sex und Gewalt zu trennen und Sexualität von ihrem nicht-subsumierbaren, triebhaften Moment zu reinigen. Sie kann so als Vorreiterin auf dem Gebiet des lustfeindlichen Feminismus gelten. Auch die Verdammung bestimmter Kunstwerke aufgrund eines als politisch nichtvertretbar angenommenen Inhalts machte sie schon damals vor. Dass Sex und Sexualität notwendig ein unkalkulierbares Moment enthalten, ist für Millet so undenkbar, wie für unsereins die Vorstellung, dass Sex mit ihr Spaß machen könnte. In der gegenwärtigen Fetischisierung des Konsensprinzips zeigt sich die Frucht ihrer Bemühungen. Konsequenterweise lehnte sie auch die Schriften Freuds ab, lässt sich mit ihm doch eine entsprechende Entsexualisierung von Sex nicht betreiben: sein dynamischer Triebbegriff widerspricht ihr geradezu. Mit dem Schlagwort Biologismus wird auch heute noch von queertheoretischer Seite jeder Verweis auf das Körperliche, also das Nichtsubsummierbare, Unberechenbare, der Sexualität beiseite gewischt. Dem liegt jedoch eine Verwechslung von Biologie und Ontologie zugrunde: Biologie ist gesellschaftlich vermittelt und folglich so veränderbar wie diese Gesellschaft. Gerade das entgeht jedoch dem Queerfeminismus, der sich im Subjekt verliert auf der Suche nach dem wahren geschlechtlichen Wesen, zu dem jedes Individuum finden können soll. Letztlich ontologisiert also eben der Queerfeminismus selbst Geschlecht. Über diese Verirrung entgeht ihm, dass die spätkapitalistische Produktionsordnung Geschlecht längst dekonstruiert hat, und er selbst nur Agent des Bestehenden ist. Und dies nicht nur, weil er weiter die Dekonstruktion und Verflüssigung propagiert, die dem ökonomischen Flexibilitätsbedürfnis nur zu Pass kommt, sondern auch, weil er in den blinden Autoritarismus umschlägt, der der Neoliberalismus formal immer schon ist und die Queertheorie in ihrer Abkehr von der Objektivität sich dezidiert dem Denken entgegenstellt, das dem Irrsinn ein Ende machen könnten: Materialismus und Psychoanalyse.
Für Freud war Sexualität konfliktreich, nicht konstruktiv für die Identität des Subjekts, wie wir bei Zupancic lernen können. Die queertheoretische und identitätspolitische Vereinnahmung der Sexualität bedeutet folglich deren brutale Instrumentalisierung und Zurichtung, wo sie doch vorgeblich das Gegenteil erwirken will. Doch damit nicht genug: Der Form nach können Identitätspolitik und Queerfeminismus als toxisch weiblich bezeichnet werden. Damit ist die Betroffenheitspolitik gemeint, die eingangs angesprochene Weinerlichkeit. In der selbst geschaffenen Passivität und Abseitsposition bleibt dieser zur Durchsetzung der eigenen Interessen nur, zu versuchen aus der Subjektposition heraus mit dieser und dem zur Hoheit stilisierten Leid zu erpressen, was dann die bekannte moralisierende Empörung zur Konsequenz hat. Man sollte sich dabei nicht der Illusion hingeben, dass diese Form Frauen vorbehalten sei: und die Rede vom Kastratenjahrhundert ist heute erst wahr geworden. Menschen egal welcher geschlechtlichen Identität und Sexualität hingegen, die an „Emanzipation“ interessiert sind, täten gut daran, sich der Philosophie der Aufklärung und deren Dialektik zuzuwenden, die in die Arme der frühen kritischen Theorie führt. In dieser Umarmung lässt sich zu metaphysischen Höhepunkten kommen, die die Voraussetzung einer emanzipierten, das heißt selbstbestimmten, Gesellschaft sind. Denn die Autonomie, die die bürgerliche Männlichkeit versprochen hat, ist nur möglich in einer Gesellschaft, in der die Menschen ihre Produktionsbedingungen kontrollieren, und nicht diese sie. In Anlehnung an die Dialektik der Aufklärung lässt sich also sagen: Die Menschheit wird nicht als Mann geboren, sie muss sich erst dazu machen.
antifa-c, Dezember 2019
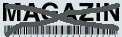
 Vortrag als PDF
Vortrag als PDF