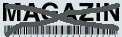Liberalismus in Zeiten von Trump – Die neue Einsamkeit der Neo-Konservativen
Bernd Volkert

In seinem im Januar 2018 in Mönchengladbach gehaltenen Vortrag erläutert Bernd Volkert einige Gründe für den Aufstieg von Donald Trump und untersucht dessen Verhältnis zu den sogenannten Neokonservativen – einer kleinen Gruppe von US-amerikanischen Intellektuellen, die unter George Bush junior für kurze Zeit einen gewissen Einfluss auf die Regierungspolitik des Landes hatte.
Unter den Faktoren, die Trumps Erfolg begünstigten, wird auch ein neuer Irrationalismus benannt, der sich insbesondere an amerikanischen Universitäten seit einiger Zeit ausbreitet. Vorgeblich geht es dieser Bewegung um den Kampf gegen Diskriminierung, faktisch macht sie vernünftige Diskussionen über verschiedenste Probleme des menschlichen Zusammmenlebens noch schwerer als sie ohnehin schon sind. Die meisten radikalen Gesellschaftskritiker in den USA, wie etwa das von uns in mancher Hinsicht geschätzte Crimethinc-Kollektiv, haben es bislang weitgehend versäumt, solchen Tendenzen entgegen zu wirken. Sie tragen damit eine gewisse Mitverantwortung am Erstarken der neuen Rechten, welche sich so als einzige Verteidiger von Vernunft und free spech stilisieren können.
Vergleichbare Phänomene sind hierzulande bisher noch eher randständig, scheinen aber zuzunehmen. Umso wichtiger daher, sie schon jetzt zu benennen und zurückzuweisen.
Wieder einmal ist die Apokalypse ausgeblieben. Nach etwas mehr als einem Jahr der Präsidentschaft Donald Trumps ist weder eine Atombombe gezündet worden, noch hat ein neuer großer Krieg begonnen, auch die Weltökonomie läuft – viele sagen, besser als seit vielen Jahren. Innerhalb der USA sind weder bürgerkriegsähnliche Zustände ausgebrochen noch Internierungslager für Oppositionelle errichtet worden. Eine totalitäre Diktatur ist nicht in Sicht. Auch dort im Großen und Ganzen business as usual: weiterhin eine exorbitant hohe Anzahl von Häftlingen, ein massives Drogenproblem im Kernland der USA, eine Arbeitslosigkeit, die zwar offiziell auf einem Rekordtief steht, in Wirklichkeit aber weiterhin qua Dunkelziffer, wie Trump selbst in seinem Wahlkampf immer wieder hervorgehoben hat, deutlich im zweistelligen Bereich liegt.
Aber die Apokalypse ist jedenfalls ausgeblieben. Die Apokalypse, die in den USA und in Europa die Linken, die Sozialdemokraten, Liberale, Intellektuelle, Künstler beinahe unausweichlich kommen sahen, wenn Trump gewählt werden sollte. Man erinnere sich daran, daß gleich nach der Wahl die Homepage der kanadischen Einreisebehörde zusammengebrochen ist, weil es so viele Einreiseanfragen aus den USA gab; man erinnere sich an die vielen Prominenten von der Ost- und Westküste der USA, aus dem New Yorker Establishment oder aus Hollywood, die lautstark über Emigration nachgedacht hatten: Whoopi Goldberg, Cher, Samuel L. Jackson etc. Nach der Wahl allerdings verflachte der Ausreisedrang der Prominenten sehr schnell, wie Michael Remke vor wenigen Tagen in der Welt lakonisch festhielt.
Erinnert sei auch an die Gewissheit vieler auf beiden Seiten des Atlantiks, daß es ganz undenkbar sei, dieser mehrfach bankrotte Immobilienmogul, Reality-TV-Moderator, Spielcasinobetreiber habe auch nur die geringste Chance, mit seiner im Sommer 2015 angekündigten Kandidatur durchzukommen. Diese Gewissheit wurde, wie wir wissen, kräftig enttäuscht.
Auf mehreren Ebenen also erscheint es so, daß sich rund um die Wahl Trumps in relevanten Teilen der Bevölkerung allerlei Defizite in der Realitätstauglichkeit des emotionalen und Seelenhaushalts gezeigt haben.
Nun ist es ja, betrachtet man Europa und im Speziellen Deutschland, nichts Neues, daß die USA, zumal zu Wahlzeiten, zur emotional hochaufgeladenen Projektionsfläche werden, mal im Guten, mal im Schlechten. Das geht wenigstens zurück bis John F. Kennedy und seinen Berlinbesuch Anfang der 1960er Jahre, als nüchterne Besucher die teils hysterischen Massenovationen der Deutschen für den amerikanischen Präsidenten an Begeisterungswellen für einen anderen, deutsch-österreichischen Politiker gerade mal zwanzig Jahre vorher erinnerten. Wurde Kennedy – wie auch später Obama – als Erlöserfigur gefeiert und angepriesen, ereilte Präsidenten wie Reagan und Bush, senior wie junior, der gegenteilige sozialpsycholgische Vorgang, daß sie betrachtet, gefürchtet und gehaßt wurden wie der Gottseibeiuns. Wie eben, in nochmal gesteigertem Maße, nun auch Donald Trump.
Ohne in solche Projektionen zu verfallen, soll hier der Versuch unternommen werden, den Erfolg des so unwahrscheinlich und ungewöhnlich scheinenden Kandidaten Donald Trump plausibel zu machen. Dazu will ich zwei Beispiele beziehungsweise zwei Quellen heranziehen, die zu Trump gar nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, deswegen aber vielleicht erklärungskräftiger und illustrativer für seinen Wahlrefolg sind: einmal ein Filmprojekt des Regisseurs David Lynch von 2008; zum anderen einen ausführlichen Artikel oder Essay über gewisse Entwicklungen an den Hochschulen der USA aus der Zeitschrift The Atlantic von 2015.
2008 hatte David Lynch eine Idee. Lynch, der sowohl in den USA als auch in Europa mit Filmen wie Lost Highway oder Mulholland Drive als zwar anerkannter, dennoch abseitiger, schwer verständlicher Regisseur gilt, der gerade wegen der vorgeblichen Rätselhaftigkeit, gewisser Schockelemente und einem Zug zum Irrationalen, der ihm unterstellt wird, vom westlichen Feuilleton geachtet wird. Psychologisch interessant, hinsichtlich Erkenntnis der Gesellschaft jedoch zu vernachlässigen – so das Urteil. Eben dieser David Lynch hatte also etwa ein Jahrzehnt vor dem Phänomen Trump – und auch kurz vor der verheerenden Immobilien- und Finanzkrise – eine Idee: Wie wäre es denn, wenn man mit einer Kamera im Gepäck die USA von Kalifornien zur Ostküste und wieder zurück durchfahren würde, dabei die großen Städte und die Zentren miede, vielmehr sich auf die Provinz beschränkte, jeden Tag ein anderes Städtchen. Und jeden Tag suchte man sich nach dem Zufallsprinzip oder nach momentanem Einfall einen Passanten, einen Bewohner aus, dem man eine ganz simple Frage stellt: Wie siehst Du Dein Leben? Vielleicht weil Lynch sich dachte, er selber kenne in etwa schon das Ergebnis, weil er das Hinterland in den USA schon in seinem Film A Simple Story abgebildet hatte, reichte er die Idee an seinen diesbezüglich noch unbeleckten Sohn weiter, der dann tatsächlich sich mit einem Kumpel auf den Weg machte. Heraus kam das sogenannte Interview Project, bis heute frei im Internet abrufbar, in dem in etwa 150 Episoden mit einer Länge von zwei Minuten bis zu einer Viertelstunde eben einfache, aber auch sehr unterschiedliche Amerikaner ihr Leben berichten und kommentieren, Männer, Frauen, Junge, Alte, Weiße, Schwarze, Latinos, Arbeiter, Arbeitslose etc. Ein komprimiertes Abbild der USA jenseits des Boulevards und Silicon Valley. Ein Bild voller Scheitern, Melancholie, Aussichts- und Haltlosigkeit, von Menschen, die die USA mögen, aber gewissermaßen nicht mehr finden; von Amerikanern, die nur darauf warten zu scheinen, dabei zu sein, wenn es heißt: Make America great again oder auch nur: Make America real again.
Ich habe dieses Beispiel zum einen gewählt, weil David Lynch beziehungsweise sein Sohn und dessen Kumpel damit ein eindrückliches Dokument eines Typus von Menschen geschaffen haben, die in ihrer Haltung zur Welt und zu den Vereinigten Staaten Jahre später gewiß eine starke Basis der Wählerschaft Donald Trumps gestellt haben. Zum anderen auch, weil das Interview Project in der medialen Resonanz weitgehend untergegangen ist. Während die vom Kulturbetrieb Lebenden sonst auf jeden neuen Film von Lynch mit großer Aufregung warten, um diesen zu analysieren und zu entschlüsseln, ist dieses sehr einfach und direkt aufgemachte Werk von der intellektuellen Elite weitgehend mit Ignoranz bedacht worden. Wenig überraschend ist, daß Lynch selbst bei den letzten Wahlen seine Unterstützung zwar nicht Trump, immerhin aber Bernie Sanders zukommen hat lassen, dem quasi altsozialistischen Kandidaten, der bei den selben Bevölkerungsgruppen wie Trump um Zustimmung warb und dies noch dazu mit zu einem guten Teil ganz ähnlichen Aussagen und Forderungen.
Nun, um eine andere Motivation, Trump zu wählen, darstellend zu erläutern, zum zweiten Beispiel – wie gesagt, einem Artikel von 2015, also ebenfalls aus der Vor-Trump-Ära, über aktuelle Entwicklungen an den amerikanischen Hochschulen, der in The Atlantic erschien, einem sonst durch und durch linksliberalem Monatsmagazin, das aber mit diesem Artikel, unbewußt sozusagen, eine Erklärungshilfe für Trumps späteren Erfolg geboten hat. Der Artikel ist sehr ausführlich und ich will ihn nicht zusammenfassen, sondern lieber einen längeren Auszug daraus vorlegen, der exemplarisch illustrieren soll, warum ich ihn für sehr triftig in Sachen Trump halte. Die Tendenzen, die er beschreibt, sind in den USA schon viel stärker auch außerhalb der Hochschulen durchgesetzt als hier. Sie nehmen aber dennoch, wenig bemerkt, auch in Westeuropa immer mehr an Fahrt auf. Also:
--- Etwas Eigenartiges geht vor an den amerikanischen Colleges und Universitäten. Eine Bewegung wächst, ohne Führung und in der Hauptsache von Studenten vorangetrieben, die die Campusse von Wörtern, Ideen oder Personen säubern will, die Unbehagen hervorrufen oder als aggressiv wahrgenommen werden könnten. Im letzten Dezember schrieb Jeannie Suk für den New Yorker über Jurastudenten, die ihre Professoren in Harvard aufforderten, micht mehr über die Rechtslage zum Thema Vergewaltigung zu lehren – oder, in einem weiteren Fall, sogar darauf zu verzichten, daß Wort ‚Gewalt‘ zu verwenden (wie zum Beispiel in „dem Recht Gewalt antun“), da Studenten sich bedrängt fühlen könnten. Im Februar veröffentlichte Laura Kipnis, Dozentin an der Northwestern University, einen Essay im Chronicle of Higher Education, in dem sie eine neue Campus-Politik der sexuellen Paranoia beschrieb – woraufhin sie von Studenten, die sich von dem Artikel angegriffen fühlten, einer ausführlichen Untersuchung ausgesetzt wurde und wegen eines Tweets formell gerichtlich Beschwerden gegen sie eingereicht wurden. Im Juni schrieb ein Dozent, der sich ohnehin schon mit einem Pseudonym zu schützen versuchte, für die Webseite Vox einen Essay darüber, wie wachsam er mittlerweile unterrichten müsse. Titel: „Ich bin ein liberaler Professor. Und meine liberalen Studenten machen mir Angst.“ Eine ganze Reihe von beliebten Comedians, unter anderem Chris Rock, treten nicht mehr in Hochschulen auf. Jerry Seinfeld und Bill Maher haben öffentlich die Übersensibilität von Collegestudenten verurteilt, von denen zu viele keinen Witz mehr ertragen könnten.
Zwei vormals ganz obskure Begriffe sind zuletzt sehr rasch in die Uni-Alltagssprache aufgestiegen. Mikroaggressionen sind kleine Handlungen oder bestimmte Wörter, die an sich keinerlei böse Absichten beinhalten, die aber trotzdem als eine Form von Gewalt betrachtet werden. Zum Beispiel ist es nach den Richtlinien mancher Colleges eine Mikroaggression, wenn man einen asiatischen oder Latino-Amerikaner die Frage stellt: „Wo bist Du geboren?“, da dies unterstellen würde, daß er kein wirklicher Amerikaner sei. Triggerwarnungen sind Warnsignale, die Dozenten geben sollen, immer wenn ein Seminarinhalt vielleicht eine starke emotionale Reaktion hervorrufen könnte. Zum Beispiel haben Studenten solche Warnungen für F. Scott Fitzgeralds Klassiker Der große Gatsby gefordert, da in dem Buch Frauenfeindschaft und köperlicher Mißbrauch dargestellt werden. Mit diesen Warnungen soll es Studenten, die irgendwann Opfer von beispielsweise Rassismus oder häuslicher Gewalt geworden seien, möglich werden, Werke zu ignorieren, von denen sie glauben, sie könnten ein Trauma aus der Vergangenheit ‚triggern‘.
Einige Geschehnisse auf den Campussen in jüngster Zeit grenzen ans Surreale. Im April wollte die Organisation der asiatisch-amerikanischen Studenten an der Brandeisuniversität mit einer Installation am Eingang eines Universitätsgebäudes Bewußtsein für Mikroaggressionen gegen Asiaten schaffen. Auf der Installation waren Beispiele für solche Mikroaggressionen zu sehen – wie ‚Solltest Du nicht gut in Mathe sein?‘ oder ‚Ich bin farbenblind! Ich kann Rassen nicht erkennen.‘ Aber einige andere asiatisch-amerikanische Studenten holten zum Gegenschlag aus, da sie meinten, die Installation selbst sei eine Mikroaggression. Die Organisation baute ihre Installation ab, und ihr Präsident schrieb eine Mail an die gesamte Studentenschaft, um sich bei all denen zu entschuldigen, „die durch den Inhalt der Mikroaggression getriggert oder verletzt wurden“.
Dieses neue Klima wird allmählich institutionalisiert und beeinflußt schon, was im Seminarraum – auch nur als Diskussionsgrundlage – gesagt werden kann. Im Unijahr 2014/15 wurden den Dekanen und Abteilungsleitern an zehn Hochschulen des kalifornischen Universitätssystems in Fortbildungen für Fakultätspersonal Beispiele für Mikroaggressionen dargestellt. In der Liste für angeblich aggressive Formulierungen zum Beispiel: „Amerika ist das Land der Möglichkeiten“ oder „Ich glaube, die am besten geeignete Person soll den Job bekommen“. ---
Soweit der Auszug aus dem Atlantic-Artikel. Die Autoren bringen in der Folge noch reihenweise Beispiele, bei denen der ‚Mikroaggression‘ oder ähnlichem beschuldigte Studenten der Universität verwiesen worden sind oder Dozenten und Professoren auf solcher Grundlge tatsächlich ihre Jobs verloren haben. Um deutlich zu machen, daß diese vielleicht kurios anmutenden, aber grassierenden Vorgänge mit der Wahl Trumps zu tun haben, sei erst einmal erwähnt, daß die Administration Obama diese sehr grundlegenden atmosphärischen und praktischen Veränderungen an den Universitäten des Landes unterstützt und im Effekt legalisiert hatte. Unter Trump wiederum, so lobt ihn der Publizist James Kirchik, eigentlich einer seiner Gegner, bildete die als eine der ersten Maßnahmen „von Bildungsministerin Betsy DeVos verfügte Rücknahme der aus Obama-Zeiten stammenden Leitlinien zur Bekämpfung sexueller Belästigung oder Gewalt an den Universitäten, die den Beschuldigten eine unfaire Beweislast aufbürdeten, einen Schritt in Richtung einer Wiederherstellung von Vernunft und Gerechtigkeit an amerikanischen Colleges, in denen es vielerorts an beidem ganz beträchtlich mangelte.“
Ob Kirchik damit richtig liegt oder ob doch ‚Vernunft und Gerechtigkeit‘ nicht nur an den amerikanischen Hochschulen schon längst einen kapitaleren Schaden erleiden haben müssen, es sich also nicht, wie die Atlantic-Autoren meinen, um ein ‚neues Klima‘ handelt, soll später mit einem Rückblick in die 1960er und 1970er Jahre betrachtet werden.
Vorher soll festgehalten werden, daß die Wahl Trumps nicht aus heiterem Himmel geschah – der war für viele Amerikaner schon sehr verdüstert, was mit dem Interview-Project illustriert werden sollte. Eine wachsende Anzahl Amerikaner haben sich in der USA, wie sie sich seit den 1970er Jahren entwickelt hat, in zunehmender Intensität, um es banal zu sagen, nicht mehr zuhause gefühlt. Sicherlich aus diversen Gründen – einer davon dürfte allerdings durch die Auszüge aus den Artikeln über die Situation an den Hochschulen einsichtig gemacht worden sein, zumal Trump gerade bei den Wählern ohne Collegeabschluß die absoluten Rekordergebnisse vorweisen konnte. Es dürfte klar sein, daß sich an den Hochschulen, die ja immerhin fast zu hundert Prozent die Elite ob in Politik oder Kultur und auch zu guten Teilen in der Ökonomie produzieren, offenbar eine sehr eigene Mentalität und ein sehr eigener Zugang zur Wirklichkeit herausgebildet hat, der den im Resultat vom Handeln der Elite abhängigen Menschen nur schwer nachvollziehbar sein dürfte.
Nimmt man dazu noch die alltäglichen Erfahrungen der sogenannten ‚einfachen Leute‘ über die letzten Jahre – relativ stagnierende Einkommen seit den späten siebziger Jahren, eine beispiellose Umschichtung der Vermögen, so daß wenige Prozent am materiell oberen Ende der Gesellschaft so viel Vermögen aufweisen wie fast der ganze Rest, katastrophenartige Ereignisse wie die Immobilien- oder SubPrime-Krise um 2008, bei der mehrere hunderttausende Familien ihre Häuser und ihre Vermögen verloren haben, eine zwar versteckte, aber hartnäckige Grundarbeitslosigkeit -, nimmt man also solche alltäglichen Erfahrungen der breiten Masse zur Kenntnis, ist es wenig überraschend, wenn, ein völliger Outsider wie Trump das komplette politische Establishment überrumpeln kann – gerade eben, weil er ein völliger Outsider ist, ein Kandidat, der bis heute sogar in der Partei, für die er präsidiert, mehr Gegner und gar Feinde als Freunde zu haben scheint, der im Wahlkampf zu nachgewiesenen 90 Prozent negative Berichterstattung bekommen hat, der von der ganzen intellektuellen und kulturellen Hautevolée öffentlich lächerlich gemacht oder verdammt worden ist. All das, und das muß man wirklich, glaube ich, im Grunde begreifen, hat Trumps Wahlsieg nicht nur nicht verhindern können, sondern in einem gewissen Sinn erst ermöglicht. Hier sei noch vor dem Trugschluß gewarnt, daß es sich damit in schlichtem Sinne um eine Protestwahl gehandelt habe. Vielmehr, würde ich meinen, kam das Ergebnis aus einer tatsächlichen Verzweiflung und einem durch Erfahrung sich akkumulierndem Vertrauensverlust gegenüber zentralen Aspekten der amerikanischen Politik und des amerikanischen Gemeinwesens zustande. Es sei nur darauf verwiesen, daß auch schon Barack Obama in ähnlichem Maße als Außenseiter gewonnen hat, der in seiner, der Demokratischen Partei, bis zur erfolgreichen Wahl auf vehementen Widerstand gestoßen ist (unter anderem von Hillary Clinton). Allerdings enttäuschte Obama einen großen Teil seiner Anhänger, nachdem er sein Amt erstmal angetreten war, da er selbst letztlich agierte, wie man es gemeinhin von einem Politiker in den USA, zumal vom Präsidenten erwartete. Er war eben nicht das ganz andere – Trump erfüllt solche Erwartungen schon deutlich mehr, wie später noch dargestellt werden soll.
So wie Trump nicht vom Himmel fiel, so auch nicht die Gründe, warum seine Kandidatur erfolgreich sein konnte. Hier wollen wir ein wenig in die jüngere Geschichte der USA zurückblicken und auch auf die im Titel erwähnten, einstmals sagenumwobenen, heute fast vergessenen Neokonservativen und damit auch auf den Begriff des Liberalismus zu sprechen kommen.
Wie in zahlreichen Staaten nicht nur des Westens waren die 1960er Jahre auch in den USA von einer spezifischen gesellschaftlichen Unruhe geprägt. Die hier angewandte Interpretation dieser Ereignisse nimmt zur Voraussetzung, daß diese Unruhe vor dem Hintergrund ökonomischer Prosperität und gesellschaftlicher Entspannung, fast Spannungslosigkeit ausgegangen ist. Die passende Entsprechung dazu ist, daß die Handelnden – oder Aktivisten, wie sich bald selbst nennen sollten – in der Hauptsache Kinder der einigermaßen saturierten Bürgerschicht beziehungsweise des Establishments waren, zumeist Studenten, die nun nicht mehr, wie ihre unter links gefaßten geschichtlichen Vorgänger primär für soziale oder ökonomische Anliegen streiten wollten, sondern sich – kurz gefaßt – die Revolutionierung des Alltagslebens, gar des Lebens überhaupt auf die Fahnen geschrieben hatten. In China hieß das zur selben Zeit Kulturrevolution. Diese Umtriebe stießen zum einen hinsichtlich etwaiger Übernahme politischer Machtübernahme in der Gesellschaft Ende der 60er Jahre erkennbar an ihre Grenzen, zum anderen auf Ablehnung und teilweise aktive Gegenwehr von Seiten des irgendwie im Gesamtplan der bourgeoisen Rebellen eigentlich noch vorgesehenen sogenannten Proletariats, also der etablierten Arbeiterschaft. Der Kultfilm Easy Rider von 1969 zeigt dieses Dilemma zwischen der Befolgung des Mottos ‚Turn on, tune in, drop out‘ und den Lebensauffassungen der ab da abwertend sogenannten Rednecks sehr nachhaltig und brutal. Im realen Geschehen zeigte sich diese Gewalt an dem gern als Umschlagpunkt genannten Parteitag der Demokraten in Chicago 1968, als der demokratische Bürgermeister Richard Daley die protestierende Jugend mit Unterstützung der Arbeiterbevölkerung mächtig niederknüppeln ließ.
Etwa von da an spalteten sich die Reihen: Die einen gingen in den Untergrund, die anderen ins Lager des bisherigen Gegners, des Establishments in Form der Demokratischen Partei, die sich, wie auch die Gesamtgesellschaft, nach und nach sehr erfolgreich integrationswillig für die fundamental Protestierenden zeigte. Schon 1972 legte der demokratische Präsidentschaftskandidat George McGovern – in Anlehnung an den 60er-Jahre-Begriff Neue Linke – für seine Partei die Linie der New Politics fest, die auf dem Parteitag desselben Jahres die folgenschwere Neuerung mit sich brachte, daß nun auf einmal bei der Bestimmung der Delegierten Quoten für sogenannte Minderheiten – Schwarze und Frauen – festgelegt wurden – gegen den Protest der traditionellen Parteimitglieder. Und auch zur Unbill von Intellektuellen, Linken, für radikale Reformen Gestimmte außerhalb der Partei – aus denen wiederum sich in dieser Phase auch die mit dem als Schimpfwort gemeinten Neokonservativen als vage erkennbare, sonst disparate Bewegung bildeten, die sich nun allmählich als immer kleiner werdende Bastion eines bedrohten traditionellen Liberalismus verstanden. Und auch als Kämpfer für ein radikalliberales Verständnis der Vereinigten Staaten von Amerika in Frontstellung zur Neuen Linken, die das System als inhärent korrupt verstand, von der USA als faschistischem Staat und Gesellschaft sprach und das Land gerne Amerikkka mit drei K wie den KuKluxKlan schrieb.
Neokonservative?
In den Augen der sogenannten Neokonservativen stellte die Integration der Protestgeneration mit ihrer Gegenkultur einen kombinierten Angriff auf die grundlegende Verfaßtheit der USA dar: Im ersten Schritt sei eine radikal negative Neudefinition des Landes vorgenommen worden, vor allem als nun von Anbeginn bis zur Gegenwart rassistische Gesellschaft – nach innen gegen die Schwarzen, nach außen in den Kriegen, zum Beispiel in Vietnam -, dann auch als patriarchale Gesellschaft, in der die Unterdrückung der Frauen zur Essenz gehöre. Diesen Grundmängeln sollte nun durch umwälzende Veränderungen des politischen, ökonomischen und sozialen Systems abgeholfen werden – eben zum Beispiel durch die flächendeckende Einführung der erwähnten Quotenregelungen, in praktisch verschärfter Form durch Programme wie Affirmative Action, in denen anfangs Schwarze, dann Frauen und immer weitere als Minderheiten gekennzeichnete Bevölkerungsgruppen bei Stellen- und Geldvergaben eine Vorzugsbehandlung bekamen. Die Neokonservativen nahmen solche – und auch andere, für sie verwandte – Entwicklungen zum Anlaß, sich nicht nur von den Demokraten zu distanzieren, sondern – wie einer der wichtigsten Vertreter, Norman Podhoretz, es früh formulierte – mit einem ‚mit aller Kraft geführten Krieg gegen die Linke‘ zu antworten. Eine reaktive, defensive Position also, die sie mit einigem Hin und Her auf der Ebene der Parteien nach und nach immer näher zu den Republikanern brachte und schließlich, spätestens mit Ronald Reagan – auf seine Art damals ein neuer Typus Politiker – auch tief in diese Partei hinein. In diesem Prozess konzentrierten sie sich zunächst darauf, einen nun mehr und mehr obsolet werdenden Begriff von Liberalismus retten zu wollen: Einen Liberalismus mit universalem Anspruch, dessen Kern der individuelle Mensch ist, dessen möglichst unbehinderte Entfaltung als Individuum – und nicht einer Gruppe oder Identität subsumiert – die Gesellschaft zu gewährleisten hat.
Allerdings änderte ihre Annäherung an den rechten Flügel der Parteienlandschaft wenig von der auch von ihnen selbst so wahrgenommenen defensiven und zunehmend minoritären Position, die sie im politischen Spektrum der USA einnahmen: Für die meisten der angestammten Republikaner galten sie als eine Art trojanisches Pferd, mit dem radikale, antikonservative, destabilisierende Absichten in die Partei geschmuggelt werden sollten. Es brauchte die Anschläge vom 11. September 2001, damit die Neokonservativen zwei kurze Jahre der praktischen Anerkennung bekommen konnten, weil – leicht überspitzt ausgedrückt – die USA im allgemeinen wie die Regierung Bush im besonderen auf dieses unerhörte Ereignis strategisch überhaupt nicht vorbereitet waren. Die Neokonservativen hingegen hatten aus ihrer marginalen Rolle schon seit den Siebzigern in dem Sinne die Flucht nach vorne ergriffen, daß sie sich zunehmend der Außenpolitik zuwandten, wo sie die USA als zu selbstkritisch bis demütig wahrnahmen und zudem mindestens große Skepsis gegen vor allem die westeuropäischen Bündnispartner hegten. Dagegen traten sie für eine selbstbewußte und offensive, teils gar aggressive Haltung Amerikas gegenüber der Sowjetunion ein, wollten die Bindung der USA von autoritären oder klerikalen Regimen in Lateinamerika und dem Nahen Osten lösen, verbunden mit einer klaren Haltung für die Existenz Israels – alles zur Not auch erstmal unilateral, America alone. Auf dieser Grundlage – einer Art von den USA ausgehenden liberalen Internationalismus oder Expansionismus – zählten sie zu den ersten, die sich für die Etablierung und das rapide Anwachsen einer islamistischen Welle mit antiamerikanischer und antiisraelischer Essenz sensibilisierten, früh deren offensives Zurückschlagen einforderten und dafür Strategien entwickelten. Aber, wie angedeutet, war die politische Blütephase der Neokonservativen unter Bush kurz, indem dieser zwar noch der Idee, Saddam Hussein zu stürzen, folgte, dann aber in ihren Augen dem politischen Druck viel zu schnell nachgab und das klar gesetzte, wenn auch eine lange Ausdauer benötigende Ziel der Errichtung demokratischer Gesellschaften in der arabischen Welt aufgab.
Daß die Neokonservativen mit der Administration Barack Obamas und ihrer Betonung des Multilateralismus, der relativ konzilianten Haltung der arabisch-muslimischen Welt gegenüber und ihrer Zurückhaltung im sogenannten Nahostkonflikt wenig anfangen konnten, ist vermutlich nicht überraschend. Hier läßt sich zum Anlaß unseres Vortrags zurückkommen, läßt sich nun die Frage stellen, wie denn das Verhältnis der Neokonservativen zu Donald Trump sein mag. Die kurze Antwort ist: Im Großen und Ganzen schlecht. Dies mag überraschen, da im Vorhergehenden doch einige möglichen Überschneidungspunkte zu finden sind: Eine grundsätzliche und selbstbewußte proamerikanische Haltung, eine prinzipielle Gegnerschaft zu den Ideen und Praktiken, die sich von Quotenregelungen und Affirmative-Action-Programmen zu einer über die Universitäten längst hinausreichenden Teilhegemonie der Identity Politics entwickelt haben, keinerlei Scheu auch Bekenntnisse für das amerikanische Militär und dessen Schlagkraft abzugeben, vielleicht auch noch, daß sowohl die Neokonservativen wie auch Donald Trump keineswegs zum Kern des amerikanischen Politestablishments gehören.
Am letztgenannten möglichen Überschneidungspunkt läßt sich vielleicht auch schon der Unterschied ums Ganze zwischen Trump und den Neokonservativen zeigen: Trump gehört nicht nur nicht zum Kern des Establishments in Washington – er gehört gar nicht dazu. Somit läßt er sich auch schwerlich einer historischen amerikanischen Ideentradition zuordnen, auch nicht einem Liberalismus alter Prägung, der immer noch eine Grundlage für die Neokonservativen bildet. So sind auch Trumps zwei Hauptmotti – ‚America first‘ und ‚Make America great again‘ – keineswegs universalistisch gemeint, sondern in einer spezifischen, paradoxen Weise könnte man sagen nationalistisch – paradox, weil es eine Art Nationalismus mit globalem Anspruch ist, nicht in dem Sinne, Amerika solle die Welt erobern – wie es in einem idealistischen Sinne in etwa der Vorstellung der Neokonservativen entspricht. Nein, es reicht, wenn die Welt den USA für ihre Interessen offensteht, sich ihren Interessen nicht entgegenstellt. Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien, auffälligerweise sehr früh in seiner Präsidentschaft, hat Trump zwar ganz selbstverständlich die Staatschefs von 40 Ländern einbestellt, um ihnen dann aber in aller Deutlichkeit mitzuteilen, daß es ihm mehr oder weniger egal sei, wie sie ihre innenpolitischen Belange handhaben; wichtig sei ihm, daß man auf einer guten Geschäftsgrundlage zusammenkomme. Undenkbar für Neokonservative, die ohnehin eine solche Versammlung eher meiden und ansonsten es genau umgekehrt handhaben würden: Keine Geschäfte mit den USA, wenn ihr Euch nicht um die Liberalisierung und Demokratisierung Eurer Region kümmert. Auch der militärisch erfolgreiche Feldzug Trumps gegen den Islamischen Staat in Syrien ist den Neokonservativen zwar sicherlich vom Ergebnis her nicht unrecht, doch die Motivation viel zu borniert: Für Trump ging es nur darum, eine klar erkennbare und auch erklärte Bedrohung der USA und amerikanischer Soldaten und Bürger auf unmittelbare Weise und unmißverständlich unschädlich zu machen; größere Ideen steckten nicht dahinter. Vielleicht reicht es, sich vorzustellen, eine Delegation der Neokonservativen würde von Trump empfangen werden, um die Inkompatibilität dieser Kombination zu verstehen: Während die neokonservativen Intellektuellen ansetzen, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten lang und breit, mit historischer, gar philosophischer Begründung, zu erklären, was denn die USA ihrer Ansicht nach dringend in der Welt tun sollten, würde Trump immer unruhiger werden und nach spätestens einer halben Stunde sagen, für den Moment genüge ihm das. Sie sollten ihm doch gerne eine Zusammenfassung ihrer Vorschläge auf zwei, drei Seiten zukommen lassen. Das ist nicht nur Fiktion; Trump macht das tatsächlich so.
Damit nochmal direkter zu Donald Trump selbst oder dem neuen Typus, den er verkörpert. Er selbst gibt über das Verständnis seiner Rolle bereitwillig Auskuft: Er sei der ‚negotiator-in-chief‘, der Chefunterhändler, der immer den besten Deal herausholen wolle und dies auch besser könne als jeder andere. Dies habe er sein Leben lang für sich als Unternehmer getan und dies verfolge er nun als erster Vertreter der Vereingten Staaten – auch hier Vertreter eher im ökonomischen Sinne zu verstehen. Mithin hat man es bei Trump vielleicht mit dem ersten US-Präsidenten zu tun, der nicht das Amt in erster Linie zur persönlichen Bereicherung verwendet (da wäre er möglicherweise nicht der erste), sondern er ist vielleicht der erste, der versucht, dieses Amt nicht als Politiker, sondern als Manager oder Unternehmer auszufüllen. Dadurch erklärte sich vieles. Zum Beispiel das Faktum, daß weiterhin – vor allem im Außenministerium – zahllose Posten unbesetzt bleiben. Dies liegt nicht an einer Unfähigkeit, Unkoordiniertheit oder gar Faulheit Trumps. Er ist nur überzeugt, all diese Leute, Angestellte, müßte man klarer sagen, braucht man nicht, das geht auch schlanker. Außer daß er damit praktisch vorzeigen will, Washington stelle eine einzige, von den unmittelbaren Interessen der Bevölkerung längst losgelöste, sich selbst reproduzierende Blase dar, entspricht es übrigens auch einem beachtenswerten Detail aus seinem Wahlkampf, das vielen reichte, um Trump bis zum Schluß nicht ernstzunehmen: Hatten alle anderen Bewerber, wie es über die Jahrzehnte üblich geworden ist, Beraterstäbe, die jeweils mehrere hundert Leute zählten, begnügte sich Trump mit einer Truppe von etwa einem halben Dutzend Leuten seines Vertrauens plus einer überschaubaren Anzahl studentischer und ähnlicher Hilfs- und Zuarbeiter. Auch eine andere seiner, man muß es so sagen: Innovationen begründet sich aus praktischer Ökonomie und hat wahrscheinlich in Washington massenhaft dazu geführt, daß sich die dort Etablierten ratlos an den Kopf gefaßt haben: Für jede Regelung, die welche Regierungsagentur auch immer neu einführen wolle, schrieb Trump vor, müsse diese Agentur mindestens zwei andere Regelungen benennen, die im gleichen Zuge abzuschaffen seien. Man erkennt klar den Unternehmer Trump, der auf einmal in der Lage ist, all diese bürokratischen Stolpersteine, über die er sich all die Jahre geärgert hat, quasi eigenhändig aus dem Weg zu räumen. Überraschenderweise klappt das offenbar auch erstmal in der Durchführung, und zwar über alle Maßen: Die Regierung in Washington teilt mit, daß pro neuer Regelung gar 23 alte aufgehoben worden seien.
Auch wenn oder gerade weil dies alles etwas anekdotenhaft wirkt – und man könnte noch mehr solcher Beispiele nennen -: Trump in Washington ist ein beinahe so unwahrscheinlicher Vorgang wie die Erfüllung von Lenins Wunsch, irgendwann möge die Sowjetunion mal so weit sein, daß auch eine Putzfrau das Land leiten könne. Stelle man sich nun gegen Abschluß vor, Trump würde in und an der Spitze der Europäischen Union wirken können, dann mag man zum einen vermuten, der Abbau dieses bürokratischen Apparates wäre ihm dann doch zuviel Sisyphos-Arbeit, zum anderen läßt sich damit auch überleiten zu Trumps Bedeutung hinsichtlich der internationalen Politik. Auch dort ist es ihm gelungen, in allen Reihen erhebliche Unruhe zu erzeugen – auch, weil er entsprechende Umstände vorfand. Denn vielerorts scheint es nicht ganz sicher zu sein, ob die jeweiligen Konstellationen und Allianzen einer Herausforderung wie Trump noch standhalten können. In Davos konnte man das kürzlich heraushören, indem zwar in den Reden von Macron, Merkel etc. nie namentlich von Trump die Rede war, gleichzeitig aber in so enger Folge Begriffe wie Multilateralismus vermutlich noch nie verwendet worden ist – ein dem Pfeifen auf dem nächtlichen Friedhof vielleicht verwandtes Phänomen. Trump hält offensichtlich von der praktizierten Form des Multilateralismus und von den existierenden Bündnissen, deren Teil die USA ist, tatsächlich wenig bis nichts. Auch wenn er in Davos gesagt hat, America first bedeute keinesfalls Amerika alleine, stellt dies keinerlei Grund zum Aufatmen für die Europäer dar, sondern gehört zum oben beschriebenen paradoxen Nationalismus Trumps: Natürlich weiß auch er, daß die USA sich nicht von der Welt isolieren können, im Gegenteil ist seine Perspektive ganz global, kennt in gewissem Sinne ganz postmodern keine Grenzen und keine Nationen. Jeder Ort der Erde kann ein Ort für die USA sein, einen erfolgreichen Deal mit willigen Partnern zu schließen. Dieses Vorgehen ist nicht ganz ohne Präzedenzfall, der auch ein schlagkräftiges Beispiel liefert, warum sich Trump durchsetzen konnte: Daß den Bündnissen ohnehin nicht ganz zu trauen ist, haben die USA beim letzten Irakkrieg lernen müssen, als Deutschland, Frankreich und andere NATO-Länder ihre Beteiligung verweigerten und sogar öffentlich opponierten. Das kreative Ergebnis war eine Art Separatdeal der Regierung Bush mit Ländern wie Polen, Tschechien, Slowakei etc., der Koalition der Willigen, wie George Bush das genannt hat. Ähnliches verfolgt von vorneherein Trump ganz selbstbewußt. Aktuelles Beispiel: Ganz offen verlautbart Außenminister Rex Tillerson für die US-Regierung, daß sie gegen die europäische North-Stream-2-Pipeline ist. Und zwar nicht – wie zum Beispiel die Neokonservativen es tun würden, weil dadurch die Abhängigkeit von beziehungsweise Bindung an Rußland für Westeuropa zu groß würde und außerdem Polen und die Ukraine geschwächt würden. Nein, die Begründung ist ganz einfach: weil es der USA einen guten Deal vermasseln würde – und zwar den Ausbau des polnischen Ostseehafens Swinemünde als zentralen Startpunkt für die Versorgung des europäischen Kontinents mit flüssigem Erdgas aus den USA. Dies hat die pikante zusätzliche Note, daß Polen das ähnlich sieht und damit die ohnehin vorhandenen Risse innerhalb der EU an dieser Front sich verschärfen; und das nach dem Brexit, nach diversen Wahlerfolgen der EU gegenüber mindestens skeptischer Kräfte, vor allem wiederum in Osteuropa. Alles nicht entspannt, möchte man sagen. Nicht mein Problem, sagt Trump. Ein weiteres Beispiel: Wahrscheinlich liegt man falsch, wenn man meint, Trump habe den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen angeordnet, weil er die ganze Aufregung um das Klima eh nicht verstünde. Vielmehr hat auch Trump nichts dagegen, daß die USA mit regenerativen Energien et cetera ordentlich Geld verdienen. Nur will er sich den Zugang zu diesem Markt nicht von einem Bündnis bestimmen lassen, in dem die USA eben nur eine Stimme unter anderen darstellt, zum Beispiel neben, seit neuestem, im Moment faktisch nicht existierenden Ländern wie Syrien.
Es ist eben so, daß die Euphorie über den Niedergang der Sowjetunion und das angebliche ‚Ende der Geschichte‘, wie Francis Fukuyama das damals spektakulär und kurzlebig nannte, längst verflogen ist. Statt der einen, kapitalistisch, bürgerlich-demokratischen Welt nach westlichem Modell hat sich zunehmend eine Welt mit allerlei einzelnen Akteuren gebildet, die jeweils versuchen, meist gegen- manchmal miteinander Beute zu machen. Philanthropisch oder idealistisch sich gebende Bündnisse aus dem Kalten Krieg haben dadurch zunehmend an Bedeutung verloren. Wer erinnert sich noch an die KSZE beziehungsweise OSZE? Auch schon der Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Pakts, ebenso die von Deutschland mit angetriebene Zerstörung Jugoslawiens ließe sich von heute aus wohl unter dieser Perspektive betrachten. Dies der Stand der Dinge auf zwischenstaatlicher Ebene. Aber auch was das bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsmodell selbst betrifft, ist von einem Ende der Geschichte nicht zu reden. Wie, damals meist übersehen, in seinem sonst vom westlichen Modell begeisterten Buch sogar Fukuyama im recht düsteren Schlußkapitel selbst als Befürchtung in Aussicht stellte, tendieren die nun allesamt zur gegenseitigen Anerkennung als Bürger gelangten Individuen zu einer Art Selbstzerfleischung qua narzisstischer Überidentifizierung mit sich selbst oder kehren gewissermaßen zu einem Hobbe’schen Krieg aller gegen alle zurück. In Bezug auf die hier skizzierten aktuellen Umstände, Konflikte und Widersprüche auf beiden Ebenen – der internationalen wie der gesellschaftsimmanenten – scheint mir Trump sicherlich keine endgültige Antwort zu sein, meinetwegen auch eine letztlich keineswegs vernünftige. Aber eine mit mehr Wirklichkeitsbezug, als man ihr gemeinhin zugestehen mag.
Bernd Volkert