Hans Zeller: Referat bei einer Buchvorstellung im West Germany
Während der alte Westen gerade einige politökonomische Purzelbäume schlägt und etwa der eurasische Faschist Alexander Dugin spotten kann, dass „sich die westlichen Demokratien rasch in geschlossene totalitäre Gesellschaften verwandeln“, melden sich die Vertreter der kritischen Theorie in Deutschland zurück. In einem Akt der „Solidarität mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes“ gaben sie das Buch „Ultima Philosophia“ heraus, mit allerlei nachdenklich-akademischen Essais. Dasselbe wurde am 29.9. im West Germany vorgestellt, unter anderem durch das hier dokumentierte, auf seinem Beitrag aufbauende Referat von Hans Zeller.
Hier ist mein Plan für heute: Es geht mir, wie in meinem Beitrag, um die rekonstruktive Methode. Die halte ich philosophisch für defizitär. Um zu erklären, was ich damit meine, stelle ich kurz die Position von Marc Nicolas Sommer vor, einem Vertreter der Rekonstruktion, den ich kritisiere. Dabei kommt ein starker Begriff von Dialektik zur Anwendung, der allerdings nicht einfach mit Hegel gleichgesetzt werden kann. All dies führt zum Paradigmenwechsel, den ich abschließend für die kritische Theorie vorschlage.
Ich beginne bei der rekonstruktiven Methode. Hierunter verstehe ich dasjenige Verfahren, welches sich einem gedanklichen Gebäude mit der Intention zuwendet, dieses wieder instand zu setzen. Die Rekonstruktion kann insofern als das Gegenteil der Dekonstruktion begriffen werden, als es ihr nicht um die Auflösung einer ideellen Struktur, sagen wir eines Textes geht, sondern im Gegenteil um den Aufweis seiner spezifischen Konsistenz. Die rekonstruktive Methode ist ein Verfahren der Stabilisierung. Sie bietet sich bei Fragment gebliebenen Schriften an, also Textruinen oder abgebrochenen Manuskripten, vielleicht sogar solchen, die noch nicht einmal veröffentlicht wurden. Rekonstruktion widmet sich dem Unfertigen, kann aber auch dort stattfinden, wo die Struktur eines Gedankenganges einfach schwer zugänglich ist. Die allermeisten sekundärtheoretischen Texte in der Philosophie sind rekonstruktiv. Sie zeichnen zum Beispiel den Weg nach, den Hegel in der Enzyklopädie verfolgt, und machen diese dadurch verständlich – zumindest ist das der Anspruch. Der Ausgangstext wird verdoppelt und aus der Distanz analysiert.
Aus der Globalisierungskritik kennen wir das Problem der Entwicklungshilfe, die mit ihren gutgemeinten Maßnahmen nicht selten den Zweck verfehlt, den sie verfolgt und über dieselben Fallstricke, könnte man sagen, stolpert auch das rekonstruktive Verfahren in seiner philosophischen Aufbauarbeit. Denn statt die Souveränität einer Philosophie zu gewährleisten, bringt sie diese in erläuternde Abhängigkeit. Etwa bei Jürgen Habermas, der die Widersprüchlichkeit der negativen Dialektik, ihre Aporizität, für einen gravierenden Mangel an der baulichen Substanz der kritischen Theorie Adornos hielt, die Habermas durch einen kommunikativen Erweiterungsbau zu stabilisieren dachte; auf dass sie in Zukunft nicht einstürzen möge. Die mitgeführte Unterstellung ist die, dass der Gedankengang ohne die rekonstruktive Begleitung zum Scheitern verurteilt ist. Sie funktioniert wie eine Mittlerin, die das ansonsten unverständliche Geschwätz in eine vernünftige Sprache übersetzt. Es handelt sich also um philosophischen Paternalismus. Das giftige Geschenk, das die Rekonstruktion einem Denken macht, besteht in einer explizierenden Unterstützung, die eigentlich sagt: Ohne unseren Beistand wäre diese Philosophie nicht intelligibel.
Eine etwas andere Variante der Rekonstruktion vertritt der bereits erwähnte MNS. Sommer ist der Negativen Dialektik weniger feindlich gesonnen als Habermas. Gleichwohl hält auch er eine klarstellende Erläuterung ihres Gedankens für unerlässlich. Sein Programm besteht in einer zergliedernden Analyse der Philosophie Adornos, die auf diese Weise eine Architektur oder ein Gerüst erhält. Dessen Grundriss ist der Inhalt von Sommers Buch: Das Konzept einer negativen Dialektik. In ihm wird Adornos Hauptwerk analytisch neu entworfen, also rekonstruiert im Sinne von: anders wiederaufgebaut. Es ist jetzt vielleicht das erste Mal überhaupt ein veritables Theoriegebäude, das auf einem soliden Fundament steht und eindeutige Abgrenzungen kennt.
Sommer unterscheidet in der Negativen Dialektik zum Beispiel die Realphilosophie von der Logik und in derselben noch einmal zwischen verschiedenen Kategorien oder Strukturbegriffen. Er überträgt damit ein extensives Schema, das wir aus der Hegelforschung kennen, wo es das idealistische System zu erfassen scheint, auf Adornos Denken. Das ist übersichtlich, aber verfehlt die Intensität der negativen Dialektik, was übrigens schon für Hegel gilt, dessen Werk derlei Äußerlichkeiten zwar eigen sind, darin aber keineswegs die Hauptsache oder die Fiber des Gedankens bilden. Fast noch mehr aber ist es bei Adorno fragwürdig, der schließlich meinte, in seinen Texten stünde jeder Satz gleich nah am Mittelpunkt, was der Annahme von Haupt- und Nebenarmen direkt widerspricht. In der Negativen Dialektik kommt es auf den lebendigen Zusammenhang von Logik und Realphilosophie an, den die Rekonstruktion unterbricht, um den Gedankenstrom in ein ordentliches Gefüge zu verwandeln. Natürlich hat Adorno sein Werk unterteilt. Es gibt eine Einleitung, die Abhandlungen gegen Heidegger und die Ontologie, danach den Begriffsteil und schließlich drei Modelle. Aber damit ist allenfalls das Material angegeben, mit dem oder an dem philosophiert wird. Keinesfalls sind dadurch Schneisen in die negative Dialektik geschlagen, deren Aufsuchen oder besser Eintragen das ausdrückliche Anliegen Sommers ist.
Allenfalls wohlwollend und fast schon künstlich könnte man Sommers Ansatz so deuten, dass er Adornos Denken konsequent umsetzt. Die Differenz, die er durch die Schneisen auch in der negativen Dialektik findet, passen zum zentralen Begriff des Nichtidentischen, das schließlich mit der Identität bricht. Die Präzision seiner Analyse ist im Einklang mit Adornos Anspruch, auf das Kleinste zu gehen und kein Detail zu vergessen. Und Sommer trennt nicht nur die Immanenz der Philosophie Adornos auf, sondern er praktiziert die Differenz auch als Vergleich, nämlich mit Hegel, den Adorno in der Tat als den einen Abstoßungspunkt seines Denkens begriffen hat. Das verleiht der Rekonstruktion weitere Plausibilität: Sommers Verfahren, der negativen Dialektik auf die Spur zu kommen, ist eine Subtraktion, die Adornos Materialismus als Dialektik ohne Synthese präsentiert. Er schreibt: „Hegels Dialektik – Idealismus = negative Dialektik“. Der hier erfolgte Abzug von der Einheit könnte so verstanden werden, dass er auf einen Rest verweist; auf etwas, das nicht aufgeht.
Doch ist die Formel in ihrer Formelhaftigkeit allzu verdächtig. Und es ist ein Leichtes, ein passendes Adorno-Zitat zu finden, das ihr widerspricht. Zum Beispiel heißt es in den Drei Studien zu Hegel, man behalte nichts als Positivismus und schale Geistesgeschichte übrig, wenn man aus Hegels Philosophie „den Idealismus ausmerzt“. Das aber ist eine Losung von Sommers Vorhaben. Adorno wollte den Idealismus nicht einfach eliminieren, was man auch so formulieren könnte, dass Sommer die negative Dialektik in ein trockenes Stück Philosophiegeschichte transformiert, dessen toten Körper er souverän zerstückelt. Wohlbemerkt: das harte Urteil folgt nicht aus der pedantischen Textstelle, sondern aus der Form, die Adornos Denken bei Sommer gewinnt oder besser verliert, da Philosophie bei ihm zu einem bloßen Thema verkommt. Dabei ist sie auch ein Tun. Und das vernachlässigt Sommer in seinem expliziten Entschluss, nicht dialektisch über die negative Dialektik zu schreiben(Form/Inhalt). Sein Verfahren hat gleichzeitig zu viel und zu wenig Distanz zu Adorno. Zu viel, weil es die spezifische Art zu Denken ignoriert, die hier vorherrscht. Zu wenig, weil es stattdessen aus akribischer Exegese besteht. Mein Vorschlag, ist die Umkehrung dieses Verhältnisses: Lösen wir uns ein wenig von Adornos Text, um der Praxis seines Denkens näherzukommen. Denn das ist auch eine Definition von Metaphysik: Das Denken des Denkens. Besser als eine Karte der negativen Dialektik zu zeichnen ist es, ihren Weg zu gehen.
Zum Beispiel den Weg der Abstraktion. Meine These ist, dass die negative Dialektik vom Begriff der Abstraktion lebt. Mir ist klar, dass so ein Satz als Provokation aufgefasst werden könnte, da sich Adornos Denken eher dem Konkreten gewidmet hat. Aber gleichwohl findet es die Abstraktion auch allerorten, ontologisiert sie gewissermaßen, insofern sie nicht nur als Fähigkeit des Verstandes begriffen wird, der vom Einzelnen absieht, sondern auch ein Zustand der Dinge sein soll. Die Abstraktion ist keine des Denkens sondern real, heißt es bei Adorno einmal. Dadurch erhält sie sich offensichtlich, und zwar nicht nur als kritisiertes Objekt der bösen Realität, sondern ebenfalls in Adornos Philosophie, die höherstufig Abstraktion des Denkens und Abstraktion der Gesellschaft abstrakt in Deckung bringt, in ihrem Gedankengang Denken und Wirklichkeit identifiziert. Nochmal anders gewendet: Die in der negativen Dialektik postulierte Übereinstimmung des kapitalistischen Systems mit dem idealistischen Hegels, also vereinfacht: die Gleichsetzung von Enzyklopädie und Fabrik, ist selbst kein schlechter Idealismus oder eben Spekulation, insofern dem Alltagsverstand widersprochen wird, der Hegels Philosophie und die ökonomischen Verhältnisse eher separieren würde.
Was hier nur angedeutet werden soll: Adorno synthetisiert ebenso sehr, wie er abweicht oder negiert. Seine Philosophie heißt negative Dialektik. Den zweiten Teil ihres Namens sollte man nicht unterschlagen. Die Insistenz auf der Dialektik leugnet keineswegs das Nichtidentische, aber bezieht es zurück auf die Identität, die bei Adorno in der Negation bestimmt wird, was man nicht für Synthese in einem höchsten Prinzip halten sollte, es sei denn damit ist das je besondere Denken gemeint, das in der Lage ist, die Zerreißprobe auszuhalten. Der Rekonstruktion entgeht das. Weil sie selbst nicht denken will, stattdessen mit der Nase am Text klebt. Für sie ist die Negative Dialektik nur Infrastruktur, aber kein Kraftfeld, weil sie den Schwung von Adornos Philosophie verpasst. Denn für den letzteren ist nur ein Denken sensibel, das die Identifikation aushält, andernfalls kein Fixpunkt für die Fluchtlinien vorhanden ist, an dem sich eine Spannung erst erzeugen könnte.
Bei Sommer und bei anderen Rekonstrukteuren führt die Abneigung gegen die identifizierende Totalität, die sie dem Buchstaben von Adornos Philosophie entnehmen, zum Verrat am Geist seines Denkens, das immer totalitär gewesen ist und auch sein musste. Nur falls der Begriff des Ganzen nicht verdrängt wird, kann sich Philosophie auf das falsche Ganze der Gesellschaft richten. Jeder mag das selbst an Sommer überprüfen: Seine Hegelkritik führt zu einer Befreiung vom Anspruch, die Wirklichkeit zu denken, womit er sich unter den von Honneth und Habermas gehaltenen Schirm des nachmetaphysischen Denkens stellt, das überzogene Vernunftansprüche ablehnt, folglich nicht mehr darum bemüht ist, die Realität durch das Denken aufzusprengen. Das ist sozusagen die Dialektik negativer Dialektik: Indem sie Hegels Position verunmöglicht hat, redet sie inzwischen denen das Wort, die vom Kapitalismus schweigen wollen. Letzterer kommt bei Sommer nur als Alibi vor, was den Grund hat, dass er sich in rekonstruktiver Absicht allein auf Adornos Text bezieht. Kritische Theorie verkommt bei ihm zum Inzest des Redens über kritische Theorie. Die Wirklichkeit entfällt. Zusammen mit der Form der Dialektik.
Damit wären wir beim Paradigmenwechsel: Ich schlage vor, die kritische Theorie zu historisieren. Akzeptieren wir, dass sie vergangen ist. Es ist ein viel zu wenig berücksichtigter Umstand, dass sie seit dem Ableben ihrer Protagonisten ein Gegenstand der universitären Philosophie geworden ist. Es wäre deshalb ratsam, eine kopernikanische Wende zu vollziehen und darauf zu reflektieren, was diese Veränderung ihres Standpunktes bedeutet. Das ist selbstverständlich eine Kritik an der Akademie, aber mehr als das, eine Überprüfung des Ortes, an dem sich kritische Theorie befindet. Sie wurde von einem Erkenntnissubjekt, das auf die Welt blickt, in eine Objekt des Denkens verwandelt, also verdinglicht. Man nahm sie in den Kanon auf, mortifizierte sie also, damit sie ins Pantheon passt, sodass Qualifizierungsarbeiten in sekundärer Stufe über sie geschrieben werden können.
Falls es heute kritische Theorie geben soll, muss das Subjekt der Kritik neu gegründet werden. Seine erste Aufgabe wäre die Reflexion darauf, dass Horkheimer und Adorno eingemeindet wurden. Ihrer Integration entspricht wohl die Absorption der Kapitalismuskritik, die man für ein wesentliches Resultat der jüngeren Vergangenheit halten kann, wenn man die Kulturrevolution um 68 geschichtsphilosophisch einordnet oder theoretisch auf Boltanski und Chiapello vertraut. Zudem gab und gibt es realiter Veränderungen, die zum Teil gravierend an der Plausibilität von Adornos Philosophie rütteln. Was machen wir etwa damit, dass Andreas Reckwitz stellvertretend für die neuere Soziologie davon ausgeht, die Logik des Allgemeinen werde zunehmend von einer Logik des Besonderen abgelöst? Falls dies so ist, müsste konstatiert werden, dass die kritische Theorie ihren Stachel verloren hat, insofern das, was sie einforderte – Abweichung, Utopie oder Kritik der verwalteten Welt, kurzum: das Nichtidentische – in die Verhältnisse eingesickert ist. Und können wir das nicht an der für die Metaphysik so wichtigen Kategorie des Möglichen ablesen? Nichts ist unmöglich sagt Toyota, entdecke die Möglichkeiten, antwortet IKEA.
Setzt man dem nun begründeterweise entgegen, an der grundsätzlichen Form der Vergesellschaftung habe sich nichts verändert, pocht man auf eben die Kategorie der Wirklichkeit, die ich wieder stark machen will. Man behauptet das Wesen gegen die Erscheinung. Und das ist nicht spektakulär, sondern eine selbstevidente Implikation der Ideologiekritik: Ich kann nicht sagen: Was du denkst ist falsch, wenn ich nicht weiß, was richtig oder sogar wahr ist. Es ist unmöglich, vom notwendig falschen Bewusstsein zu sprechen, ohne einen Begriff von Notwendigkeit. Man könnte denselben Gedanken auch direkt aus der Praxis kontemporärer Kritik ableiten, die es ja hauptsächlich mit Begriffsskepsis oder Nominalismus zu tun haben dürfte, wogegen sich nichts anderes wenden kann als der Realismus des Begriffs, d.i. die These, dass das Denken wirklich ist; das Denken und Sein identisch sind. Dies ebenso wie die Vermittlung der Modalitätskategorien führt kritische Theorie einmal mehr wieder zu Hegel.
Ich komme zum Schluss. Eine Konsequenz, die sich aus der Historisierung der Kritischen Theorie ergeben könnte, ist die Neubewertung der Geschichtsphilosophie. Adorno hat den affirmativen Bezug auf einen Endzweck der Geschichte abgelehnt und die direkte Verknüpfung seines Denkens mit einem positiven Sinn versperrt. Ich schlage vor, sich darüber hinwegzusetzen und die Philosophie wieder als ein Sinnangebot zu formulieren. In unserer heutigen Lage brauchen wir die negative Dialektik als eine Verteidigerin der Allgemeingültigkeit des Denken, die Anspruch erhebt, eine verbindliche Deutung des Geschehens abzugeben. Adorno brachte das einmal auf die Parole, jeder Erkenntnis, die eine sei, wohne die Anweisung auf Wahrheit schlechthin inne. Man muss nicht mehr machen, als diesen Gedanken zu explizieren.
Dann aber wandelt sich Dialektik abermals, in der Absicht, die Realität erneut zu treffen und es ist an uns, die Gedanken zu entwickeln, die Adornos Niveau erreichen, statt seine Positionen zu referieren. Philosophie ist nichts als die Fortsetzung der Philosophie. Konstruieren wir lieber eine gegenwärtige, statt die negative Dialektik zu rekonstruieren. Denn bei Zeiten ist ein gut begründeter Verrat besser als falsche Treue. Ohne von der kritischen, ich will sagen: revolutionären Intention abzulassen, durch das Nichtidentische objektiv die Identität der Warenform aufzubrechen oder subjektiv das Bewusstsein über dessen kulturindustrielle Limitierung zu heben, es zu transzendieren, muss die Idee einer negativen Dialektik so transformiert werden, dass Berücksichtigung findet, wie sehr Ausbruch und Transzendenz Momente des aktuellen Kapitalismus sind. Dazu passt weniger die Operation der Negation, als die der Identifizierung. Das ist meine abschließende Formel: Nur das Behaupten einer Wahrheit hat gerade subversives Potenzial. Vielen Dank!
29.9.2021
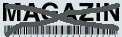
 Vortrag als PDF
Vortrag als PDF