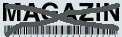Notwendigkeit des Staates
Der Staat hält nicht den „natürlichen Egoismus“ der Menschen im Zaum – er schützt das Privateigentum, das diesen Egoismus erst hervorbringt.
Die Auffassung, dass die Staatsgewalt notwendig sei, um einen „Krieg aller gegen alle“ zu verhindern, hat bereits im 16. Jahrhundert der englische Staatstheoretiker Thomas Hobbes vertreten. Den Grund dafür sah er in der Natur des Menschen: „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“, sagte er; im Grunde seien wir egoistische Raubtiere, denen Konkurrenzstreben, Misstrauen und Ruhmsucht im Blut liege und die nur durch die Furcht vor der Polizei davon abgehalten werden könnten, ihren Mitmenschen Hab und Gut zu rauben oder ihnen Gewalt anzutun.
Viele Leser werden dieser Beschreibung spontan zustimmen und aus eigener Erfahrung bestätigen, dass unsere Zeitgenossen häufig tatsächlich so rücksichtslos sind, wie Hobbes unterstellt. Der Fehler seiner Theorie besteht jedoch darin, dass er bestimmte Verhaltensweisen der Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft als unveränderliche Wesensmerkmale des Menschen schlechthin darstellt.
Die kapitalistische Gesellschaft basiert auf dem privaten Eigentum. Alle mehr oder weniger nützlichen Dinge, die diese Gesellschaft produziert – Brot, Fahrräder, Computer, Klaviere, Häuser, Maschinen usw. – gehören jeweils einer bestimmten Person, die mit diesen Dingen im Rahmen der Gesetze tun und lassen kann, was sie will. Das bedeutet aber umgekehrt, dass alle anderen von der Benutzung dieser Sache ausgeschlossen sind. Wer z.B. ein Dach über dem Kopf braucht, kann nicht einfach in ein leer stehendes Haus einziehen, wenn der Eigentümer das nicht will. Und da die meisten von uns nicht auf einem Selbstversorger-Bauernhof wohnen, bedeutet das, dass nahezu alles, was wir zum Leben brauchen, zunächst einmal anderen gehört und wir darauf angewiesen sind, dass diese es uns – meist gegen Geld – zur Benutzung oder zum Verbrauch überlassen.
In der vom privaten Eigentum bestimmten Gesellschaft treten uns unsere Mitmenschen daher meist nicht als Kooperationspartner, sondern als Hindernisse bei der Befriedigung unserer Wünsche entgegen, da ihnen dummerweise die Dinge gehören, die wir gerne benutzen würden. Wir müssen einander als Konkurrenten behandeln und um den Zugang zu Gütern, Arbeitsplätzen und Machtpositionen wetteifern. Schon um der bloßen Selbsterhaltung willen ist jeder und jede gezwungen, sich egoistisch zu verhalten, da in dieser Konstellation ein Vorteil für die eine Person meist ein Nachteil für andere bedeutet – und umgekehrt. Es ist somit das Privateigentum, das die von Thomas Hobbes beschriebenen negativen Charaktereigenschaften hervorbringt.
Und es ist auch leicht ersichtlich, dass eine Gesellschaft von Privateigentümern einer zentralisierten Macht bedarf, die darüber wacht, dass die Einzelnen fremdes Eigentum respektieren und sich nicht mit Gewalt nehmen, was sie brauchen bzw. gern genießen würden. Der Sinn des staatlichen Gewaltmonopols ist schlicht und einfach der Schutz des Eigentums. So lange dieses besteht, ist der Staat tatsächlich notwendig.
Die Vorstellung vom unabänderlichen Egoismus der Menschen ist also nichts anderes als die Projektion gesellschaftlicher Verhältnisse in die Natur. Aber selbst unter kapitalistischen Bedingungen geht das Verhalten der Menschen keineswegs in dem negativen Bild auf, das die bürgerliche Ideologie von ihnen zeichnet. Dass wir miteinander in Konkurrenz stehen, heißt nicht, dass wir immer garstig zueinander sind und nur durch die Polizei davon abgehalten werden können, aufeinander loszugehen. Mitten in der bestehenden Konkurrenzgesellschaft gibt es zahlreiche Beispiele von freiwilliger gegenseitiger Hilfe und Solidarität. Menschen engagieren sich im Fußballverein oder in Nachbarschaftsinitiativen, helfen Geflüchteten oder gründen gemeinnützige Kollektivbetriebe. Sicher sind solche Aktivitäten unter aktuellen Bedingungen oft von moralischer Selbstbeweihräucherung und teils fragwürdigen Interessen begleitet oder werden vom Staat für seine Zwecke vereinnahmt. Sie zeigen aber Potentiale auf, die sich in ganz neuer Weise entfalten können, wenn die allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen sich ändern.
Es ist auch nicht so, dass in Situationen, in denen die staatlichen Institutionen plötzlich versagen, notwendiger Weise blutiges Chaos ausbrechen muss. Nachdem der Hurrikan Katrina New Orleans in den USA verwüstet hatte, begannen Bewohner der Armenviertel, die vom Staat in Stich gelassen wurden, sich in Graswurzelorganisationen zusammen zu schließen, um medizinische Hilfe und Wiederaufbau selbst zu organisieren. Auch von vielen anderen Naturkatastrophen wird berichtet, dass die Betroffenen spontane Gemeinschaften bildeten, um mit improvisierten Maßnahmen die Situation zu meistern, während staatliche Stellen eher an der Wiederherstellung der Ordnung interessiert waren und diese disaster communities als Bedrohung ihrer Autorität wahrnahmen, die sie möglichst schnell wieder herstellen wollten.