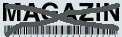3. Mensch
„Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ Marx ging von der vollendeten Religionskritik aus. In ihr wurde nicht nur Gott entthront und der Mensch eingesetzt, sondern sukzessive wurden alle Gespenster entmachtet, unter deren Joch die Menschen zu befinden sich einbildeten, egal ob Gott, Kaiser und Tribun oder Privateigentum, Geld und Kapital. All diese in der Realität wirkenden Gespenster werden nun als gesellschaftliche Verhältnisse ausgesprochen. Das ist damit gemeint, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Das Eigentum etwa ist keine Macht an sich, es ist das Verhältnis des Arbeiters zu den von ihm erzeugten Dingen. Er verhält sich ihnen gegenüber so, als ob sie nicht ihm, sondern den jeweiligen Kapitalbesitzern gehörten, und gibt ihnen erst dadurch die höhere Weihe des Eigentums. Indem aber die Verhältnisse genau dies objektiv erfordern, entsteht aus der ideellen Negation der herrschenden Gespenster das Bedürfnis ihrer reellen Negation, und aus dem Anspruch, dass der Mensch dem Menschen das höchste Wesen sei, folgt der kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzustoßen, in denen er das nicht ist. Dabei geht das Gebot, der Mensch dürfe kein verächtliches Wesen sein, allem Denken und Handeln voraus. Es ist gewissermaßen das einzige Axiom der Marxschen Kritik. An ihm misst er insbesondere die kapitalistische Gesellschaft. Es selbst entzieht sich der Reflexion. Wenn man sagt, der Mensch solle dem Menschen ein Sklave sein, und sei es ein Lohnsklave, man wird nichts von den Mysterien der Marxschen Kritik verstehen und kann sich anderen Dingen widmen.
Der Mensch ist also das Maß der Dinge. Und welch ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie edel durch Vernunft! Wie unbegrenzt an Fähigkeiten! In Gestalt und Bewegung wie bedeutend und bewunderungswürdig! Im Handeln wie ähnlich einem Engel! Im Begreifen wie ähnlich einem Gott! Die Zierde der Welt! Das Vorbild der Lebendigen! Marx hat einen emphatischen Begriff vom Menschen, gerade in den hier herangezogenen Pariser Manuskripten. Die von ihm verwendete Sprache ist dabei gewöhnungsbedürftig, entstammt noch ganz der materialistisch gewendeten klassischen deutschen Philosophie. So ist der Mensch ihm ein „Gattungswesen“, nämlich, indem er sich irgendwie kantisch-hegelsch „zu sich selbst als einem universellen, darum freien Wesen verhält.“ Ein Mensch ist nicht einfach ein Individuum, sondern lebt nur im Zusammenhang mit anderen Menschen und durch in gemeinsamer Tätigkeit bearbeitete und angeeignete Natur: „Das Gattungsleben, sowohl beim Menschen als beim Tier, besteht physisch darin, daß der Mensch (wie das Tier) von der unorganischen Natur lebt, und um so universeller der Mensch als das Tier, um so universeller ist der Bereich der unorganischen Natur, von der er lebt.“ Der Mensch lebt im Stoffwechsel mit der Natur, atmet alle Naturkräfte ein und aus, die ganze „Natur ist sein Leib“ und mag sie auch „in der Form der Nahrung, Heizung, Kleidung, Wohnung etc. erscheinen.“ Der Mensch unterscheidet sich dabei vom Tier, indem er seine Geschichte bewusst bestimmt: „Eben nur dadurch ist er ein Gattungswesen. Oder er ist nur ein bewußtes Wesen, das heißt, sein eignes Leben ist ihm Gegenstand, eben weil er ein Gattungswesen ist. Nur darum ist seine Tätigkeit freie Tätigkeit.“ Der Mensch existiert nur durch sein Denken, aber Denken praktisch gedacht, als „bewußte Lebenstätigkeit.“ Marx spricht in der Tradition des französischen Materialismus aus, dass der Mensch inklusive seines Denkprozesses ein Naturwesen ist: „Daß das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen andren Sinn, als daß die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein Teil der Natur.“
Der Mensch formt sich also die Natur, er sammelt Rohstoffe, schmilzt sie, gießt sie, sägt sie, verknüpft sie auf neue Weise, hämmert, näht und zieht, drückt, schweißt und klebt die Natur. „Er benutzt die mechanischen, physikalischen, chemischen Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andere Dinge, seinem Zweck gemäß, wirken zu lassen.“ Und die so erzeugten verarbeiteten Produkte werden ihrerseits weiter verarbeitet, bis ein Auto oder ein Telegraphennetz daraus geworden ist, die, so künstlich sie uns dünken, doch nichts als eben Natur bleiben: „Die Form des Holzes wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz.“ Und so züchtet der Mensch Tiere, pflegt und mästet sie, um sie am Ende zu schlachten. Er meistert den Blitz und erleuchtet selbst die Dunkelheit. Er klaut der Kuh, dem Schaf und der Ziege ihre Kindernahrung, läßt dieselbe gären und schmecken. Er bringt die Luft in Wallung, indem er in geschickt angeordnete Röhren bläst, auf Seiten schlägt oder sonst Resonanz erzeugt, er nimmt die resultierende Schwingung als Blaupause auf und feiert mit der sich ergebenden und überall reproduzierbaren Musik seinen Triumph. Und eben in all solcher mannigfaltigen Tätigkeit erweist sich der Mensch als Gattungswesen: „Diese Produktion ist sein werktätiges Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit.“ Dabei sind alle Sinne involviert, der „Mensch eignet sich sein allseitiges Wesen auf eine allseitige Art an, also als ein totaler Mensch.“ Der Mensch ist sinnlicher Mensch und wenn dieser sich mittels Formung und Aneignung der Natur selbst genießt, so nur durch sein „Sehn, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Tätigsein, Lieben“, kurz durch „alle Organe seiner Individualität“. – Und so schaut der Mensch sich in der von ihm geschaffenen Welt an und freut sich, „denn der Mensch formiert auch nach den Gesetzen der Schönheit.“ Amen.