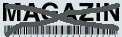6. Fetischismus
Wie das zugehen soll? Eine unsichtbare Hand steuert die sichtbaren Hände, wie das schon Smith so schön formuliert hatte? Es wird die im vierten Kapitel des Kapitals sich findende Zuspitzung des Kapitals als „automatisches Subjekt“ oft für eine bloße Metapher genommen, der aufgeklärte Mensch fürchtet die Religion. Dabei folgen gerade die ersten vier Kapitel des Kapitals tatsächlich einer gewissen Stringenz, die dann erst mit dem Hereinkommen der empirischen Welt, also der Analyse der Lohnarbeit, gebrochen wird. Wie kann es also sein, dass die einzelnen Menschen ihr Tun von einem Geldgott leiten lassen, dass tatsächlich das Geld die Welt regiert? Nehmen wir die Ameisen. Jede einzelne Ameise lässt sich ausschließlich von ihren unmittelbaren Nöten leiten, sie sondert einen Pheromon genannten Duftstoff aus, wenn sie Nahrung gefunden hat und sie, den Rücken bepackt, zum Bau läuft. Andererseits folgt sie diesen von bereits fündigen Ameisen erzeugten Düften, wenn sie auf Nahrungssuche ist. Der Rest ist Zufall, es fehlt diesen artigen Tieren jedes Bewusstsein für ihr Tun, geschweige denn, dass sie ihre Handlungen im voraus planen könnten. Doch welch herrliches Resultat: Haufen und Futterquelle sind durch den kürzestmöglichen Weg verbunden. Der Zufall marschiert in perfekter Ordnung, die hinter dem Rücken der braven Ameisen sich herstellte und selbst erfahrene Algorithmiker vor Neid erblassen lässt. „Sie wissen es nicht, aber sie tun es.“
Eine vernünftige Planung unseres Stoffwechselprozesses mit der Natur setzte voraus, dass man ihn durchschaut. Mit Durchschauen ist dabei nicht nur gemeint, dass man versteht, wie die mannigfaltigen Prozesse funktionieren, die nötig sind, um aus vielfältigem Naturstoff solch erhabene Dinge zu machen wie etwa eine hochautomatisierte Autofabrik. Das schafft in Form des eigenwilligen Expertenwissens sogar das bornierte Kapital, da es beständig gezwungen ist, den Produktionsprozess effektiver zu gestalten und überhaupt zu organisieren. Durchschauen bedeutet vor allem, dass man sich in den Zielen und Zwecken der Produktion erkennt, weil eben diese Ziele und Zwecke selbstbewusst bestimmt werden, so dass sofort einsichtig ist, ob eine konkrete Arbeit überhaupt Sinn ergibt. Unter kapitalistischen Bedingungen erübrigt sich diese Frage nach dem Gesamtzusammenhang der Produktion schon von vornherein: „Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag den Menschen interessieren. Er kommt uns nicht als Dingen zu. Was uns aber dinglich zukommt, ist unser Wert.“ Um diesen Wert dreht sich dann tatsächlich alles. Der allgemeine Prozess der Produktion drückt sich daher gegenwärtig adäquat in den Diagrammen der Börsenkurse aus und es ist müßig, danach zu fragen, um was es sich dabei überhaupt dreht.
Einer der wesentlichen Einwände von Marx gegen den Kapitalismus ist daher die Undurchsichtigkeit seiner Produktion. So schön es ist, dass hier gesellschaftliche Arbeit im gigantischen und stets zunehmenden Ausmaß getätigt wird: Diese gesellschaftliche Arbeit hat die Form der Privatarbeit und um den Inhalt braucht sich weder der einzelne Arbeiter noch der einzelne Kapitalist zu scheren. Der Arbeiter tauscht schlicht seine Arbeitskraft, um einen Anspruch auf einen gewissen Anteil des allgemeinen Reichtums zu erhalten, der Kapitalist tauscht die von ihm beanspruchten Produkte der Arbeit des von ihm gemieteten und kommandierten Arbeiters, um daraufhin neben etwas privatem Reichtum auch den Anspruch auf weitere Produktionszyklen zu bekommen. „Was die Produktentauscher zunächst praktisch interessiert“, sagt daher Marx, „ist die Frage, wieviel fremde Produkte sie für das eigene Produkt erhalten, in welchen Proportionen sich also die Produkte austauschen.“ Erst indem die Produkte der Privatarbeit universell ausgetauscht werden, erweisen sie den gesellschaftlichen Charakter ihrer Arbeit. Es ist noch nichtmal alles schlecht, was auf diese Weise produziert wird, da für diesen Tauschakt immerhin überhaupt ein zahlungskräftiges Bedürfnis befriedigt werden muss, und wie entfremdet und elend auch immer, das Kapital nährt uns trotzdem, stiftet eben unseren Gattungszusammenhang. Aber dieses dann alles bestimmende Allgemeine wird hinter dem Rücken der Akteure gesetzt, durch all diese individuellen wie zufälligen Austauschakte und Arbeitsprozesse hindurch. Der allgemeine Sinn ihres Tuns geht eben nicht die Menschen an, dafür ist der Markt zuständig. Die alles ehern in den Griff nehmende durchschnittliche Arbeitszeit wird nämlich negativ durch die Konkurrenz erzeugt, ist unbewusste Resultante von Myriaden isolierter Akte, wie sie hernach deren Determinante wird. Die „unabhängig voneinander betriebenen, allseitig voneinander abhängigen Privatarbeiten“ werden nämlich nur „fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert“, „weil sich in den zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als regelndes Naturgesetz gewaltsam durchsetzt, wie etwa das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt.“ Es sei dabei gerade das „bloß atomistische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Produktionsprozess“, das ihrer Produktionsweise eine „von ihrer Kontrolle und ihrem individuellen Tun unabhängige, sachliche Gestalt“ gebe. Ihr eigenes gesellschaftliches Verhältnis, die Enteignung der Produzenten von ihrem eigenen Produkt und die Aneignung desselben durch den Kapitalisten, erscheint ihnen dergestalt als ein „Verhältnis der Dinge“, X Tonnen Weizen entsprechen soundso vielen Smartphones etc. Selbst die Arbeitskraft erscheint als ein zu tauschendes Ding, für die Arbeiter sogar das einzige Ding, das sie tauschen können.
Schon die manische Gleichsetzung zweier beliebiger Produkte im einzelnen Tauschakt nennt Marx dabei buchstäblich verrückt. Er bemüht sich, analog zu seiner oben erwähnten Frucht, die Absurdität unserer ökonomischen Formen dadurch kenntlich zu machen, dass er, anstatt eine bekannte Geldware einzuführen, zunächst alle Waren auf Leintuch bezieht. „Wenn ich sage, Rock, Stiefel usw. beziehen sich auf Leinwand als die Verkörperung abstrakt menschlicher Arbeit, so springt die Verrücktheit dieses Ausdrucks ins Auge. Aber wenn die Produzenten von Rock, Stiefel usw. diese Waren auf Leinwand – oder auf Gold und Silber, was nichts an der Sache ändert – als ihr allgemeines Äquivalent beziehen, erscheint ihnen die Beziehung ihrer Privatarbeiten zu der gesellschaftlichen Gesamtarbeit genau in dieser verrückten Form“. Insbesondere erscheint damit das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen als natürliches Verhältnis der in Warenform gekleideten Dinge und die alternativlose Warenform erscheint als „Natureigenschaft dieser Dinge“. Zwar „geht kein Atom Naturstoff in ihre Wertgegenständlichkeit ein“ und der „Warenhüter muß seine Zunge in ihren Kopf stecken oder ihnen Papierzettel umhängen, um ihre Preise der Außenwelt mitzuteilen“, am Ende ist man doch gezwungen, sich den Dingen gegenüber so zu verhalten, als hätten sie Wert und als wäre es auch nach dem Arbeitsprozess noch interessant, wieviel Arbeit in das Produkt gesteckt wurde, geradezu als stecke die Arbeit auch, nachdem sie im Produkt erloschen ist, auf mystische Weise weiter in ihm. Marx spricht davon, dass sich die Arbeit im Kapitalismus in den Produkten „kristallisiert“ und erst im Endkonsum hören sie auf, Arbeit zu repräsentieren, werden endlich verzehrt, als wäre nichts weiter dabei. Noch im produktiven Konsum hingegen gelten die Maschinen, das Werkzeug, die Rohstoffe weiter als Kostenfaktor und wehe, das Produkt kann diese Kosten nicht einspielen.
Diese einzelnen, verrückten und selbst auf die Arbeitskraft ausgedehnten Tauschakte setzen sich dann zu einem Kapitalprozess aus unterschiedlichsten miteinander verschlungenen Einzelkapitalien zusammen, der dann, einmal als gesellschaftliches Produktionsverhältnis durchgesetzt, die Einzelnen fortwährend zu diesen albernen Tauschakten zwingt, wie die Ameisen zum Einhalten ihrer Pfade. Der gesamte Arbeits- und Konsumtionsprozess organisiert sich durch diese Tauschakte. Man muss dabei nicht einmal an den Geldgott glauben oder ihn gar verehren, solange man ihn doch wenigstens zur Maxime allen Handelns erhebt. Diese Art des modernen Götzendiensts nennt Marx „Fetischismus“. Er ist die gültige Denkform unserer Epoche und zwar exakt so lange, bis das Privateigentum aufgehoben wird: „Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen.“
Der Fetischismus verschleiert dabei die wirkliche Ausbeutung. Indem sich der Kapitalismus als ein durch Sachzwänge getriebenes unpersönliches System darstellt, dessen Motor auf die Formel G – W – G’ reduzierbar ist, am Ende ist es doch der Arbeiter, der dem Kapitalisten gehorchen muss. Marx beendet seine Darlegung des allgemeinen und unpersönlichen Kapitalkreislaufes daher gerade, indem er zum wirklichen Verhältnis von Arbeiter und Kapitalisten übergeht, dass sich hinter diesen objektiven Verhältnissen nur schlecht verstecken kann: „Der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter; der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andre scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigne Haut zu Markt getragen und nun nichts andres zu erwarten hat als die – Gerberei.“