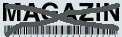Frauen und der SDS

„Rainer Langhans wohnte eine kurze Zeit in meiner Wohngemeinschaft. Ich lernte ihn als ziemlich neurotisch kennen. Er hatte Probleme mit seiner Freundin, von denen ich nichts wissen wollte. Dann, mit der KI war seine Neurose in der Öffentlichkeit. Darin lag der Skandal, die Peinlichkeit für uns rationale Funktionäre des SDS. Diese Selbstentblößung entblößte auch uns. Es brachte uns in den Verdacht, dass unserem politischen Handeln ganz persönliche Motive unterlagen, dass wir möglicherweise für Vietnam auf die Straßen gingen, weil wir auch sonst frustriert waren. Aber das Wort von den Orgasmusschwierigkeiten war entschlüpft und nicht wieder gutzumachen.“ (Klaus Hartung 1977)
Schon die Bildzeitung hatte mit ihrer Übertreibung des studentischen Aktivismus enttarnt, dass das Engagement gegen den Vietnamkrieg nur vorgeschoben war und es in Wirklichkeit um einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung ging. Während die BILD so den wirklichen politischen Zusammenhang erfasste, schaffte es Langhans mit seinem provokativen Ausspruch „Was geht mich der Krieg in Vietnam an, solange ich Orgasmusschwierigkeiten habe“ die verdrängten persönlichen Bedürfnisse stärker ins Bewusstsein zu erheben, die doch die Triebfeder jeglicher Emanzipationsbestrebungen bleiben, egal, wie weit man seinen Geist in die Welt schweifen lässt.
Doch wollte der SDS zumindest zu diesem Zeitpunkt, Anfang 1967, noch als seriöse Organisation gelten, die auf die verheerende Situation in Vietnam aufmerksam machte, und sich nicht mit den Orgasmusschwierigkeiten ihrer Mitglieder beschäftigen wollte. Als klassischer politischer Verein interessierte man sich höchstens theoretisch für die Emotionen, die privaten Schwächen und Probleme, Sexualität, Liebe und Beziehungen und den ganzen reproduktiven Bereich. Daran änderte auch der neue antiautoritäre Schwung nichts, der sich auf der Bundesdelegiertenversammlung in Frankfurt im September 1967 zeigte, als Dutschke und Krahl mit ihrem Organisationsreferat den SDS auf eine neue Stufe heben wollten und damit durchschlagenden Erfolg hatten. Darin wurde immerhin gefordert, dass der SDS kein traditioneller Verband mehr sein solle, deren Mitgliedern ein abstraktes Bekenntnis zum Sozialismus abgaben. Statt dessen solle die Politik das Leben der Studenten ergreifen, man solle sich der Gesellschaft aktiv verweigern und dieses „Sich-Verweigern in den eigenen Institutionsmilieus“ erfordere eine „Guerilla-Mentalität“, denn andernfalls wären „Integration und Zynismus die nächste Station“. Allerdings kamen die Fragen des Zusammenlebens im Organisationsreferat nicht vor und diese Forderung blieb dementsprechend abstrakt. Die Kommune I blieb aus dem SDS ausgeschlossen und die Kommune 2 hatte sich schon im Februar 1967 vom SDS zurückgezogen. Völlig unverbunden stand Mitte 1967 daher die Kampagnenpolitik der Berliner Genossen (Engagement für den Vietcong, Universitätskonflikt, Justiz- und Springerkampagne) neben den immer noch als privat erachteten Problemen des Zusammenlebens, der Rolle der Frauen im SDS und der Frage der Kindererziehung.
Der SDS zeichnete sich dadurch aus, dass nicht nur in der politischen Praxis, sondern auch in der Sprache und der Theoriebildung das bürgerliche Ideal vorherrschte, von den eigenen Bedürfnissen und Leidenschaften zu abstrahieren. Das führte zu einer abstrakten, oftmals trockenen Sprache, die sich durch eine gewisse Phrasenhaftigkeit auszeichnete, die auf viele zwar eine Faszination ausübte, aber der sich doch auch genug Frauen wie Männer nicht gewachsen fühlten. Die Diskussionen in den verschiedenen Arbeitsgruppen im SDS waren oft genug durch ein repressives Klima geprägt; immer wieder wurde derjenige ausgelacht oder ignoriert, der den Jargon nicht drauf hatte oder sich noch nicht alle als notwendig erachteten Texte „drauf gepackt“ hatte, wie man damals sagte. Im schon erwähnten Film von Sander, »Der Subjektive Faktor«, wird dieser Umgang miteinander drastisch dargestellt. Das heißt nicht, dass im SDS keine Frau etwas zu sagen gehabt hätte, aber diese musste sich dann, um Erfolg zu haben, denselben Härten aussetzen wie die Männer, wozu nicht alle Lust verspürten. Sigrid Fronius, eine derjenigen, die sich im SDS durchgesetzt hatten, beschreibt, dass sie sich als Frau im Konkurrenzkampf innerhalb des Argument-Clubs nur als Beobachterin fühlte, die mit dem Gerangel der Männer um die Anerkennung von Wolfgang Fritz haug nichts zu tun hatte. Doch erlebte sie wiederum auch, dass sie von den Männern gefördert und unterstützt wurde. So traute sie sich zu, wichtige Positionen einzunehmen. Diese zehrten sie jedoch nach einiger Zeit auf, und so legte sie Mitte 1968 nach einem halben Jahr den Asta-Vorsitz nieder. Die immer gleichen Aktionen und den Rund-um–die-Uhr-Wirbel des SDS empfand sie buchstäblich als unfruchtbar, weil sie nicht in der Lage war, die Texte, die ja durchaus einen engen Bezug zum eigenen Leben hätten haben können, auf sich zu beziehen:
„Wir haben schwierige Texte gelesen, von Marx, Horkheimer und Lukács und die Bücher verschiedener Soziologen. Einen Schwerpunkt bildetet Freuds Psychoanalyse. Es gab einen Sexualitätsarbeitskreis, in dem wir Bücher von Wilhelm Reich lasen. Wir sprachen über die Wichtigkeit des Orgasmus. Doch mir fiel nicht auf, dass ich selbst, wenn ich mit meinem Freund schlief, keinen Orgasmus hatte.“ (Sigrid Fronius 2002)
Natürlich können auch Frauen sich die abstrakte Sprache der Männer aneignen, auch wenn es für sie oft eine größere Anstrengung bedeutet, und können ebenso formalistisch argumentieren. Es geht bei einer Kritik am Geschlechterverhältnis im SDS nicht allein darum, dass hier nur wenige Frauen Einfluss hatten, sondern dass wesentliche Anteile der Gesellschaft im SDS verdrängt wurden. Für Sander war der SDS daher nur ein Spiegelbild der bürgerlichen Gesellschaft, in der zwar auch einige Frauen in Spitzenpositionen gelangen können und der Großteil der Frauen arbeiten geht, dafür aber einerseits notwendig ist, dass sie sich ganz wie traditionell die Männer für die Arbeit in spezifischer Weise zurichten, und andererseits die Reproduktionsarbeit und die damit verbundene symbolische Ordnung außen vor bleibt:
„Die Verdrängung wird komplett, wenn man auf diejenigen Frauen verweist, die innerhalb des Verbandes eine bestimmte Position erworben haben, in der sie aktiv tätig sein können. Es wird nicht danach gefragt, welche Versagungen ihnen das möglich gemacht haben, es wird übersehen, dass dies nur möglich ist durch Anpassung an das Leistungsprinzip, unter dem ja gerade auch Männer leiden und dessen Abschaffung das Ziel ihrer Tätigkeit ist. Die so verstandene Emanzipation erstrebt nur eine Gleichheit in der Ungerechtigkeit, und zwar mit den von uns abgelehnten Mitteln des Konkurrenzkampfes und des Leistungsprinzips.“ (Helke Sander 1968)