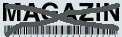Das revolutionäre Experiment: Die Kommune

Das Problem wurde auch innerhalb der Subversiven Aktion selbst bemerkt. Es musste eine Form gefunden werden, die die durch die Familie befriedigten Bedürfnisse übernimmt und doch den Zwangscharakter der Familie überwindet. Die Idee der Kommune wurde geboren: Bis dahin hatten sie alle weitgehend alleine gewohnt, oder mit ihren Beziehungen. Jetzt wollten sie zusammenziehen. Im April 1964 kam der Plan auf, „alle privaten Bereiche und exclusiven Besitzverhältnisse aufzusprengen und solidarisch-zärtliche Beziehungen vorwegzunehmen“ (Frank Böckelmann). Es ging – wie sich der Subversive Christopher Baldeney ausdrückte – darum, „nicht nur bewusst zu machen was ist, sondern bewusst zu machen, was sein soll“, und so sollte schon im Hier und Jetzt experimentell die herrschaftsfreie Gesellschaft vorweggenommen werden.
Obwohl sich niemand explizit gegen das anvisierte gemeinsame Haus aussprach, wurde das Projekt nicht in Angriff genommen. Böckelmann vermutet, dass Misstrauen der verschiedenen Wortführer gegeneinander und Angst vor zu viel Kontrolle die Gründe gewesen sein mögen. Offensichtlich wurde der problematische Umgang miteinander demnach wahrgenommen, jedoch ohne, dass die Mitglieder gewusst hätten, wie das zu verändern sei. Des weiteren gab es viele Ängste, was das Leben in einer Kommune konkret bedeuten würde: Sollte hier eine „befreite Sexualität“ gelebt werden? War man wirklich schon dazu in der Lage, die Eifersucht zu überwinden und sich vollkommen einer Gruppe zu öffnen, die oft nicht besonders solidarisch mit den Schwächen der Einzelnen umging? Schließlich ging es bei der Frage um das Für und Wider einer Kommune auch um die Frage von Reform versus Revolution. Denn es war eine Sache, die bestehenden Verhältnisse theoretisch sowie die bürgerliche Subjektivität auch praktisch zu negieren, jedoch eine andere, einen positiven Gegenentwurf zu realisieren, ohne auf die ein oder andere Weise in die Verhaltensweisen der alten Gesellschaft zurückzufallen.
Die Idee mit der Kommune war aber, einmal geboren, nicht mehr tot zu kriegen. Gut zwei Jahre später wurde die Idee wieder aufgegriffen, nun aber von dem Teil der Gruppe, der die psychische Vermittlung der Herrschaft im Einzelnen als ein Scheinproblem noch zwei Jahre vorher als „Scheinproblem“ abgetan hatte und sich auf die Arbeiterpraxis und die antiimperialistischen Bewegungen stürzen wollte. Im weiteren Verlauf zeigte sich jedoch, dass sowohl Kunzelmann als auch Dutschke das subjektive Moment innerhalb der Subversiven Aktion lediglich in seiner Einseitigkeit polemisch bekämpft hatten, diesem aber insofern treu geblieben waren, als sie es durch eine explizit politische Seite ergänzen wollten. Und so traf sich im Sommer 1966 der aktivistische und marxistische Flügel der ehemaligen Subversiven Aktion, also Dutschke, Kunzelmann, Rabehl, Marion Stegar-Steffel und andere, eine Woche lang im bayerischen Kochel und beschlossen das neue Programm ihrer politischen Arbeit: Die Solidarität mit Vietnam sollte durch die Revolution in den Metropolen angekurbelt werden. Zudem sollte die politische Arbeit durch die Erschaffung einer gemeinsamen Reproduktionsbasis erleichtert werden: der Kommune. Auf diese Weise sollten Politik und Reproduktion der Genossinnen und Genossen in eins gesetzt werden. Auch sollten die Kommunen als Kommunikationszentren dienen, in denen die politische Tätigkeit und das Wohnen nicht mehr getrennt stattfänden.
Rudi Dutschke, der, soweit das heute noch zu rekonstruieren ist, auf Anregung von Gretchen Dutschke die Idee einer Kommune erneut einbrachte, sah diese hauptsächlich als vereinfachte Form der Reproduktion, indem alle ihre Mittel zusammenbrachten, sowie als vereinfachte Form der politischen Kommunikation, die vor allem ein Reagieren auf aktuelle Situationen erleichtern sollte. Gretchen Dutschke schreibt im Rückblick, dass sie mithilfe der Kommune vielmehr die für sie unerträgliche Geschlechterfrage im SDS durchbrechen wollte. (5) Sie glaubte, dass wenn die Reproduktionsarbeit gerechter zwischen den Geschlechtern aufgeteilt würde, sich auch mehr Frauen an der politischen Arbeit beteiligen würden. So könnte die Trennung von privat und öffentlich, die weitestgehend auch den SDS durchzog, und in dem sich die Frauen oft genug wieder im Privatbereich wiederfanden, aufgebrochen werden. Kunzelmann betonte die Einheit der politischen Praxis mit der utopischen Vorwegnahme besseren Zusammenlebens in der Kommune, da er sich eine systemsprengende Praxis nur vorstellen konnte, wenn sich auch die Individuen veränderten. Gleichzeitig könnten ein Wandel die Individuen wiederum nur durch die politische Praxis eintreten. Die Konzentration auf nur eine dieser zwei Seiten wäre Kunzelmann zufolge problematisch:
„Praxis nach außen ohne experimentelle Vorwegnahme dessen, was Menschsein in emanzipierter Gesellschaft beinhalten könnte, wird zum Aktivismus als Normerfüllung. Die vielbeschworene neue Qualität der Kommune ohne gemeinsame Praxis wird sich als solipsistischer Akt, Psychose und elitärer Zirkel entpuppen.“ (Notizen zur Gründung revolutionärer Kommunen in den Metropolen, 1966)
Die ersten anvisierten Schritte auf dem Weg zur Kommune waren sehr konkret: Ein gemeinsames Haus sollte gebaut werden, das nach den Bedürfnissen eines gemeinsamen Lebens gestaltet und eingerichtet werden sollte. Auch sollte überlegt werden, wie gemeinsam gewirtschaftet werden könne. Aus diesen Plänen wurde jedoch nichts. Kunzelmann und seine damalige Freundin Dagmar Seehuber zogen zwar nach Berlin und es gab regelmäßige Kommunetreffen, die bis zu 50 Leute besuchten, aber Rudi und Gretchen Dutschke sowie Bernd Rabehl zogen sich bald aus dem Vorhaben heraus. Sie lehnten die offenen Beziehungsformen ab, die vor allem Kunzelmann vorschwebten, da sie damit einen neuen Zwang verbanden, und wollten auf dieser Grundlage keine Kommune gründen. Sie befürchteten, dass die daraus resultierenden Konflikte überhandnehmen würden.
Etwas später wurde die Idee der Kommune durch die Gründung zweier Wohnprojekte trotzdem verwirklicht. Zunächst formierte sich um Kunzelmann die Kommune I. Etwas später entwickelte sich aus dem Berliner SDS-Vorstand von 1966/67, der in den Büros des SDS sowohl lebte als auch arbeitete, die Kommune 2. Sie stach – anders als die Kommune I – weniger durch spektakuläre Aktionen oder Flugblattfließbandarbeit hervor, sondern schrieb längere Artikel und Bücher, in denen sie ihre Praxis reflektierte.
In den beiden Kommunen wurde nun versucht, politische Arbeit und individuelle Befreiung zusammen zu leben und sich gegenseitig Halt zu geben, jenseits der konventionellen Familie und der Zweierbeziehung. Bei beiden gab es Kochpläne und Kindertage, so dass die praktische reproduktive Arbeit unter allen aufgeteilt wurde, was jedoch – wie zu zeigen sein wird – nicht automatisch zu einem gleichberechtigeten Miteinander führte. Vor allem die K I wurde zudem bekannt für ihre oftmals phantasievollen Aktionen und ihre provokanten Flugblätter. Das Experiment sollte – und das war einer der wesentlichen Punkte – ja nicht ‚solipsistisch‘ vor sich hin existieren, sondern eine politische Kraft sein und darin eine Vorbildfunktion für die Restbevölkerung übernehmen. Zu diesem Zweck musste diese Kommune einen großen Bekanntheitsgrad erlangen. Und als hätte die Gesellschaft nur darauf gewartet, wurden Berichte über die K I mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination begierig aufgenommen und die Medien schlugen sich um Exklusivinterviews und Fotos.
Auch bei nur geringfügiger Kenntnis der Psychoanalyse verweisen die Medienberichte über die Kommune auf einen Wunsch innerhalb der Bevölkerung nach der eigenen sexuellen Befreiung und einer anderen Form des Zusammenlebens. Denn die sexuelle Freizügigkeit, die in der Kommune vermutet wurde, hatte nur bedingt etwas mit der realen Kommune zu tun. Den häufig kolportierten Zwang, dass jeder mit jedem schlafen müsse, gab es nicht und sowieso war die sexuelle Befreiung der Kommune nur eine heterosexuelle. Jedoch haben die Männer in der K I aufgrund ihres exotischen Lebensstils gerade auf junge Mädchen eine gewisse Faszination ausgeübt. So richtig wussten die Genossen nichts mit ihren „Groupies“ anzufangen und schickten diese einkaufen. Für Bommi Baumann, der sich ab Sommer 1967 ein paar Monate in der K I aufhielt, waren die Jungs – in der Kommune gab es zu dieser Zeit nur ein Frau, nämlich die Freundin von Rainer Langhans, Antje Krüger – ziemlich faszinierend, aber ihre Probleme mit der sexuellen Befreiung erschienen ihm sehr bürgerlich. Als Arbeiterkind hatte er anscheinend deutlich weniger Probleme damit:
„Es geht ja darum, dass du in einen anderen Lebensprozess rinkommst, dass du diese Entwicklungsfähigkeit gleichzeitig entdeckst, [...] obwohl ich am Anfang echt nicht begriffen habe, was die im Einzelnen so erzählt haben. Reich-Theorien, Zweierbeziehungen und hin und her. Denn bei uns war das sowieso ganz einfach. Da haste mal mit der Braut gepennt, denn mit der, [...] und zu der Zeit sind dir soviel Bräute hinterhergerannt, dass du so ein Ding nie druff hattest. Wenn du lange Haare hattest und bist irgendwo hingekommen, da haben unheimlich viel Bräute auf dir gestanden, gerade die ganzen Fabrikmiezen. Das fanden sie natürlich gut, so einen Typen, der irgendwie einen Auftritt hatte. Die angepassten Typen waren damals ja echt nicht gefragt, das war ja eine sehr günstige Zeit. Die Kisten haben mich dabei echt nicht interessiert, das waren ja bürgerliche Probleme, das Problem gab es für mich nicht so. Diese ganzen Psychodramen, die sich in den Kreisen abgespielt haben, zu denen hat man natürlich ein anderes Verhältnis gehabt, hast du immer einen anderen Einstieg gehabt. Liebesgeschichten sind da immer heavy gelaufen, da hast du es natürlich leichter gehabt.“ (Bommi Baumann 1975)
Bekannt ist jedoch nicht, was die jeweiligen „Bräute“ dazu gedacht haben.
Wenn es für die Männer teilweise tatsächlich so etwas wie eine sexuelle Befreiung gab, war die Kommuneerfahrung zumindest für die Frauen, die sich später nicht ganz so einfach, weil sie mit den versuchten offenen Beziehungsstrukturen weniger gut zurechtkamen und darunter litten, sich aber auch nicht trauten, dies offen auszusprechen, wie man an dem Beispiel von Dagmar Seehuber gut aufzeigen kann. Seehuber, die, bevor sie in die Kommune zog, mit Dieter Kunzelmann zusammen gewesen war, berichtet, dass sie sich einfach noch zu sehr an Kunzelmann gebunden fühlte, um mit jemand anderem ein sexuelles Verhältnis zu beginnen, außerdem hätten die anderen Platzhirsche von der Kommune I sowieso keine Chance bei ihr gehabt. Weitere Probleme seien entstanden, als sie von kunzelmann schwanger wurde. Für die restlichen Kommunemitglieder, vor allem für Kunzelmann, sei Seehuber zufolge sofort klar gewesen, dass sie das Kind nicht bekommen sollte; ein Kind hätte abgesprochen werden müssen. Für ihre eigenen Gefühle sei kein Platz gewesen, tatsächlich wollte sie das Kind behalten. Zwar bezahlte die Kommune aus der Gemeinschaftskasse das Geld für den Abbruch und Seehuber hatte keine Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden, aber über ihre Gefühle reden konnte sie nicht. Kunzelmann wiederum fühlte sich überhaupt nicht für die Angelegenheit verantwortlich. Verhütung war schließlich Sache der Frau! So galt zwar die sexuelle Freiheit formal für alle gleich, aber aufgrund der verschiedenen Sozialisation bedeutete dies für Männer und Frauen jeweils etwas anderes.
Bei der Produktion der Flugblätter sah das ähnlich aus. Seehuber beschreibt zwar, dass sie bei den Diskussionen durchaus mit den Männern habe mithalten können, reflektiert dies aber als Anpassung an die „Männergeschichten“ (Seehuber), denn bei den Diskussionen und den aggressiv gefärbten Aktionen und Flugblättern ging es viel um Konkurrenz und Profilierung.
In der K I haben folglich vor allem die Männer von der Aufhebung der Trennung von privat und öffentlich sowie von der Ablehnung von Ehe und Familie profitiert. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit, konnten sie (primär der politischen, weniger der persönlichen Dimension nach) vor allem in den Beziehungen zu anderen Männern befriedigen. Dies wurde besonders deutlich, als der Kommunarde Fritz Teufel nach der Demonstration gegen den Schah von Persien im Juni 1967 ins Gefängnis kam. Die auf die Verhaftung folgende Solikampagne war teilweise recht kräftezehrend, vor allem weil in den Sommerferien kaum jemand außer den in der Zwischenzeit hauptsächlich männlichen Kommunarden (6) vor Ort war, um Teufel zu unterstützen, und sie sich (wie meistens) aufwendige, weil theatralische, ironische, öffentlichkeitswirksame, Aktionen einfallen ließen. So wurde Fritz Teufel mit Büßerhemd auf einem Karren zum Untersuchungsgefängnis Moabit gefahren.
Ihre sexuellen Bedürfnisse, so zumindest die Idee, hätten sie dagegen mit den Frauen ausleben können, für die sie dann nicht einmal wie in bürgerlichen Beziehungen die Verantwortung übernehmen mussten. Die Kommunardinnen ihrerseits suchten Sicherheit weiterhin bei den Männern der Kommune, wodurch die Beziehungen ein Ungleichgewicht bekamen. Über einstimmend berichten die Frauen aus der Zeit, dass es Solidarität unter den Frauen in der Kommune nicht gegeben hätte. So ging die Aufhebung von privat und öffentlich, wie sie hier vollzogen wurde, auf Kosten der Frauen. Die Aufteilung der Reproduktionsarbeiten scheint nicht allein ein Garant dafür zu sein, dass sich auch die Frauen befreien konnten.
Im Gegensatz zur Kommune I war der Ansatz der Kommune 2 auch für die darin lebenden Frauen interessant, da sie hier eine Möglichkeit der Befreiung finden konnten. Dafür war es sicherlich nicht unbedeutsam, dass diese Kommunardinnen den Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit auf die Reproduktionsarbeit legten und etwa im Kursbuch ein sehr lesenswertes Protokoll ihrer Kindererziehung veröffentlichten. Bei der K2 bestand nun umgekehrt eher die Gefahr, dass sie sich in ihrer Privatpsychoanalyse verhedderte, vor allem nachdem sie sich 1967 aus dem SDS zurückgezogen hatte, um sich mehr mit der eigenen Verstricktheit in der bürgerlichen Gesellschaft zu beschäftigen. Erst die Kinderladenbewegung und die Basisbewegungen boten ihnen ab Winter 1968 wieder ein Feld, die individuelle Befreiung mit der politischen Praxis zu verbinden. Allerdings wurden hier eben die Bedürfnisse der Frauen deutlich stärker berücksichtigt. So wurden intime und feste Beziehung in der K2 nicht tabuisiert, sondern es galt vielmehr, dass innerhalb der Beziehung Freiheit zu schaffen sei, so dass sich jeder sexuell, geistig, beruflich und menschlich verwirklichen konnte. Die Aufhebung der Eifersucht und des Besitzdenkens innerhalb von Beziehungen war ein wesentlicher Punkt in der K2 und es wurde versucht, möglichst offen darüber zu reden – was zwar nicht immer leicht, durch die Enge der Kontakte und die sich daraus ergebende Sicherheit aber zumindest möglich war. Hier kam es auch zu sexuellen Kontakten mit anderen Kommunarden, weil die Beziehungen innerhalb der Kommune eng waren und es sich einfach ergab. Groupieverhältnisse wie in der Kommune I existierten hier nicht. Die ehemalige Bewohnerin Christel Kalisch scheint sich, wie sie im Rückblick feststellt, innerhalb der K2 durchaus geborgen gefühlt zu haben und traute sich dort auch, politisch mitzureden. Weil die Kommune 2 weniger auf coole Politstars ausgerichtet war, bot sie sich weniger als popkulturelles, das Begehren der Jugend erfassendes Phänomen an, und ihre Mitglieder erreichten demnach nicht die gleiche Berühmtheit wie die der Kommune I. Dafür scheint sie – nach Aussage der Beteiligten – ein deutlich einfacher zu lebender Versuch des gemeinschaftlichen Zusammenlebens gewesen zu sein, da zumindest versucht wurde, die Bedürfnisse der Einzelnen ernst zu nehmen. Auf dieser Grundlage konnte eine Basis für eine längerfristige politische Arbeit geschaffen werden, die mit der Beteiligung an der Basisgruppe Wedding auch die politische Tätigkeit mit Arbeiterinnen einschloss.
(5) Wolfgang Kraushaar bestreitet dies. Er meint, es gäbe keine Belege für die Urheberschaft von Gretchen Dutschke für das erneute Aufkommen der Idee der Kommune als ihre eigene Zeugenschaft. Aber sein angeführter Grund, dass Gretchen in Kochel in der Runde nicht den Mund aufgemacht hätte, außer mit Rudi zu flüstern, ist ja kein Widerspruch zu der hier zu lesenen Darstellung (Wolfgang Kraushaar; SZ: 24.04.2018)
(6) Die einzige Frau, die jetzt in der Kommune wohnte war die Freundin von Rainer Langhans Antje Krüger, die jedoch sich leider nirgendwo schriftlich geäußert hat.