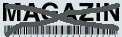Franz Hahn
Nochmal zu Wolfgang Pohrt

 A6-Booklet (Zum Falten, Schneiden und Tackern)
A6-Booklet (Zum Falten, Schneiden und Tackern)
Die letzten Jahre taucht immer wieder der Name Wolfgang Pohrt im Feuilleton auf. Man kann von ihm als „einem der streitlustigsten, klügsten, bösesten und originellsten Publizisten“ ebenso lesen wie dass es sich hier um einen „unnachgiebigen Gesellschaftskritiker“ handle, der „ohne Rücksicht gegen den Konformismus und die Wohlfühllügen der Linken polemisiere“. Ein geradezu „genialer linker Kritiker“ also. Über die Wirkung dieser „beißenden Polemiken“ erfährt man außerdem und anlässlich seines Todes Ende 2018: „Er hinterlässt mehr Feinde als Freunde. Das hätte ihm gefallen.“ Nur scheinen seine Feinde weitgehend verstummt zu sein, denn man findet inzwischen beinahe nur noch Gefälligkeit. Erst eine Runde Gefälligkeitsnachrufe, eben wegen seinem Tod, dann eine Runde Gefälligkeitsrezensionen, weil seine gesammelten Werke sukzessive gedruckt wurden, und schließlich eine längliche Gefälligkeitsbiographie, um nicht zu sagen eine „kongeniale Biographie“. Denn war es schon „durchaus ein Genuss, Pohrt zu lesen“ – er ist nicht nur „intellektueller Unruhestifter“, sondern auch ein „glänzender Stilist“ –, so bietet die Lektüre der Biographie vollends einen „ansteckenden Genuss“, ein „absolutes Vergnügen“. Und wenn diese Biographie einen auch nicht gerade in Unruhe versetzt, sie gibt diesmal immerhin Anlass für eine Diskussionsveranstaltung, nämlich beim Institut für Sozialgeschwätz in Hamburg. Es handelt sich um eine kleine Feuilletonblase; eine Art hilfloses Marketing.
Jetzt jedenfalls ist die Werkausgabe von Wolfgang Pohrt durch gesammelte Briefe vervollständigt worden, warum also keine weitere solche Runde: „Von mir aus auch eine Gefälligkeitsrezension, wenn man es ihr nur nicht anmerkt“, schreibt Pohrt 1984 an Wackernagel, damals inhaftiertes Mitglied der Roten Armee Fraktion. Und insofern eine solche Rezension eigentlich eine Annonce ist, voilà:
„Schätzungsweise die Jahrgänge ab 1990 könnten an der Lektüre alter Essais von Wolfgang Pohrt Gefallen finden, die wie ein Bericht aus der Vorzeit wirken. Er war ein Aufklärer und wenn man sich einlässt, erfährt man etwas vom dialektische Denken dieser Zeit. Pohrt war nämlich so etwas wie ein ideeller Gesamtlinker Westdeutschlands, einer Linken, die infolge der Protestbewegung von 1967 entstanden war und im Grunde bis heute verwest, wenn Covid ihr auch ein weiteres Mal den Garaus gemacht hat. Damals war er unter Linken immerhin etwas umstritten, da man den Streit mochte, aber heute zählt selbst Dietmar Dath unter seine Liebhaber. Und zu Recht, da man aus seinen Essais, Vorträgen und nun Briefen die Geschichte dieser Linken noch am genausten erfährt. Er wurde dafür sogar einmal von der Zeitung Revolutionärer Zorn zitiert, eine weitere ergiebige Quelle dieser Zeit. Gerade die frühen bei Rotbuch erschienen Schriften Pohrts sind gut, da man ihnen anmerkt, dass der linke Familienkrach noch eben erst beginnt. Man bestellt sie am besten antiquarisch in der Erstausgabe. Mehr der Zukunft zugewandt ist sein letztes Buch: Kapitalismus Forever. Dieses Buch hat den Vorteil, dass selbst die zahlreichen Liebhaber Pohrts es nicht mögen.
Diese Liebhaber und hier insbesondere die durchaus zahlreichen Anhänger Pohrts, die in den 90ern erwachsen wurden, können, so sie es nicht längst getan, den Tiamat-Verlag durch Kauf der teuren Pohrtwerke im billigen Plastikeinband unterstützen und so manch einen schönen, bislang unveröffentlichten Beitrag lesen.
Für beide Marktsegmente eignen eben die Briefe, die oftmals kleine Essais sind und den Adressaten angenehm belehren. Nebenher erfährt man alles Wesentliche zu seiner Biographie. Die Briefe eignen sich auch als Geschenk. (ISBN 978-3-89320-297-3)“
Aber zurück zum Thema. „Lieber Wackernagel, ich bleibe dabei: wem man partout nicht weh tun will, den soll man auch nicht rezensieren. Man spürt´s halt am Text, daß das Risiko eines Verrisses gar nicht bestanden hatte und das macht ihn flau.“ Nur kann man einem Toten nicht mehr weh tun. Noch als Pohrt 2012 sein letztes Buch herausgab, durfte man in der Jungen Welt lesen: „Mach et jut, tschüssikowski, bye-bye. Wolfgang Pohrt verabschiedet sich vom Marxismus“. Außerdem sei „sein Buch alles andere als brillant“. Eine vorurteilsfreie Leserin mag sich dann immerhin gedacht haben: „Wenn ein durchschnittlicher Feuilletontyp so urteilt, dann kaufe ich das Buch.“ Und sie hätte ein streitbares und sogar gut geschriebenes Büchlein bekommen und immerhin tatsächlich kein marxistisches. Inzwischen gibt es kaum solche Gefühlsregung mehr und derselbe Autor schreibt 2018, diesmal im Neuen Deutschland: „Wolfgang Pohrt war unerbittlich, brillant und auch noch lustig: zum Glück wurde seine Werkausgabe begonnen.“ Lasst die Toten die Toten begraben.
* * *
Eine 12-bändige Werkausgabe und dazu eine akribische-öde Biographie. Irgendwas muss also an Pohrt dran sein, dass man ihn in seiner Schrift überleben lässt. Das führt uns zur leidigen Gegenwart, denn deren Bewohner sollen das am Ende lesen. Und bei Pohrts Eifer drängt sich die Frage geradezu auf, was er denn nun zu unserer mindestens verstörenden Gegenwart gesagt hätte, dieser so „scharfzüngige Polemiker und hellsichtige Ideologiekritiker“? Sein Denken auf die Gegenwart zu projizieren ist dabei immerhin riskant, da Pohrts politische Purzelbäume legendär sind. Jede Aufklärung fängt mit einer gehörigen Portion Sophismus an, der Geist erscheint in Widersprüchen und welche Seite je die ganze Wahrheit vorzustellen hat, liegt auch an der Laune des Sophisten. So ärgert sich die ehrliche Antiimperialistin Susanne Witt-Stahl noch heute und zu Recht über seine Kriegsposition 1991, als die USA gerade den Irak sprengte. Ganz ungefällig, zur guten Abwechslung. Aber sie könnte sich auch auf folgende Passage aus einem Interview mit Pohrt beziehen, in dem er 1998 in etwa das Gegenteil schreibt: „Stellen wir uns doch mal vor, es käme morgen die Nachricht, irgendwo sei eine amerikanische Botschaft oder ein amerikanisches Militärdepot in die Luft geflogen. Jeder verstünde das“. Das Interview für die Jungle World führte damals Jürgen Elsässer, heute Herausgeber von Compact. Soviel Querfront war bei den Linken selten. Wir sind also am Puls der Zeit.
Also, was sagte Pohrt, dieser „Sophist und Rebell“, nun zur neuerlich ausposaunten Zeitenwende oder zu ihrer gewaltigen Ouvertüre: der berühmt-berüchtigten Grippe, der politisch-medial gesteuerten kollektiven Hysterie, den ganzen staatlichen Verfügungen, den Einsperrungsmaßnahmen und dem Verlust noch der Reste von Begriff und Logik, vom Gefühl ganz zu schweigen. Seine Liebhaber verhalten sich im Allgemeinen zu letzteren Geschehnissen entweder stumm oder affirmativ, aber immerhin wagte sich einer seiner Adepten in Nachdichtung: „Ein allgemeiner Marschbefehl, ohne die geringsten Anzeichen von Marsch. Statt an die Front wurde die Jugend in den Hausarrest geschickt. Statt sie zum heldenhaften Kampf zur Rettung der Alten einzuziehen – die sich immer gefreut hätten, wenn ihnen jemand etwas Gesellschaft leistet, ihnen vorliest oder sie gar etwas pflegt – langweilten sie sich hinter ihren Devices und legten Speck an. Die Alten hat man dabei einfach verwelken lassen, der Eintritt in die Altenverwahranstalten war sogar verwehrt. Besucht hat sie schon davor keiner.“ Man weiß es nicht, vielleicht wäre er selbst dem hypochondrischen Sog verfallen oder er hätte die staatlich verordnete, in Deutschland trotzdem freiwillig vollzogene Selbstisolation keiner besonderen Erwähnung wert gefunden: „Ich könnte mir vorstellen“, schreibt er an Wackernagel, „daß ein Haftentlassender den Rückgewinn seiner Freiheit momentan vornehmlich als Verlust der Illusion erlebt, daß es irgendwo grundsätzlich anders als im Knast wäre.“ Oder das ganze aseptische Gesundheitsgeschwätz der letzten Jahre? Immernoch an Wackernagel: „Alle sind pausenlos mit ihrer Gesundheit beschäftigt und sehen so krank dabei aus, so bejammernswert ekelhaft kreatürlich.“ Das war je 1983, also in einer Zeit, die heute im Rückblick als recht glücklich erscheint.
Die Coronapsychose ist andererseits jetzt wieder vergessen, es grassiert eine gesellschaftliche Amnesie. Dazu ist erneut Miniweltkrieg, diesmal in der Ukraine, und sogar eine Minireprise der Friedensbewegung, „schon zu Lebzeiten ein Zombie“. Fast wie früher. Wagenknecht, Schwarzer, Sonneborn und mit Vad sogar ein echtrechter Brigadegeneral a.D.: alle vereint für den Frieden, immer in der Illusion, als würde diese Frage von Deutschland abhängen, und sei es als mächtiger Vasall der noch mächtigeren USA oder gar ohne sie. Aber den Marschbefehl bekommen einstweilen nur die ukrainischen Männer und jeder ahnt, dass die Tonnen an Kriegsgerät, die man das letzte Jahr in die Ukraine schaffte, dort mitsamt des für seine Bedienung eingesetzten Menschenmaterials sukzessive zerstört werden. Meat grinder ist ein passenderer Ausdruck als Abnutzungskrieg. Und das ist nur ein Teil der Front, denn Frankreich zieht sich aus Afrika zurück und überlässt es ganz ohne Krieg dem Feind. Zu allem Überfluss haben uns unsere Verbündeten jüngst einige zentrale Pipelines gesprengt und das war immerhin die Lebensader der deutschen Industrie. Pohrt: „Heute könnte Europa keine Weltkriege mehr führen, weil die Welt viel größer geworden ist und Europa darin die Rolle eines Altersheims spielt. Es wurde auch wirklich Zeit. Seit 2000 Jahren dasselbe Stück auf der gleichen Bühne, irgendwann ist es genug.“
Und die Alternative? Russland, China, die BRICS als Ganzes und sogar um Saudi Arabien, Iran oder Argentinien erweitert.… Vielleicht schließt sich Europa morgen an und bekommt einen Platz. Am Katzentisch. Kapitalismus forever, jetzt mit neuem internationalen Machtgefüge und brandneuen Technologien. Außerdem im Angebot: Seidenstraße statt Marshallplan. Pohrt: „Die Mühle dreht sich eben weiter. Die einen steigen ab, die anderen steigen auf, wie im Paternoster“.
Und die damit einhergehende Ablösung des Dollars als internationaler Verkehrswährung? Pohrt: „Geht morgen der Dollar kaputt, sind nicht nur die USA, sondern ist die ganze Welt mit einem Schlag schuldenfrei, weil die meisten Schulden auf Dollarbasis laufen“.
Aber hierzulande führt der jetzt durchgeführte Produktivitätsabgleich doch nur zu Inflation und Verarmung! Pohrt: „Über Sozialismus reden wir, wenn Deutschland und Uganda den gleichen Lebensstandard haben.“
Oder die obligatorische Putinkritik? Enden wir diese Grabschändung mit einer Stelle aus einem Brief an seinen braven Verleger Bittermann, 15. 2. 1988, kurz vor dem Untergang der UdSSR: „Von vermarktungsstrategischen Fragen abgesehen, interessiert mich ein Enthüllungsbuch über Stalin übrigens wenig, weil nach alledem, was Gorbis Perestroika so zutage fördert, man Stalin eigentlich nur eines vorwerfen kann: seine unverzeihliche Milde mit Panslawisten und nationalen Minderheiten.“ –
* * *
Das ist hilflos und müßig. Der Gegenwart werden sich die Gegenwärtigen stellen müssen, zumal Pohrt aus Frust oder Trauer immer wieder lange Zeit still geblieben ist und sich aus der unmittelbaren Kommentierung des Tagesgeschehens schon in den 90ern verabschiedet hat. Was aber hat Pohrt der Nachwelt nun wirklich hinterlassen? Ein paar Worte zu seinen letzten Texten, die man, nachdem sie den 10. Band einer Werkausgabe zieren, wohl oder übel Spätwerk nennen muß. Sein Verleger wollte es so. Spätwerke sind schwierig. Beethoven hat hier den Maßstab gesetzt und seine letzten Streichquartette wären sicher durchgefallen, wenn die Leute nicht längst in die Eroica verliebt gewesen wären. Mondlandschaften. Blanqui hat sich im hohen Alter statt mit der Kunst des Barrikadenbaus nurmehr mit der Bewegung der Kometen beschäftigt. Und der war immerhin im Gegensatz zu Pohrt ein echter Revolutionär. Oder Guy Debord, ein Mittelding aus letzteren beiden? So bewundernswert zu Zeiten der Situationistischen Internationale, aber später ein unverbesserlicher Alkoholiker und wirrer Verschwörungstheoretiker. Grundsätzlich gilt dabei: Bei guten Autoren sind die letzten Werke auch die besten. Sie werden aber gleichzeitig am ungünstigsten aufgenommen, da sich gute Autoren entwickeln, während ihr Publikum an irgendeiner Stelle mit der Entwicklung aufhört. Pohrts Spätwerk ist hier ein Mittelding und er wäre besser weggekommen, wenn man ihm kein Werk angedichtet hätte.
Es handelt sich dabei um das erwähnte Buch Kapitalismus Forever und einige daran anschließende Vorträge, die unter dem Titel Das allerletzte Gefecht gesammelt vorliegen. Das kostete ihm die letzten seiner Freunde, die ihn andererseits nicht zu bewundern aufhören. Sein Verleger Bittermann gibt an, er hätte sich mit Pohrt „inhaltlich zerstreiten“ müssen, wenn sie auch nur im Rahmens eines Interviews diskutiert hätten, als welches der Text zunächst konzipiert war. Enzensberger lobt immerhin den Stil, denn der sei „wie immer bei Wolfgang Pohrt, um ein paar Klassen besser als das, was man sonst lesen muß“ und Gremlicas altverstaubte Konkret bezichtigt Pohrt des Klassenverrats. Beim jüngsten Gequassel des Instituts für Sozialkritik jammert dann Jan Phillip Reemtsma, der Sohn des Zigarettenfabrikanten Philipp Fürchtegott Reemtsma, dass er dem Zyniker gerne das Rauchen abgewöhnt hätte, aber der war irgendwie so seltsam stur. Dath rätselt derweil über den seltsamen Nihilismus Pohrts, der einmal sogar die Ursache für einen Mord benannte: „Ein 14jähriger Junge hatte seine Mutter erstochen: Sie von Beruf Kinderpsychologin, der Vater Pädagoge, linkes akademisches Milieu. Klare Sache: Gegen zwei von der Sorte hat ein Junge nur bewaffnet eine Chance. Warum? Menschen ohne Gewissen, ohne Selbst, ohne Scham und ohne Würde kann man außer mit dem Messer nicht verletzen.“ Dath findet das zu krass, obwohl er ihn natürlich auch sehr gut verstehen kann. Fast wie ein Sozialarbeiter. Bittermann sekundiert: „Aus unserer Perspektive ist das krank“. Das war alles bei einer Veranstaltung, bei der man – so gesund ist man dann schon – „aus Hygienegründen kein Mikro“ hatte, jedenfalls keines, in das mehrere hineinspucken durften. Kein Publikumsmikrophon also, der Mensch ist dem Menschen ein Virus. Zum Glück ist niemand mit einem Messer aufgetaucht, das links-akademische Milieu war unter sich.
Der Inhalt von Kapitalismus Forever scheint trivial: „Der Kommunismus existiert nun schon so ausschließlich im Ideenhimmel, dass man anfangen muss, daran zu zweifeln, ob er jemals, auf die Erde niederkommt. Um den Zweifel abzutöten, braucht man inzwischen schon fast die Glaubenskraft der frühen Christen. Ich bewundere Leute, die solche Glaubenskraft besitzen, ich selbst gehöre leider nicht dazu.“ Das waren nicht die warmen Worte, die das Publikum, in dem ich damals saß, gebraucht hätte, und es hat sich trotzdem nur diese gemerkt. Pohrt selbst wieder: „Vermutlich gefällt dieser Text keinem, der ihn liest. Mir auch nicht, und zwar deshalb, weil ich seine Aussagen für wahr halte und diese Wahrheit mir nicht gefällt.“ Aber auch: „Die Wahrheiten von heute können morgen durch unvorhergesehene Ereignisse unwahr geworden sein.“ Er meint damit nicht den 2020 weltweit ausgerufenen Hausarrest, ein immerhin unvorhersehbares Ereignis, durch das alles Vorherige unwahr wurde und das außer der Rockefeller Foundation und Donald Rumsfeld niemand vorhergesehen hatte. Was er meinte, war das Gegenteil: „Vielleicht klappt es mit der Revolution ja doch noch.“
So sehr es beruhigt, dass er nicht alle Hoffnung aufgegeben hatte, es ist eben doch nur Hoffnung, und sie sei hier nur erwähnt, damit man das Buch und ebenso die letzten Vorträge nicht in den falschen Hals bekommt. Pohrt misstraut dem Nominalismus. Fängt man mit dem Namen an und nennt Sozialismus oder kommunistische Revolution als ausdrückliches Ziel, dann ist man schon verloren. Keiner glaubt einem das, man selbst am wenigsten. Die Juden dürfen den Namen Gottes schließlich auch nicht aussprechen. Revolutionen „müssen aus heiterem Himmel kommen, wenn sie Erfolg haben sollen. Sie müssen vollkommen geheim bleiben. Am besten gelingt das, wenn die Revolutionäre bis zu dem Tag, wo sie Revolution machen, selbst nicht wussten, dass sie Revolutionäre sind.“ – „Es gibt eben Dinge, die man nur im Affekt machen sollte, zum Beispiel Revolutionen und Kinder. Wenn in solchen Fällen das Machen geplant, begründet, bedacht und begrübelt wird, wird nichts daraus, oder zumindest nichts Gutes.“
* * *
Warum dann aber überhaupt noch Worte gebrauchen? Pohrts letzter, ca. 250 Seiten umfassender antitheoretischer Versuch ist immerhin erstaunlich gebildet und soll wie ein grober Kehrbesen sämtliche verlorenen Revolutionsillusionen seit 1789 wegfegen, auf das nicht der Alp der Toten weiter die Lebenden drückt. Eben sein allerletztes Gefecht. Man muß dazu sagen, daß die Königsgrippe 8 Jahre später mit diesen Illusionen nochmal gründlicher aufgeräumt hat, als Pohrt das vermochte, und vielleicht schuf diese konzertierte Staatsaktion eben den Boden, auf dem irgendwann Revolutionäre gedeihen, die „selbst nicht wussten, dass sie Revolutionäre sind.“ Aber die Negation durch die gewaltige Eruption innerhalb der Herrschaft war blind, während bei Pohrt zahllose Fragen aufkommen, die sich einem stellen, wenn man sich – und sei es aus purem Trotz – für Kommunismus und Revolution interessiert. Und er fasst Einwände zusammen, die einem notwendig kommen und die man gelten lassen muss, will man nicht immer wieder auf derselben illusionären Grundlage der alten Linken seine Maulwurfsarbeit vergeuden. Widerstand ist zwecklos! Seine 2012 sogar latent anstößigen Gedanken werden dabei jetzt immerhin dadurch gefälliger, dass ihr Gegenstand 2020 schlagartig noch tiefer in der Vorzeit verschwand. Und der Wind schüttelt spottend nieder auf sie Harfenschlag und Becherklang und Liebeslieder. Und sie schwinden und seufzen: „Unsere Zeit ist um.“
Zunächst das erhabene Ziel. Die Errichtung eines neuen Paradies, diesmal auf Erden. Kommunismus. Pohrt zitiert Marx: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft tritt eine Assoziation, worin die freie Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“. Sein Kommentar: „Ist das nicht ein fürchterlicher Kitsch“? Die Menschheit will ernährt und gewärmt werden, und ein Rad auszutauschen, während es im vollen Schwunge rollt, ist nun keine so einfache Sache, dass man die Probleme bei der Umsetzung mit hippieesken Phrasen übertünchen könnte. „Das Kardinalproblem besteht darin, das hochkomplexe und obendrein dynamische System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung so zu steuern, dass es dann mit dem seinerseits auch wiederum dynamischen System der Bedürfnisse kongruiert“, benennt Pohrt im Stil der alten Marxisten die zu lösende Aufgabe, spielt kursorisch verschiedene Lösungsvarianten durch und benennt Gründe ihres Scheiterns. Fazit: „Ein anderes Steuerungssystem als der Markt ist bislang leider noch keinem eingefallen.“ Es war kurz vor Niederschrift gerade Wirtschaftskrise gewesen, und der Kapitalismus hat seither nichtmal einen guten Ruf. Aber etwas Neues? Der Sprung ins Unbekannte? „Man spielt nicht mit dem Leben von 7 Milliarden Menschen“, und „er jedenfalls würde vorher sehr genau wissen wollen, wie das funktionieren soll, und danach käme eine Testphase.“ – Kinder hatte Pohrt nicht.
Wichtiger die Frage, wer im Namen Gottes eine Revolution machen solle, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt? Er schielt nicht ohne Grund auf die Jugend Kairos, die sich seinerzeit gegen ihre diktatorisches Regime erhoben hatten: „Sie haben das volle Recht, es mit Gewalt zu stürzen, ohne zu bedenken, was nachher kommt.“ Pohrts Gegenstand ist dagegen die verallgemeinerte Lethargie hierzulande und eines seiner Beispiele ist die Lethargie der Arbeitslosen. Zunächst eine Erinnerung an die Dynamik sich aufschaukelnder, am Ende vielleicht revolutionärer Massen, quasi ein geschichtlich-utopisches Traumportrait dessen, was ein ehrlicher Revolutionär sich wünscht: „Stehen hundert Einzelne wartend herum und fühlen sich von der schikanösen Prozedur provoziert, kann es zu Motzereien kommen, und die Motzereien können sich in einen Tumult aufschaukeln. Es kann sogar passieren, dass die Einzelnen sich als Masse empfinden und so handeln, indem sie zum Beispiel das Mobiliar zerlegen und den Schalter stürmen. In der Masse fühlt man sich geschützt und stark, die Menschen denken und handeln dann anders, als sie dies in ihrer Eigenschaft als Einzelperson täten. Hinzu kommt, dass man Publikum hat, und, von ihm angespornt, sich zu Äußerungen und Aktionen hinreißen lässt, die man sich verkneifen würde, stünde man alleine vor dem Schalter, hinter dem der Beamte thront wie der liebe Gott. Massen sind stets ein Risiko, weil sie eine unkalkulierbare Eigendynamik entwickeln können. Treten solche lokalen Massenphänomene öfter auf, liegen Unruhen in der Luft, von denen man im Voraus nie weiß, zu welchem Resultat sie am Ende führen werden. Es kann passieren, dass Teilerfolge die Massen dazu ermutigen, aufs Ganze zu gehen, es kann passieren, falls Repression ihren Zorn anstachelt.“ – Man findet gegenwärtig kaum solche revolutionären Visionen. Der Skeptiker fängt beinahe zu glühen an, aber er bleibt eben Skeptiker: „Darum ist es sehr clever von der Sozialbürokratie, Situationen mit Restrisiko erst gar nicht entstehen zu lassen, also die Kunden freundlich zu behandeln, sie nicht dauernd antanzen zu lassen, sondern ihnen Geld aufs Konto zu überweisen, wie wenn sie noch Gehaltsempfänger wären. Sie sind aber keine, sie treffen keine Kollegen, ein Wirgefühl stellt sich nur bei Fußballspielen der Nationalmannschaft ein. Im Alltag fühlt sich jeder so machtlos und bedeutungslos wie eine Portion Fliegendreck, und so fühlt er sich nicht nur, sondern das ist er als isolierter Einzelner auch“. Die Lösung der alt gewordenen Linken ist dann, eine Arbeitsloseninitiative zu gründen, um der staatlichen Isolation die Nestwärme etwa eines Kiezladens entgegenzusetzen. „Aber was sollen die Arbeitslosen denn tun, wenn sie zusammenkommen, wo jeder doch die Geschichte des anderen schon aus eigener Erfahrung kennt? Wenn sie sich in einem Raum treffen, in den sie aus freien Willen gekommen sind? Nirgends ein Zwang, gegen den man sich wehren, nirgends ein Schalter, den man gemeinsam zerlegen kann – wie sollen sie unter solchen Treibhausbedingungen Kollektivbewusstsein, Solidarität und Angriffslust entwickeln? Also, was sollen sie tun? Gemeinsam ‚Lohnarbeit und Kapital‘ lesen? Sie haben doch weder das eine noch das andere, und Seminare haben noch nie genutzt. Man braucht eine Wut und eine unmittelbare Konfrontation mit dem Feind für eine Revolte, ich kenne keine, die ohne die Polizei auf die Beine gekommen wäre“.
* * *
An solchen Fragen erkennt man einen Revolutionär und nicht am mitunter auch noch selbst umgehängten Etikett. In diesem Fall einen verhinderten Revolutionär, der dazu noch in die Jahre gekommen war. „Richtige Revolutionäre sind voller Ungeduld und immer in Eile, die Zeit drängt“, und Pohrt schreibt mal wieder einen Essai und liest ihn in einer Kneipe vor. Verhindert? Es gibt objektive Gründe dafür, dass man kein Revolutionär werden kann, selbst wenn man gerne würde, und man findet viele davon nicht nur in den letzten Schriften Pohrts. Im Grunde beinhaltet sein theoretischer Brocken, die Theorie des Gebrauchswerts, schon dieselbe nur praktisch zu widerlegende Widerlegung der Möglichkeit einer kommunistischen Umwälzung wie die hier behandelten Texte, nur eben Horkheimer-marxologisch verpackt. Aber wie Horkheimer und später Che Guevara sagten: „Je unmöglicher der Kommunismus ist, desto verzweifelter gilt es, für ihn einzutreten.“ Ohne Existentialismus keine Revolution, und umgekehrt ist es „vollkommen zwecklos, eine Revolution zu fordern, die man nur beschreiben, aber nicht machen will. Marx nicht, sonst hätte er uns ein bedeutend schmäleres Werk hinterlassen. Und wir nicht, sonst wären wir im Knast oder tot.“ Im Knast oder tot waren damals eben die Leute seines Vereins, die sich der Roten Armee Fraktion von Baader und Ensslin anschlossen, also der existentialistische Flügel der 68er. Pohrt an Wackernagel: „Die Vernunft als Einziger gegen den Rest der Welt zu verteidigen, erfordert und begünstigt in der Tat einen Starrsinn, eine Verstocktheit und einen Realitätsverlust, der an Irrsinn grenzt – das Risiko jeder Opposition im Spätkapitalismus.“ Allein, Pohrt war zu klug, und das bewahrte ihn auch subjektiv davor, die objektiven Gründe missachtend, trotzdem Revolutionär zu werde. Immer noch an Wackernagel: „Man kann auf Dauer nicht der einzige Vernünftige unter tausend Wahnsinnigen bleiben, sondern wird dabei auch verrückt, nur ein bisschen anders, und das war am Ende wohl das Schicksal der RAF.“ Reflexion ist immer ein Mittel gegen Revolution und wenn sie Pohrt vielleicht auch nicht vorm Verrücktsein bewahrte, so immerhin vorm Knast. Überhaupt war der Impuls der frühen Roten Armee Fraktion ihm 1969 alles andere als fremd, und mehr als 15 Jahre später schreibt er noch: „Der Fehler der RAF war weder die Anwendung von Gewalt noch waren es Kriminaldelikte, sondern ihr Fehler war die Niederlage im antiimperialistischen Kampf“. Einsichten, die seine integrierten Kollegen nicht haben konnten. Einer von ihnen – Christoph Türcke – soll daher gefragt haben: „Warum hat Pohrt dann eigentlich nicht zum Erfolg der RAF durch Mitgliedschaft beitragen wollen?“ Und warum eigentlich nicht? Zusätzlich zum obligatorischen Bekennerschreiben zu jedem Anschlag noch eine beißende Selbstkritik aus der Feder Pohrts. Immerhin haben später die Revolutionären Zellen aus einer Polemik von Pohrt gegen den reformistischen Teil der Hausbesetzer zitiert, nämlich in einem solchen Bekennerschreiben eines Anschlags auf eine Wohnungsbaugesellschaft in gewerkschaftlicher Hand. Die Stelle war also vakant. Und unter denjenigen Linken, die eben nicht einfach Lehrer und Beamte werden wollten, hing es von den Zufällen der Biographie ab, ob sie solch Wagnis eingingen, und es hätte vielleicht nur einer Laune des Privatlebens bedurft, um Pohrt vom rechten Pfad eines aus der Akademie ins Feuilleton fliehenden Konformisten abzubringen, über den man solche Essais schreiben kann wie diesen hier. Wackernagel etwa landete bei der RAF, um einer Frau zu imponieren, frei nach dem Motto: „Das kann ich auch.“ Pohrt heiratete dagegen eine Balletttänzerin ohne solche Affinitäten. Oder der Fall von Norbert Hofmann, den Pohrt bei seinem kurzem Versuch kennengelernt hatte, in Lüneburg bei einer staatlichen Institution unterzukommen und der Jahre später an Pohrt schreiben wird: „Vor 25 Jahren half ich einigen Leuten von der RAF, bekam dafür eine Gefängnisstrafe, und der Paragraph 129 vereitelte nachdrücklich jede Versuchung zum ‚Marsch durch irgendeine Institution‘: bereut habe ich jene Hilfe nie“. Pohrt darauf: „Ihr Brief war eine angenehme Überraschung: Sie also auch. Im Schreibtisch meines Lüneburger Büros eingeschlossen, lag manchmal komisches Zeug herum. Dies und anderes blieb in meinem Fall unentdeckt. Es freut mich, dass man auf ähnliche Erfahrungen zurückblicken kann und sie nicht vergessen hat.“ – Es wird oft gerätselt, was den nun eigentlich den Reiz des Pohrtschen Negativismus ausmacht. Es ist das. Che Guevara hat ihn mehr inspiriert als Marx, wenn er auch die Schreibmaschine statt das Gewehr wählte und so von den Banküberfällen der anderen nur träumte. Abschließend also nochmal Pohrt an Wackernagel, 31. Oktober 1983: „Und richte Gert Schneider aus, daß es außerordentlich schmeichelhaft ist, Leser wie Euch zu haben.“ Im November 1977, erfährt man bei Wikipedia, reisten Schneider und Wackernagel nach Amsterdam, um Schmerzmittel für Peter-Jürgen Boock zu beschaffen. Dabei betraten sie am Abend des 10. November 1977 eine konspirative Wohnung, die von der niederländischen Polizei observiert wurde. Noch am selben Abend wurden Schneider und Wackernagel an einer Telefonzelle gestellt und nach einem Schusswechsel festgenommen. Schneider zündete dabei eine Handgranate und wurde selbst durch mehrere Schüsse schwer verletzt.
(1. April 2023)
Die Zitate aus den Feuilletons entstammen der FAZ, TAZ, Jungle World, Konkret, dem ND, der Welt und Jungen Welt, dem Tagesspiegel und haGalil sowie einem Mitschnitt der Pohrtgedächtnisveranstaltung des Institut für Sozialgeschwätz. Zitate von Pohrt sind fast vollständig aus Band 10 und 11 der Werkausgabe.